
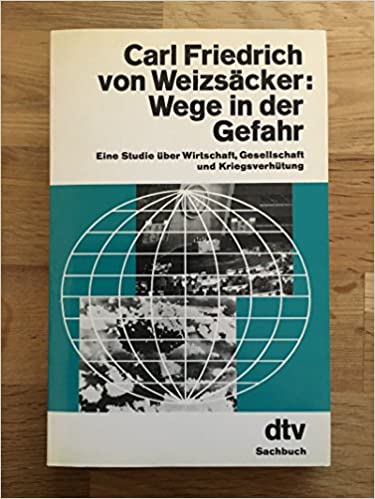
1. Wege aus der Gefahr
Eppler-1981
«Das Neue tritt nicht in Erscheinung als mitreißendes Programm, als beflügelnde Utopie, als unwiderstehliche Welle, schon eher als Zweifel am Herkömmlichen, als tastendes Suchen nach erfüllterem Leben, als neue Formen menschlicher Kommunikation, als Bürgerinitiative gegen technokratischen Größenwahn, als Streit um bislang Unbestrittenes, als neuer Wegweiser, auf dem keine Endstation verzeichnet ist, allenfalls die nächste und übernächste Ortschaft.»
11-29
Mut zur Zukunft
Wege aus der Gefahr — das klingt wie ein Echo, vielleicht sogar ein kritisches Echo auf C. F. von Weizsäckers Versuch, <Wege in der Gefahr>(1;1976) zu weisen. Es klingt vor allem ärgerlich unbescheiden, und dies in einem historischen Moment, in dem es Grund zur Bescheidenheit gibt.
Wir sind genügsamer geworden als in der Aufbruchstimmung der frühen siebziger Jahre, vorsichtiger auch als in jenen frühen sechziger Jahren, als es üblich war, die wohlgeordnete Gegenwart einer funktionierenden Wohlstandsgesellschaft durch mehr oder minder gigantische Planungen unangefochten in eine bessere Zukunft fortzuschreiben.
Beides ist uns gründlich vergangen: das Pathos des Aufbruchs zu neuen Ufern, aber auch der Glaube an eine Zukunft, die sich einfach aus technokratischer Fortschreibung ergibt.
<Wege in der Gefahr> — das meint doch: Wer nicht mehr geben will, als er hat, kann allenfalls Schleichwege suchen durch die Gefahren der achtziger Jahre, Gefahren, an denen keiner von uns etwas ändern kann. Ist es nicht vermessen, Wegen nachzuspüren, die aus der Gefahr führen?
Man tut Weizsäcker sicher nicht unrecht, wenn man die Formel <Wege in der Gefahr> im Zusammenhang sieht mit dem, was der von ihm beratene Bundeskanzler Krisenmanagement nennt. Seit der ersten Ölpreiskrise bestand Politik in den meisten westlichen Industrieländern überwiegend aus ökonomischem und außenpolitischem Krisenmanagement. Helmut Schmidts Krisenmanagement unterschied sich vom amerikanischen oder französischen überwiegend dadurch, daß es erfolgreicher war. Und das sollte niemand geringachten.
Wenn nicht alles täuscht, ist dieses Krisenmanagement an seine Grenzen gestoßen. Das kündigte sich schon an in einem Bundestagswahlkampf, in dem die Zukunft praktisch nicht vorkam — es sei denn als die zukünftige Staatsverschuldung. Wenn sich die großen politischen Blöcke, den Blick starr auf die Vergangenheit gerichtet, nur noch längst verjährte Fehler vorrechnen, dann liegt der Schluß nahe, sie hätten letztlich beide das Gefühl, die - konsequent verschwiegene - Zukunft dürfte überwiegend in der Exekution von Sachzwängen bestehen, denen sich keine Regierung entziehen könne. Nichts führt zu üblerer Polarisierung als gemeinsame Ratlosigkeit, zumal wenn man sie - und wer wollte dies vor einer Wahl? - nicht eingestehen kann.
Noch nie hat sich nach einer Regierungserklärung — nicht einmal nach der Ludwig Erhards im Herbst 1965 — eine solche Atmosphäre geistiger Öde verbreitet wie nach der Regierungserklärung vom 24. November 1980. Man hatte den Eindruck, eine ganze Gesellschaft sei nach einer emotionalen Scheinpolarisierung jäh in den Sog des politischen Nichts geraten; lähmende Langeweile drang in die letzten Ritzen des gesellschaftlichen Gefüges ein. Niemand, ganz zuletzt die Opposition, konnte das Vakuum füllen, das sich aufgetan hatte.
Wenn Zukunft nicht in der Fortschreibung bekannter Trends besteht — das wurde erkennbar Anfang der siebziger Jahre —, wenn Zukunft sich nicht in optimistisch-schwungvoller Reformanstrengung gewinnen läßt — das wissen wir seit 1974 —, wenn schließlich nicht einmal das ökonomische Krisenmanagement mehr funktioniert — das wissen wir spätestens seit 1980 —, wenn Wachstum sich nicht mehr einfach machen läßt — das erfahren wir jetzt —, jenes Wachstum, ohne das uns doch Arbeitslosigkeit, ja das Ende des marktwirtschaftlichen Systems ins Haus stehen soll, was in aller Welt ist dann noch Politik?
Verlieren sich dann die Wege in der Gefahr nicht irgendwo im Morast?
Denn auch das außenpolitische Krisenmanagement stößt dann an unüberwindliche Grenzen, wenn alles darauf deutet, daß der Rüstungswettlauf zwischen den Supermächten völlig irrationale Formen annimmt, während die rapide wachsende Verschuldung der Entwicklungsländer immer rascher zu einer faktischen Re-Kolonialisierung führt; wenn auch in der Dritten Welt irrationale Ausbrüche wahrscheinlich werden, die wiederum die Weltmächte auf den Plan rufen. Werden da aus Wegen in der Gefahr nicht Wege in die Gefahr?
C. F. von Weizsäcker hat darauf selbst eine Antwort gegeben, ebenso klug wie deprimierend. Schon 1976 hat er lapidar erklärt, der dritte Weltkrieg sei wahrscheinlich, aber doch hinzugefügt: «Eine Politik, die ihn verhindert, ist möglich und wird heute versucht.»(2)
12
Wie sehr sein Vertrauen in eine solche Politik gelitten haben muß, zeigt ein Aufsatz in der <Zeit>.3 Unter der Überschrift: «Die Wissenschaft ist noch nicht erwachsen» beschäftigt sich Weizsäcker mit der Rolle der Wissenschaft für unsere westliche Kultur.
An dieser Stelle interessiert weniger seine Forderung, daß der Naturwissenschaftler sich künftig nicht mehr an den gesellschaftlichen Folgen seiner Arbeit vorbeidrücken dürfe. Hier kommt es auf den Schluß des Aufsatzes an, der — seltsamerweise — keinerlei Aufschrei in der öffentlichen Meinung hervorgerufen hat:
«Eine jetzt einsetzende Besinnung auf diese Rolle (der Wissenschaft) wird die schon begonnene politische Krise nicht mehr aufhalten. Ob ein früher und in breiter Front begonnenes Studium der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt dies vermocht hätte, läßt sich ebenfalls bezweifeln. Nach meinem Empfinden war es freilich eine moralische Pflicht der Wissenschaft, wenigstens diese Anstrengung zu machen. Diese Anstrengung hätte vielleicht eine Anzahl kluger und verantwortungsbewußter Menschen aus dem herrschenden Zustand der Verdrängung dieser Probleme in den Zustand der Verzweiflung an den Problemen gebracht. Und ohne den Durchgang durch die erfahrene Verzweiflung wird kein Schicksal gewendet.
Dieser Aufsatz stellt daher nicht die Frage, was zu tun wäre, um die Krise aufzufangen oder doch zu lindern. Diese kurzfristige Frage findet ihre Antwort im Feld praktischer Politik — behutsamer Außen- und Wirtschaftspolitik, rechtzeitiger Versorgungsplanung, maßvoller, aber entschlossener Schritte zum Bevölkerungsschutz. Dieser Aufsatz tritt einen Schritt vor der Aktualität zurück. Er stellt eine Frage grundsätzlicher Besinnung: Wie hätten wir Wissenschaft treiben und beurteilen sollen, als dafür noch Zeit war? Wie sollte eine Menschheit, die die Krise überlebt, zur Wissenschaft stehen?»
2) C. F. von Weizsäcker, Wege in der Gefahr, München, S. 109 (zit. nach der Taschenbuchausgabe)
3) Die Zeit Nr. 42/1980, S. 33 f
13
Hier wird also nicht mehr nachgedacht über die Wege in der Gefahr, sondern über den — offenbar nicht völlig auszuschließenden — Neuanfang für die wenigen, die vielleicht doch in Bunkern für den «Bevölkerungsschutz» überleben.
Man wird sich eines Tages nur mit Mühe vorstellen können, was eine Gesellschaft gelähmt haben muß, die über solche Sätze ihres renommiertesten Wissenschaftlers einfach zur Tagesordnung überging, zu jener Tagesordnung, auf der auch in den nächsten Jahren so faszinierende Fragen stehen wie die, ob sich der Vorsitzende der Freien Demokraten nicht vielleicht doch unter den Christdemokraten nach einem genehmeren und bequemeren Kanzler als dem gegenwärtigen umsehen könnte.
Unsere Gesellschaft droht an Hoffnungslosigkeit zu ersticken. Es fehlt ihr die Hoffnung darauf, daß es Wege aus der Gefahr gibt, und seien es nur Trampelpfade, auf denen die ersten sich durch Gestrüpp und hohes Gras durchkämpfen, bis schließlich so etwas wie ein Weg entsteht. Solche Hoffnung ist alles andere als blauäugiger Optimismus. Erich Fromm hat die Hoffnung beschrieben, die uns not tut und ohne die es auch keinen konstruktiven Realismus gibt:
«Hoffnung ist paradox. Sie ist weder ein passives Warten noch ein unrealistisches Erzwingen von Umständen, die nicht eintreten können. Sie gleicht einem kauernden Tiger, der erst dann losspringt, wenn der Augenblick zum Sprung gekommen ist. Weder ein müdes Reformertum noch schein-radikale Abenteuerlust dürfen als Ausdruck von Hoffnung gelten. Hoffen heißt, in jedem Augenblick für das bereit zu sein, was noch nicht geboren ist — und trotzdem nicht zu verzweifeln, wenn es in unserer Lebensspanne zu gar keiner Geburt kommt. (...) Der, dessen Hoffnung schwach ist, läßt sich selbst zur Bequemlichkeit oder zur Gewalttat herunterkommen; der, dessen Hoffnung stark ist, erkennt und begrüßt alle Anzeichen eines neuen Lebens und ist jederzeit gerüstet, dem zur Geburt zu verhelfen, was zum Geborenwerden bereit ist.»4
4) Erich Fromm, Revolution der Hoffnung, Reinbek 1974, S. 16/17 (d-2015:) E.Fromm bei detopia
14
Vielleicht ist heute mehr zum Geborenwerden bereit, als die erkennen, die sich mit viel gutem Willen in der folgenlosen Geschäftigkeit des politischen Alltags aufreiben. Das Neue tritt nicht in Erscheinung als mitreißendes Programm, als beflügelnde Utopie, als unwiderstehliche Welle, schon eher als Zweifel am Herkömmlichen, als tastendes Suchen nach erfüllterem Leben, als neue Formen menschlicher Kommunikation, als Bürgerinitiative gegen technokratischen Größenwahn, als Streit um bislang Unbestrittenes, als neuer Wegweiser, auf dem keine Endstation verzeichnet ist, allenfalls die nächste und übernächste Ortschaft.
Gegen Ende des Jahres 1980 haben manche, auch Helmut Schmidt selbst, laut darüber nachgedacht, ob ein Bundeskanzler die Aufgabe, geistiger Führung habe. Sicher: Ein Bundeskanzler wird nicht zum Predigen, sondern zum Regieren gewählt, nicht für geistige Höhenflüge, sondern für die unzähligen, kräftezehrenden Entscheidungen, die jeden Tag — und immer unter dem Risiko des Irrtums — gefällt sein wollen.
Aber dies ändert nichts daran, daß führen nur kann, wer vorangeht. Und vorangehen kann nur, wer spürt, was da «zum Geborenwerden bereit» ist, wer das Neue wahrnimmt, aufnimmt, es zu formen, zu leiten, zu gestalten und damit zu nutzen versucht. Gerade in der Demokratie bedeutet politische Führung, Wege zu weisen und sie selbst in kleinen, oft winzigen Schritten gegen hundert Widerstände zu gehen. Was zählt, ist nicht die Größe der Schritte, sondern die Erkennbarkeit der Richtung. Führung bedeutet nicht, den Bürgern zu sagen, was sie zu denken haben, sondern ihnen zu erläutern, wohin die kleinen Schritte führen sollen.
Mut zur Zukunft wächst da, wo Wege in eine gute Zukunft sichtbar werden, auch wenn niemand das Ende des Weges kennt. Mut zur Zukunft entsteht nicht, wenn wir darauf verweisen, bisher sei doch schließlich alles nicht so schlecht gelaufen, und dies werde auch künftig nicht anders sein. Dazu haben zu viele Menschen ein Gespür für die tödlichen Gefahren, die uns bedrohen. Wo keine Wege aus solcher Gefahr zu sehen sind, breitet sich nicht Mut, sondern Angst aus. Wo auch für die Regierenden Zukunft letztlich das ist, was an technischen Entwicklungen, politischen Zwängen, ökonomischen Krisen oder militärischen Katastrophen auf uns zukommt, ist die Angst auch dann nicht zu bannen, wenn die Bürger das Gefühl haben können — und dies bei uns durchaus zu Recht —, daß ihre Regierung besonnen und vernünftig darauf reagieren werde. Mut zur Zukunft entsteht wohl nur, wenn jeder die Chance sieht, teilzuhaben an einer gemeinsamen Anstrengung zur Überwindung von Zwängen, zur Entschärfung drohender Krisen und zur Vermeidung denkbarer Katastrophen.
15
Der Blick zurück
Wer die Generation der heute führenden Politiker aus der Nähe kennengelernt hat, versteht, warum gerade uns Deutschen der Blick nach vorn so schwerfällt. Vielleicht lähmt uns unsere Vergangenheit.
Die Politiker, die unsere Republik aufgebaut und geprägt haben, waren bestimmt durch eine Schlüsselerfahrung: das Scheitern der Weimarer Republik. Zwölf Jahre lang hatte sie die Frage nicht losgelassen: Wie konnte es in Deutschland zu einer Diktatur des Terrors kommen, die — so hatten viele es sogar vorausgesagt — Deutschland und Europa zugrunde richten mußte? Was hatten die Demokraten versäumt, was hatten sie falsch gemacht, daß sie dies nicht verhindern konnten?
Diese Frage verband Kurt Schumacher mit Konrad Adenauer, Carlo Schmid mit Thomas Dehler, Hans Böckler mit Reinhold Maier, Jakob Kaiser mit Herbert Wehner, jenem Herbert Wehner, der heute noch unter dieser Frage leidet wie kein anderer lebender Politiker. Und so verband diese Politiker auch der Wille, um keinen Preis die Fehler von damals zu wiederholen: Der zweiten deutschen Republik sollte das Schicksal der ersten erspart bleiben.
Weil die Richtungsgewerkschaften der ersten Republik sich im entscheidenden Augenblick gegenseitig lähmten, gründeten kluge Demokraten die Einheitsgewerkschaft.
Weil es in der ersten Republik allzu leicht war, schwache Regierungen zu stürzen, und allzu schwer, stabile Regierungen zu schaffen, kam in unser Grundgesetz das konstruktive Mißtrauensvotum: Eine Regierung kann nur abgelöst werden, indem ein neuer Kanzler gewählt wird.
Weil durch die Zersplitterung der Parteien die Weimarer Republik immer schwerer regierbar wurde, haben wir in unseren Wahlgesetzen die Fünfprozentklausel.
Weil die verkrusteten Weltanschauungsparteien damals eine klare Mehrheitsbildung erschwerten, haben wir heute Programmparteien, die sich als Volksparteien verstehen.
Weil im Europa der zwanziger Jahre der Nationalismus letztlich doch die Oberhand gewann, sind die Deutschen heute die überzeugtesten Europäer.
16
Im Rückblick läßt sich sagen: All dies war richtig, und was noch wichtiger ist, es war erfolgreich. Es hat sich gelohnt, daß die Gründer unserer Republik aus Weimar gelernt hatten. Daher haben wir heute eine demokratische Republik, die um ein Vielfaches fester gegründet ist als die von Weimar, fester als die meisten Demokratien dieser Welt.
Aber heute beschleicht uns der Verdacht: Könnte die Angst vor Weimarer Zuständen uns nicht auch zu Fehlentscheidungen führen? Jede Generation versucht, die Probleme ihrer Väter zu lösen. Das haben wir getan, gründlich und zu unserem Nutzen. Aber wenn wir uns zu lange damit beschäftigen, könnte es sein, daß auch wir unseren Kindern unsere Probleme hinterlassen.
Die Republik von Weimar war von Anfang an zu ungesichert, zu labil, zu schwach, um mit ihren Aufgaben fertig zu werden. Das ist unsere Republik nicht. Könnte es nicht sein, daß unsere Gefährdung heute eher in der Erstarrung liegt als im Mangel an Stabilität? Dann wären manche Parallelen, mit denen wir heute unser Handeln begründen, nicht mehr hilfreich. Sie könnten auch in die Irre führen.
Es wird behauptet, die Loyalität unserer Bürger zu ihrem Staat sei nur zu erhalten, wenn jedes Jahr mehr zu verteilen sei als im Jahr zuvor. Nun wird schon die rasch wachsende Produktivität dafür sorgen, daß auch mittelfristig entweder mehr Einkommen oder mehr Freizeit verteilt werden muß — und zwar auch dann, wenn die Wachstumsraten des Bruttosozialprodukts bescheiden ausfallen.
Aber sogar wenn dem nicht so wäre, müßten wir deshalb in die Instabilität von Weimar zurückfallen? Vielleicht blockieren wir auch hier mit der Angst vor Weimar eine Diskussion, die uns — nicht erst unseren Kindern — aufgetragen ist: die über Sinn und Unsinn, Richtung und Inhalt von Wirtschaftswachstum.
17
Einer der Gründe dafür, daß die Bundesrepublik, wo es um einen Ausgleich zwischen armen und reichen Völkern geht, eher bremst als vorwärtsdrängt, ist die Furcht, größere Opfer könnten, wie in Weimar, die Grundloyalität breiter Schichten zur Republik gefährden. Könnte es nicht sein, daß wir damit wertvolle Zeit vergeuden und uns den Vorwurf unserer Kinder zuziehen, wir hätten Chancen verpaßt, die nicht wiederkommen?
Plebiszitäre Demokratie hat zur Labilität der Weimarer Republik beigetragen. Könnte es nicht sein, daß Volksbegehren und Volksentscheide heute eher zur Auflockerung erstarrter Fronten als zur Gefährdung der Republik führen? Damals wurden demokratische Formen mißbraucht, um die Demokratie zu vernichten. Könnte es nicht sein, daß die Bürger, die heute mehr direkte Volksbeteiligung suchen, unsere Republik lebendiger und damit stärker machen wollen?
In den Parlamenten von Weimar saßen viele, die dort nicht hingehörten, weil sie die Republik nicht wollten. Könnte es nicht sein, daß unsere Schwäche genau die umgekehrte ist: daß in unseren Parlamenten manches nicht mehr — oder nicht ausreichend — zur Sprache kommt, was einen beträchtlichen Teil demokratischer Bürger umtreibt, etwa die Skepsis gegenüber einem scheinbar autonomen, politisch ungesteuerten technischwirtschaftlichen Prozeß, wie er in Atomkraftwerken seinen einprägsamsten, keineswegs seinen einzigen Ausdruck findet?
Es seien die Extremisten von rechts und links gewesen, die Weimar schließlich den Todesstoß gaben, so sagen wir zu Recht. Aber ist unsere Haltung gegenüber den Extremisten von heute klug, die sich auf diese Erfahrung beruft? 1932 hatten im Deutschen Reichstag Nationalsozialisten und Kommunisten zusammen die Mehrheit der Sitze und konnten in einer Negativ-Koalition demokratisches Regieren verhindern.
Heute gibt es in keinem deutschen Parlament einen Vertreter extremistischer Gruppen. Könnte es nicht sein, daß heute, im Gegensatz zu 1932, die Angst vor Extremisten mehr zur Erstarrung unseres politischen Lebens beiträgt, als Extremisten die Stabilität unserer Republik gefährden könnten?
Kurz: Könnte unser Starren auf Weimar und seine besonderen Gefährdungen nicht dazu führen, daß wir blind werden für die Gefahren von heute und morgen?
18
Das Unbehagen vieler junger Menschen in und an unserer Republik rührt nicht daher, daß sie nicht stabil genug wäre. Im Gegenteil, dieses Unbehagen hat seine Wurzel darin, daß diese Generation überall auf feste, oft starre Strukturen und Apparate trifft, sei es in der Wirtschaft, sei es in Parteien und Verbänden, in Universitäten und Kirchen, Apparate, gegenüber denen sie sich hilflos, ohnmächtig vorkommen, sogar wenn sie dort geduldet werden.
Viele haben das Gefühl, daß das, was sie umtreibt, an keinem Ort in unserer Gesellschaft anzubringen ist, nirgends aufgenommen wird. Deshalb wandern sie aus, sei es — und dies wäre noch das Erfreulichste — in kleine Alternativgruppen, die mit mehr Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität Ernst machen wollen, sei es in obskure Jugendsekten oder gar in die totale Resignation der Drogenszene. Wo immer junge Menschen eine Chance sehen, selbst mitzubestimmen, sich selbst einzubringen, etwa beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, da kommen wir aus dem Staunen nicht heraus ob so viel unverkrampfter Menschlichkeit und Bereitschaft zum Engagement.
Ganz im Gegensatz zur Weimarer Republik stehen sich heute in der Bundesrepublik zwei große politische Blöcke gegenüber, ungefähr gleich stark, beide in Bund und Ländern unmittelbar am Regieren beteiligt.
Wahlen werden oft von einigen hunderttausend Wählern entschieden, die — aus welchen Gründen auch immer — für die eine oder andere Seite votieren. Das hat seine Vorteile, gerade im Vergleich zu Weimar. Aber es führt auch dazu, daß Auseinandersetzungen nur noch taktisch geführt werden, daß Scheingefechte die Regel werden, daß die politischen Umgangsformen um so ruppiger und giftiger werden, je geringer die Unterschiede in der Sache sind, daß die zunehmende ideologische Verhärtung nicht Ausdruck, sondern Ersatz für Sachalternativen ist.
Wenn ein Abgeordneter der ersten Bank eingesteht, seit fünf Jahren sei im Bundestag nichts Neues mehr gesagt worden, wenn zwischen Regierung und Opposition nicht mehr um Alternativen für die achtziger Jahre, sondern nur noch um den kleinen taktischen Vorteil gerungen wird, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn viele Bürger, vor allem aus der jüngeren Generation, sich in diesem Betrieb nicht wiederfinden, wenn sie damit nichts zu tun haben wollen. Diese achselzuckende Abwendung von unserer Republik kann gefährlich werden.
19
Von der Weimarer Republik haben sich ganze Schichten abgewandt, weil diese Republik ihnen keine wirtschaftliche Sicherheit bieten konnte, weil sie die Demütigungen einzustecken hatte, die der Niederlage des Kaiserreichs folgten, weil sie kein stabiles politisches Fundament hatte. Daher waren die Alternativen, die damals angeboten wurden, meist Alternativen zur Republik: die Monarchie, der die Deutschnationalen nachtrauerten, die Räterepublik, die den Kommunisten vorschwebte, die faschistische Diktatur, die uns dann nicht erspart blieb. Heute haben diese Alternativen keine Chance mehr.
Jetzt und in den kommenden Jahren könnten sich viele von unserem Staat abwenden, nicht weil sie Alternativen zur Republik vermissen, sondern demokratische Alternativen in der Republik. Sie könnten sich abwenden, weil sie meinen, die Institutionen unserer Republik, die Parteien, Verbände und Verwaltungen, verstünden sich mehr und mehr als Selbstzweck, stünden sich selbst im Wege und noch mehr jeder konstruktiven Politik.
Man kann die Probleme der Väter auch allzu perfekt lösen. Und dabei die Probleme der Kinder aus den Augen verlieren. Historische Parallelen können den Blick auf die Wirklichkeit öffnen, sie können ihn aber auch versperren. Denn keiner steigt zweimal in denselben Fluß.
Von Krise zu Krise?
Das ökonomische Krisenmanagement
Jede demokratische Regierung von einigem Format und einiger Dauer legitimiert sich durch wenige zentrale Leistungen, die der Mehrheit der Wähler unmittelbar einleuchten und ihren Bedürfnissen entgegenkommen. Konrad Adenauer tat, was die Mehrheit der Deutschen nach dem Kriege wünschte: Er gab ihnen die Chance, durch harte Arbeit zu Wohlstand zu kommen; er gab ihnen durch den Beitritt zur Nato und die Einfügung in eine westeuropäische Gemeinschaft Sicherheit vor der immer neu beschworenen Gefahr aus dem Osten; er ersparte ihnen gründliches Nachdenken über ihre Vergangenheit.
20
Willy Brandt - was zwischen Adenauer und Brandt war, zählt kaum - repräsentierte und exekutierte den Wunsch der Mehrheit, über die Restauration des Gestrigen hinauszukommen, die Folgen des Zweiten Weltkrieges endlich zu sichten und zu ordnen und auch mit den östlichen Nachbarn zu einem friedlichen Nebeneinander zu kommen. Die Regierung Schmidt legitimierte sich dadurch, daß sie sich — besser als andere im In- und Ausland — auf ökonomisches und außenpolitisches Krisenmanagement verstand. Hatten Adenauer und Erhard den stürmischen Wachstumsprozeß des Wiederaufbaus getrost den Marktkräften überlassen können, hatten Schiller und Strauß durch einmaligen Eingriff die Wirtschaft wieder ankurbeln können, so schien nach 1973 die große Zeit des ökonomischen Krisenmanagements gekommen.
Heute ist die Frage, die einige von Anfang an stellten, nicht mehr zu unterdrücken: Was ist das Ziel dieses Krisenmanagements? Was wird damit angesteuert? Worauf will es hinaus? Produziert es nicht immer neue, immer schlimmere Krisen?
Wenn es je ein Leitbild für dieses Krisenmanagement gab, so waren sich die Akteure dessen meist nicht bewußt: Es war die Wiederherstellung einer möglichst reibungslos funktionierenden Wohlstandsgesellschaft mit hohen Wachstumsraten, Vollbeschäftigung, geringer Inflation, maßvollen Verteilungskämpfen und ohne ernstzunehmende Gefährdungen der inneren Sicherheit. Was den Krisenmanagern vorschwebte, war die Wiederherstellung der frühen sechziger Jahre, jener Zeit, als sie, auf das Jahr 1945 zurückblickend, ohne Abstrich und Zweifel sagen konnten: Nehmt alles nur in allem, wir haben etwas geleistet, was Bestand hat, sich fortsetzen und ausbauen läßt: die ungefährdete Wachstumsgesellschaft, in der schon die Fortschreibung bestehender Trends eine bessere Zukunft ergibt.
Diesem — nie formulierten und selten eingestandenen — Ziel entsprachen die Maßnahmen nach 1973. Sie orientierten sich — wenn auch nicht im Detail — an jenem Gesetz, das die Große Koalition nach der Rezession von 1966/67 als Waffe gegen künftige Unbill geschaffen hatte: das Gesetz zur Sicherung der Stabilität und des Wachstums. Wie Inflation bekämpfbar, Konjunktur dämpfbar war, so mußte Wachstum auch machbar sein, wenn man nur die richtigen Instrumente richtig einsetzte.
21
Hatten da ein paar verrückt gewordene Ölscheichs durch Entzug von Kaufkraft aus den Industrieländern eine Rezession verschuldet, so mußten die Werkzeuge aus dem Kasten geholt werden, die zur Reparatur bereitlagen: Steuersenkungen als Anreiz für Konsum und Investition, Investitionszulagen für Unternehmen, Sonderabschreibungen. Vor allem galt es, die Wachstumsmotoren auf volle Touren zu bringen, die sich in der Mitte der siebziger Jahre anboten: die Automobilindustrie und das Baugewerbe, weniger deutlich die Großchemie.
Im Baugewerbe mußte öffentliche Nachfrage die private ersetzen; das bedeutete immer neue öffentliche Bauprogramme — bei denen meist Projekte vorgezogen wurden, die ohnehin im nächsten Jahrzehnt anstanden. Für die Automobilindustrie galt es vor allem, Wachstumshemmnisse entweder zu beseitigen oder doch abzuwehren: Die Bundesbahn sollte sich durch Abbau von 10.000 km ihres Streckennetzes «gesundschrumpfen», der Bau von Autobahnen und Bundesstraßen «zügig» vorangetrieben werden. Eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf Autobahnen war — im Gegensatz zu allen Nachbarländern — nicht zu verantworten, der Wachstumsmotor durfte nicht gebremst werden.
Wurde das Öl knapp und teuer, so mußte man es durch Atomstrom ersetzen. Also wurden die Programme zum Ausbau der Kernenergie aufgestockt. Es mag sein, daß diese Politik der Wachstumsförderung, auch wenn sich die Wachstumsraten im Trend weiter vermindert haben, vorübergehend die Zahl der Arbeitslosen drücken konnte. Jetzt hat sich dieses ökonomische Krisenmanagement aus den verschiedensten Gründen in Sackgassen festgefahren.
Der Anteil der Kernenergie an der Energieversorgung blieb weit geringer als geplant — was nicht weiter schadete, weil alle Prognosen für den Stromverbrauch weit überhöht waren. Die Möglichkeiten der Energieersparnis waren weit größer als angenommen, die Dezimierung der Streckennetze der Bundesbahn ließ sich gegen regionale Widerstände glücklicherweise nicht durchsetzen, für den Bau von Autobahnen fehlte schließlich das Geld.
22
Schlimmer war, daß die Wachstumsmotoren Automobil und Bau (übrigens auch die Chemie) so energieintensiv waren, daß gegen Ende der siebziger Jahre die Nachfrage nach Öl wieder stieg — in fast allen westlichen Industrieländern, deren Krisenmanagement sich auf ähnlichen Bahnen bewegte — und damit den Ölländern die Chance bot, den Ölkunden ein weiteres Mal tief in die Tasche zu greifen. Und so wiederholte sich 1980, was 1973/74 soviel Ärger bereitet hatte: Wieder schöpften die Ölproduzenten die Kaufkraft — auch die Investitionskraft — ab, die bei uns Wachstum schaffen sollte. Und diesmal so gründlich, daß auch die Leistungsbilanz tief ins Defizit geriet und die Mark — aus mehr als einem Grund — rasch an Wert verlor, was natürlich die Ölrechnung, die in Dollars erstellt wird, noch einmal erhöhte.
Das Neue zu Beginn der achtziger Jahre ist nicht, daß für ein Jahr kein Wachstum mehr prognostiziert wird, vielleicht eine Rezession droht. Das hat es immer wieder gegeben. Das Neue ist, daß die Krisenmanager dies ohne Gegenmaßnahmen hinnehmen. Wurde in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre meist ab Frühsommer die öffentliche Diskussion von der Frage beherrscht, welche neuen Programme nötig seien, um zu verhindern, daß die Wachstumsrate ein ganzes oder gar eineinhalb Prozent unter der Zielprognose bleibe, so schreckte die Aussicht auf Nullwachstum 1981 noch nicht einmal von der radikalen Streichung öffentlicher Ausgaben ab.
Das hat gute Gründe: Die Verschuldung der öffentlichen Hände hat seit 1974 auf eine so dramatische Weise zugenommen, daß es nun gute ökonomische und politische Gründe gibt, über ein strukturelles jährliches Defizit von 50 Mrd. DM in den öffentlichen Haushalten hinaus keine neuen Kredite mehr aufzunehmen. Dabei ist es weniger die absolute Höhe der öffentlichen Verschuldung als das Tempo der Neuverschuldung, was beunruhigen muß. Waren zu Ende des Jahres 1974 Bund, Länder und Gemeinden mit fast denselben Beträgen verschuldet (Bund 69,4 Mrd., Länder 68,6 Mrd., Gemeinden 67,3 Mrd.), so hatte sich bis zum Ende des Jahres 1979, also fünf Jahre danach, die Schuldenlast des Bundes verdreifacht (201,5 Mrd.), die der Länder verdoppelt (138,9 Mrd.), während die kommunale Kreditaufnahme sich im Rahmen der ökonomischen Zuwachsraten hielt (87,6 Mrd.).
Da übrigens der Anteil der Investitionen am Haushalt bei den Gemeinden am höchsten, beim Bund am geringsten ist, stimmt es natürlich nicht, daß die Verschuldung überwiegend Zukunftsinvestitionen zugute kam. Ende 1981 dürften die Bundesschulden die Grenze von 250 Mrd. bereits überschritten haben, also beim Vierfachen von 1974 angekommen sein, auch wenn keinerlei neue Konjunkturprogramme aufgelegt werden.
23
Alle ökonomischen Theorien, wonach die öffentliche Verschuldung ohne Nachteil fast beliebig gesteigert werden könne, ändern nichts daran, daß der Zinsendienst für die aufgenommenen Kredite den finanziellen Spielraum der Finanzminister immer weiter einengt, der Staat also bei gleichbleibender Steuerquote in seiner Handlungsfähigkeit immer weiter eingeschränkt wird. Auch die Schwäche der Mark ist nicht ganz unabhängig vom Ausmaß der öffentlichen Verschuldung. Vor allem aber haben Diskussion und Agitation im Wahlkampf 1980 die gefährlichen psychologischen Reizschwellen deutlich gemacht, an die jede Politik stoßen muß, welche die Wachstumsraten der sechziger Jahre wiederherzustellen versucht. Der staatlichen Konjunkturpolitik geht genau in dem Augenblick der Atem aus, wo sie am nötigsten gewesen wäre.
Auch die Wachstumsmotoren der siebziger Jahre laufen mit geringerer Kraft: Die Automobilindustrie stößt bei steigenden Benzinpreisen an Sättigungsgrenzen; die Bautätigkeit hat sich selbst durch die Steigerung der Baupreise und vor allem der Bauplatzpreise abgebremst.
Es spricht einiges dafür, daß die Methoden zur Überwindung der ersten Ölpreiskrise direkt in die zweite geführt haben. Daher ist es nicht verwunderlich, daß die Instrumente, die damals aus dem Kasten geholt wurden, inzwischen verrostet sind. Es stimmt nicht, daß nichts mehr geht. Aber in den achtziger Jahren geht vieles nicht mehr, was in den siebziger Jahren noch zu gehen schien. Wenn man schon, wie Helmut Schmidt, etwas überspitzt die Einsicht formuliert: «In den achtziger Jahren wird nichts mehr so sein wie in den siebziger Jahren, nichts», so kann man nicht gut fortfahren: «ausgenommen die Politik der Bundesregierung.»
Mit Parteipolitik hat die Blockierung des ökonomischen Krisenmanagements nichts zu tun. Schließlich waren alle Parteien wild entschlossen, die gewohnten Wachstumsraten wiederherzustellen. Und alle Parteien haben auf immer neue Konjunkturprogramme gedrängt. Daher hat der Wahlkampf um die Staatsverschuldung die wirkliche Frage eher vernebelt. Sie lautete: War es richtig, war es realistisch, die Prozesse, die sich im Herbst 1973 nach dem Nahostkrieg anbahnten, einfach als wirtschaftliche Rezession zu verstehen und zu bekämpfen?
24
Es gab manchen Gutwilligen, der den Streit, ob wir in der ersten Hälfte der siebziger Jahre eine geschichtliche Zäsur durchlebt hätten, für reichlich theoretisch hielt. Er war es, wie sich zeigt, nicht.
Hier braucht nicht wiederholt zu werden, wie 1975 diese geschichtliche Zäsur genauer beschrieben wurde:5) als ein radikaler und elementarer Wandel im Bewußtsein zumindest vieler Menschen in Westeuropa, ein Wandel, der sich weniger aus gescheiten neuen Theorien als aus neuen Alltagserfahrungen ergab.
Lebte die Renaissance — und seit der Renaissance die europäische Geschichte — aus dem Pathos der Überwindung von Grenzen des Raumes, der Zeit, der Geschwindigkeit, des Wissens, der technischen Machbarkeit und der wirtschaftlichen Produktion, so scheint jetzt eine Epoche anzubrechen, in der wir fragen müssen, welche Grenzen der Mensch überschreiten kann, welche er aber auch hinzunehmen und zu respektieren hat, wenn er menschlich überleben will.
Zäsur, das bedeutete in der Praxis: Die Welt hat sich fundamental verändert; mit den Mitteln ökonomischen Krisenmanagements ist dem nicht beizukommen, was nun vor uns liegt.
Zäsur, das hieß: Versucht nicht die Wiederherstellung des Nichtwiederherstellbaren.
Zäsur, das hieß: Die alten Wachstumsraten werdet ihr nicht wiederbekommen, und es wäre noch nicht einmal gut, wenn ihr sie erreichen könntet.
Zäsur meinte: Nicht nur ökonomische Rahmenbedingungen wandeln sich rapide, auch das Bewußtsein der Menschen ändert sich.
Zäsur, das wollte sagen: Wir müssen alle Bereiche unserer Politik neu durchdenken, ihre Ziele ebenso wie ihre Methoden.
5) Erhard Eppler, Ende oder Wende, Stuttgart 1975
25
Leugnen der Zäsur bedeutete, wirtschaftliche Wachstumsraten von zwei oder drei Prozent als Zeichen schwacher Konjunktur mißzuverstehen und zum Anlaß immer neuer Konjunkturprogramme zu nehmen.
Leugnen der Zäsur hieß, jede Warnung in den Wind zu schlagen, was man denn tun wolle, wenn — wie sich dies für 1981 ankündigt — wirklich wieder eine Rezession zu erwarten sei, nachdem man bei guter Konjunktur Länder und Bund ohne vernünftiges Maß verschuldet hatte.
Leugnen der Zäsur: Das hieß, Wachstumsraten im Energieverbrauch vorauszusagen, die sich schon heute als völlig unrealistisch erwiesen haben.
Leugnen der Zäsur: Das bedeutete eine Verkehrspolitik, die — ausgerechnet nach der ersten Ölkrise, also 1974! — mit dem radikalen Streckenabbau der Bundesbahn beginnen wollte.
Leugnender Zäsur: Das hieß, auf Atomprogrammesetzen, die sich gegen ein verändertes Bewußtsein nicht durchsetzen ließen.
Leugnen der Zäsur führte zu dem fatalen Mißverständnis, die Ökologiebewegung sei eine vorübergehende Mode gelangweilter Mittelständler.
Leugnen der Zäsur: Das hieß, im Nord-Süd-Verhältnis durch ein trockenes Nein fast alle Forderungen der Entwicklungsländer abzuschmettern.
Nun ist es weder überraschend noch erschütternd, wenn gewohnte Methoden so lange angewandt werden, bis sie ganz offenkundig nicht mehr wirken. Nur geht es da wie bei mancher Therapie in unserer Schulmedizin: Der Patient ist nach solchen untauglichen Versuchen nicht genauso krank wie vorher, er ist in seinem Gesamtorganismus zusätzlich geschädigt.
Jetzt sind wir, für alle spürbar, an jenem toten Punkt, wo wir, wie beim Fahrrad, entweder nach vorn durchzutreten die Kraft haben oder den Freilauf zum Bremsen betätigen müssen. Entweder wir kommen über Keynes, die Globalsteuerung und das ökonomische Krisenmanagement hinaus, oder auch die Bundesrepublik dürfte auf den Weg von Milton Friedmans Monetarismus gedrängt werden, auf dem Israel, Chile und Großbritannien nicht eben glücklich geworden sind und auf dem die USA nun trotzdem ihr Glück versuchen: auf den Weg einer Industriegesellschaft, wo der Staat sich darauf beschränkt, der Wirtschaft einen maßgeschneidert knappen Geldmantel zu verpassen, seine Haushalte überall da zusammenzustreichen, wo soziale Aufgaben wahrgenommen werden — nicht natürlich bei der Rüstung —, die Konjunktur dem freien Spiel eines — nur noch in Resten existierenden — freien Marktes zu überlassen, Arbeitslosigkeit hinzunehmen.
26
Dies alles scheint den Interessen der Großindustrie auch dann noch zu entsprechen, wenn sich inzwischen herausgestellt hat, daß damit weniger Inflation bekämpft als Arbeitslosigkeit produziert wird.
Niemand soll behaupten, dieses Rezept könne sich bei uns nicht durchsetzen. Es wird überall da attraktiv, wo ökonomisches Krisenmanagement sich festfrißt und jene gereizte Ratlosigkeit, jene hoffnungslose Langeweile, jene aggressive Frustration hinterläßt, die meist einem Rechtsruck vorangeht. Niemand wird behaupten, eine solche Stimmung sei unserer Republik völlig fremd.
Wege aus der Gefahr, das wäre also der Versuch, die Wirtschaft so zu beeinflussen, daß der Prozeß, den man Wachstum nennt, weniger beschleunigt als in Richtung und Inhalt verändert wird. Es wäre der Versuch, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, ohne die Finanzen des Staates permanent zu überfordern. Dazu soll unter dem Stichwort «selektives Wachstum» im Teil IV mehr gesagt werden.
Krisenmanagement nach außen
Im Blick auf die Außenpolitik werden in der Geschichte der Bundesrepublik heute vier Phasen erkennbar: Die erste umfaßt die sechs Jahre von der Gründung der Republik bis zur Ratifizierung des Nato-Beitritts 1955. Diese Epoche war geprägt durch erbitterten, in der Sache nötigen Streit darum, ob die Bundesrepublik, ohne die Angebote eines bündnisfreien, in seinen politischen Strukturen westlichen Gesamtdeutschland ausgelotet zu haben, sich militärisch in die Nato integrieren sollte. -
Im folgenden Jahrzehnt, der zweiten Phase, fügte sich die Bundesrepublik als geachteter Partner in das europäische und atlantische System ein. Dabei wuchs das ökonomische Gewicht, während das politische gegen die Mitte der sechziger Jahre eher abnahm, weil ein starres Festhalten an zunehmend unrealistischen Rechtspositionen gegenüber der DDR und Polen von beiden Weltmächten immer offenkundiger als hinderlich empfunden wurde.
27/28
Die dritte Phase beginnt mit der Großen Koalition und reicht etwa bis zum Rücktritt Willy Brandts. In diesen Jahren wurde, erst zögernd, dann entschlossen, das Verhältnis der Bundesrepublik zu den Staaten des Warschauer Paktes geordnet, Frieden auch nach Osten geschlossen.
Die Jahre seit 1974, die vierte Phase, waren eine Zeit außenpolitischen Krisenmanagements. Die Grundsatzentscheidungen nach West und Ost waren gefallen, die Bundesrepublik galt im Westen um so mehr, je selbstverständlicher ihre Kontakte nach Osten wurden, im Osten um so mehr, je größer ihr Gewicht im westlichen Bündnis wurde. Die Zeiten des politischen Zwergs waren vorbei, ob dies der Regierung recht war oder nicht. Es wurde möglich, aber auch nötig, aktiv auf die westliche Politik einzuwirken, zumal die Führungsmacht des westlichen Bündnisses nach dem Rücktritt Nixons zu keiner kontinuierlichen, klaren und berechenbaren Politik finden konnte. Der Telefonkontakt des deutschen Bundeskanzlers zu einem unsteten und unsicheren US-Präsidenten — und nicht nur zu ihm — wurde zu einem wichtigen und heilsamen Instrument außenpolitischen Krisenmanagements. Dies erwies sich vor allem in den ersten Monaten des Jahres 1980, als europäische Einwirkung einigermaßen verhindern konnte, daß der Zorn und die Demütigung, die viele Amerikaner in Blick auf den Iran und Afghanistan empfanden, zu allzu irrationalen Reaktionen führte.
Nun mag man argumentieren, daß auch außenpolitisches Krisenmanagement auf mittlere Frist nur dann erfolgreich sein kann, wenn dadurch ein konstruktives Konzept, ein Bild angestrebter internationaler Beziehungen sichtbar wird.
Es spricht einiges dafür, daß auch unsere östlichen Nachbarn manchen kleinen — und manchen falschen — Schritt anders getan hätten, wenn sie eine längerfristige Perspektive der Zusammenarbeit vor sich gesehen hätten.
Wie immer man diese Kritik gewichtet: Wenn nicht alles täuscht, geht auch die große Zeit außenpolitischen Krisenmanagements zu Ende. Schon der Streit um die sogenannte Nachrüstung der Nato zeigte an, daß es wieder um Grundsätzliches ging: militärisch um die Frage, ob das Streben nach einem militärischen Gleichgewicht, das niemand definieren kann und über das in der Praxis nie Übereinstimmung zu erzielen ist, dazu führen muß, daß jede Seite, um aus der Position des Gleichgewichts über Abrüstung verhandeln zu können, erst einmal aufrüstet.
Politisch geht es darum, ob die beiden Supermächte wieder dazu kommen, ihre gegensätzlichen Interessen auszugleichen und ihre gemeinsamen Interessen zu erkennen. Dies ist höchst fraglich geworden.
Auch wenn Präsident Reagan und seine Berater nicht alles in praktische Politik umsetzen, was im Wahlkampf proklamiert wurde, sie werden Wege finden, jedermann hinreichend klarzumachen, wer im westlichen Bündnis die Weichen stellt. Also wird auch die Bundesrepublik vor Fragen gestellt, die nicht mehr durch Krisenmanagement zu beantworten sind: Wie soll Europa sich zu den beiden Supermächten verhalten, wenn die eine oder die andere — oder beide — die Konfrontation suchen? Sollen die Deutschen an einem Rüstungswettlauf teilnehmen, der möglicherweise mit dem Ziel geführt wird, die Sowjetunion «zu Tode zu rüsten»? In solchen Fragen helfen persönliche Kontakte wenig, zumindest können sie klare — und in jedem Fall riskante — Grundsatzentscheidungen nicht ersetzen.
Ähnlich sieht es im Nord-Süd-Verhältnis aus. In den letzten Jahren hat die Bundesregierung gegenüber den Forderungen der Entwicklungsländer hinhaltenden Widerstand geleistet, ohne zum Nord-Süd-Dialog Konstruktives beizutragen. Inzwischen nimmt die Verschuldung der Entwicklungsländer, soweit sie kein Öl produzieren, so rapide zu, daß in den achtziger Jahren Grundsatzentscheidungen fällig werden, die — hier wie dort — um so tiefer eingreifen müssen, je später sie getroffen werden. An anderer Stelle dieses Buches soll detailliert nach Handlungsmöglichkeiten im Ost-West- und im Nord-Süd-Verhältnis gefragt werden.
Hier geht es nur um die These: Nicht nur wirtschaftlich, auch wo es um Außenpolitik, Rüstung und Entwicklungsländer geht, dürften wir mit Krisenmanagement nicht über die achtziger Jahre kommen. Sonst werden auch hier die Wege in der Gefahr zu Wegen in die Gefahr.
28-29
#

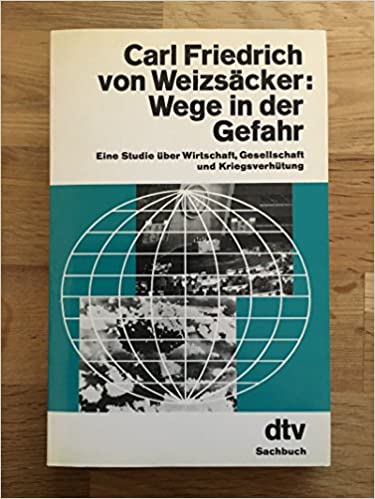
Von Dr. Erhard Eppler