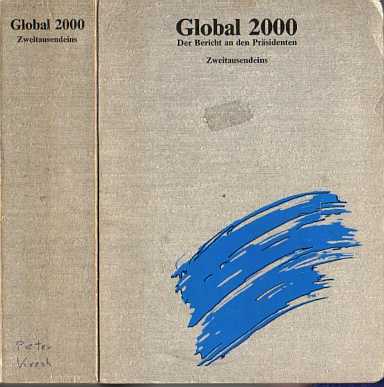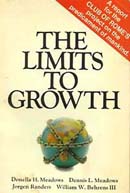Bevölkerungsbuch
Literatur
Start
Weiter
8 Unerbittliche Prognose
Löbsack-1983
Lebensraum
der ersten Menschen - Gegendruck der Umwelt - Offene und geschlossene
ökologische Systeme - Bachforellen und Hobbygärtner -
Großtiere, von Indianern ausgerottet — Unsere Erde wurde zum
geschlossenen System — Sieben Probleme — Heuschrecken —
Kernverschmelzung — 3 Tonnen Sprengstoff auf
jeden Erdenbürger — Analphabeten — Sprechblasentexte
ersetzen die Kultursprache — Die
Parlamentsabgeordneten und ihr Ökologieverständnis — Herbert Gruhl
— Mikroelektronik — Freizeit — Überwacht und kontrolliert —
Apparatewelt — Aurelio Peccei —
»Kein Gedeck am großen Gastmahl der Natur« (Malthus) — Die
Vermehrung begann, als der Mensch seßhaft wurde — Mullers Vision — Wenn
das Gemeinwohl kein Wohl mehr ist — »Ich habe Dinge gesehen, über
die ich am liebsten geweint hätte...« — Überleben um den Preis
der Menschlichkeit? — Global 2000
— »Die Zeit zum Handeln geht zu Ende«.
194-225
Faßt
man die Menschheitsgeschichte in wenigen Zeilen zusammen, dann bietet sich
etwa folgendes Bild: Zahlreichen Widrigkeiten zum Trotz gelang es unseren
ursprünglich baumbewohnenden Vorfahren, sich mit der Steppen- und
Savannen-Umwelt zu arrangieren. Da sie als Aufrechtgeher ihre Arme und Hände
nicht mehr zur Fortbewegung brauchten, konnten sie mit ihnen Nützlicheres
anfangen: Dinge hin- und hertragen, Werkzeuge und Waffen herstellen und
benutzen, der späteren Technik den Boden bereiten.
So
konnte sich der Mensch seine eigene Umwelt, eine zweite technische Welt
schaffen, die ihm nicht nur Schutz vor den Naturgefahren bot, sondern mit der
er sich schließlich auch der natürlichen Auslese fast völlig entzog.
Hilfreich ist ihm dabei vor allem die Sprache
gewesen. Sie schuf die Voraussetzungen für jene sekundäre Form der
Vererbung, die wir die »kulturelle Evolution« nennen.
Das
alles geschah freilich auf Kosten der »primären Umwelt«. Der Druck des
Menschen auf die Inventarien der Natur, auf die Rohstoffvorräte, die
Energieträger, ja praktisch auf alles nicht von ihm Geschaffene nahm zu und
hat sich bis heute unablässig gesteigert. Kein Lebewesen, soweit die
Wissenschaft es überblickt, hat sich in derart ungebärdiger Weise an anderen
Kreaturen dieses Planeten vergriffen, indem es ihre Lebensräume zerstörte,
sie bedrängte und ausrottete.
Und
dazu wächst die Zahl der Menschen seit einiger Zeit explosionsartig an.
Unvermeidlich mußten sich daraus für den Homo sapiens existentielle Probleme
ergeben: Umweltverschmutzung, Energiekrise, Hunger und Arbeitslosigkeit,
psychischer Streß, Verstädterung, Aufrüstung, politische und soziale
Spannungen, steuerloser technischer Fortschritt mit allen seinen Kehrseiten
und Gefahren.
Die
eigentlichen Ursachen dieser Notstände sind die geistigen Antriebskräfte im
menschlichen Gehirn. Merkwürdig aber ist, daß die gleichen Kräfte am Anfang
und für Millionen von Jahren alles andere als problematisch gewesen sind,
daß sie dem Menschen geholfen haben, sich seine ureigene ökologische Nische
zu schaffen, die er zum Überleben brauchte. Mit seinem Geist, der parallel
mit seinem »handwerklichen Lernprozeß« wuchs, der von den Anforderungen des
neuen Lebensraumes immer wieder Impulse zur Weiterentwicklung empfing, machte
sich der Mensch die Natur zunächst erfolgreich und durchaus maßvoll
»untertan«.
So
gelang es den Jägern und Sammlern von einst, sich über einen großen Teil
der Erde zu verbreiten und schon früh eine Bevölkerungszahl zu erreichen,
die - gemessen an der »aneignenden« Lebensweise - vielleicht schon ein
Maximum für die besiedelbaren Räume bedeutet haben mag. So jedenfalls sieht
es der deutsche Biologe Hubert Markl,
wenn er schreibt:
»Wir
wissen heute ziemlich genau, wieviel Lebensraum der Mensch auf dieser
Kulturstufe als Wirtschaftsbasis benötigt: es können so, wenn es hoch
kommt, ein bis drei Menschen pro Quadratkilometer leben, meist etwa einer
auf zwei bis zehn Quadratkilometer. Auf der Fläche der Bundesrepublik
(250.000 Quadratkilometer mit jetzt circa 60 Millionen Einwohnern) konnten
als Sammler und Jäger also etwa 10.000 bis 50.000, vielleicht aber nur
einige tausend Menschen ihr Auskommen finden. Die
altsteinzeitliche Erdbevölkerung wird dementsprechend auf eine bis zehn
Millionen Menschen geschätzt.
Die
maximale Reproduktionsrate und die Wanderungsfähigkeit des Menschen unter
Steinzeitbedingungen gestatteten es andererseits, daß alle leicht
erreichbaren Lebensräume der Erde theoretisch in sechs bis zehn, in
Anbetracht wahrscheinlicher Randbedingungen gewiß in wenigen hundert
Generationen bis an die Grenzen der Tragekapazität ausgefüllt werden
konnten. Das heißt, daß die erreichbare,
besiedelbare Erde während des Großteils der einigen Millionen Jahre des
Sammler- und Jägerdaseins des Menschen mit für diese Lebensweise maximal
möglicher Dichte besiedelt war«.[41]
wikipedia
Hubert_Markl *1938 bis 2015
195
Irgendwann
muß dann aber der »Gegendruck der Umwelt« eingesetzt haben. Das, was die
Jagd- und Sammelgründe boten, reichte jetzt nicht mehr aus. Eine neue
Herausforderung entstand, vergleichbar den einst schrumpfenden
Urwaldbeständen für die Vorläufer der Australopithecinen. Es galt, die
Nahrung für die größer werdenden, nomadisierenden Gruppen effektiver und
systematischer zu beschaffen. Dank seiner zunehmenden technischen Fähigkeiten
und Hilfsmittel, mit Grabstock, Hacke und Pflug lernte der Mensch, den Boden
zu bearbeiten. Er lernte zu säen und zu ernten und Vieh
zu halten, schließlich wurde er seßhaft.
Dieser
Wandel mag sich vor etwa zehntausend Jahren abgespielt haben, das heißt:
Setzt man das Alter unseres Geschlechts mit nur drei Millionen Jahren an, so
hat der Mensch erst einen winzigen Bruchteil seiner Zeit auf der Erde als
»bodenständiges« Wesen zugebracht. Während der weitaus längsten Periode
— fast drei Millionen Jahre also — streifte er in Wäldern, Savannen und
auf Steppen umher, jagte er und sammelte er Früchte, Beeren und Wurzeln.
Geht
man weiter davon aus, daß unser Gehirn, daß die arttypischen
Verhaltensweisen des Menschen in eben jener Frühzeit angelegt worden sind, so
wird verständlich, warum wir uns heute noch immer - auch in kleinen
Alltäglichkeiten - so benehmen, wie es den
Jägern und Sammlern von einst gemäß war.
Darüber
haben wir schon gesprochen. Wichtiger ist jetzt etwas anderes.
Um
zu verstehen, warum uns das schlechterdings nicht mehr zu ändernde, weil in
den Erbanlagen verankerte Verhalten von damals in eine Sackgasse unserer
Entwicklung geführt hat, müssen wir wissen, daß die Umwelt des
Frühmenschen ein sogenanntes »offenes ökologisches System« für ihn
gewesen ist. »Offen«, das bedeutet hier soviel wie unerschöpflich.
196
Die
damals lebenden Frühmenschen konnten mit ihrer jagenden und sammelnden
Lebensweise die noch vergleichsweise ausgedehnten Jagdgründe schwerlich
überfordern. Ihre Umwelt blieb regenerationsfähig. Weder war der frühe
Mensch fähig, so viele Tiere einer bestimmten Art zu jagen und zu töten,
daß sie ausgerottet worden wären (wenn Tiere ausstarben, so aus anderen
Gründen), noch war es ihm angesichts seiner relativ geringen
Bevölkerungszahl möglich, etwa an den Primärenergien oder den
Bodenschätzen Raubbau zu treiben, selbst wenn er sie damals schon hätte
nutzen können.
Wir
müssen hier den Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen
ökologischen System erklären.
Von
einem offenen spricht man in der Biologie dann, wenn ein Lebensraum von außen
her laufend neu mit Energie, Nahrung und anderen lebensnotwendigen Dingen
versorgt wird. Ein Beispiel dafür liefert etwa ein Gebirgsfluß. Nehmen wir
an, eine Forelle habe ihren Standplatz dort, wo sich das strömende Wasser im
Schutz eines großen Steines ruhiger bewegt. Sie braucht hier weiter nichts zu
tun als aufzupassen, was das ständig vorüberfließende Wasser ihr an neuer
Nahrung zuträgt, ohne daß sie selber allzusehr gegen die Strömung
ankämpfen muß. Der Fluß ist für sie ein offenes System, oder sagen wir
besser: Er ist ein weitgehend offenes.
Anders
ein Tümpel, der ein weitgehend geschlossenes System darstellt. Hier wirkt
praktisch nur die Sonnenstrahlung als ständig neu verfügbare Energiequelle
(und die Ausstrahlung als Gegengewicht). Die Strahlung ermöglicht zwar die
Photosynthese der Wasserpflanzen und läßt alles Grüne wachsen, solange
Wasser und Nährstoffe vorhanden sind. Sie ermöglicht es auch den
Wassertieren, sich für eine gewisse Zeit zu behaupten und zu vermehren. Doch
ist die begrenzte Wassermenge andererseits der Verdunstung ausgesetzt. Fällt
nicht genug Regen, dann »versumpft« der Tümpel und verlandet schließlich,
es sei denn, das Wasser würde regelmäßig künstlich ergänzt und die
wuchernden Pflanzen würden immer wieder dezimiert. Über dieses Dilemma
ärgert sich jeder Hobbygärtner, der vor seinem Haus einen kleinen Teich
besitzt.
197
Der
Biologe Gerolf Steiner hat
darauf hingewiesen, daß Lebewesen auf längere Sicht eigentlich nur in
offenen Systemen gedeihen können [68]. Er zitiert dazu bestimmte
physikalische Gesetzmäßigkeiten und folgert, die Ordnung im Lebendigen lasse
sich nur auf Kosten der Ordnung in der Umgebung aufrechterhalten. Ein
konkretes Beispiel: Was leben will, muß sich ernähren. Dazu muß es das
Nahrungsangebot der Umwelt beanspruchen und diese damit verändern, mit
anderen Worten, es muß die Umwelt um die entnommene Nahrung ärmer machen.
wikipedia
Gerolf_Steiner *1908 bis 2009
Dem
liegt ein wichtiges Prinzip zugrunde: Kein lebender Organismus findet sich
damit ab, daß seine Umgebung ein geschlossenes System sein könnte, also ein
vom Ressourcen-Angebot her begrenztes System. Er tut vielmehr so, als sei sie
ein offenes, aus dem er sich unbeschränkt versorgen kann.
So
wird erklärlich, warum alles Organische zunächst die Tendenz hat, sich zu
vermehren und auszubreiten, der Expansionsdrang dann aber seine Grenzen
findet, weil selbst die ökologisch scheinbar offenen Umweltsysteme letzten
Endes nicht unbegrenzt offen sind. Werden sie von allzuvielen Kostgängern
überfordert, so erschöpfen sie sich wie der Gebirgsfluß, in dem allzuviele
Forellen schwimmen. Dann wird die Individuenzahl der allzu
Vermehrungsfreudigen so weit reduziert, wie es die vorhandenen
Existenzbedingungen zulassen. Das heißt: Die überzählig Geborenen müssen
sterben.
Was
uns Menschen betrifft, so haben unsere Vorfahren als Jäger und Sammler
ebenfalls noch ein offenes ökologisches System vorgefunden. Die Erde mit
ihren Ressourcen schien zunächst unerschöpflich. Nahrungsquellen gab es
praktisch unbegrenzt. So konnten die Frühmenschen überleben und ihre
Bedürfnisse befriedigen, ohne daß ihre Umwelt darunter gelitten hätte.
Weder überjagte man die Beutetiere, noch trieb man damals — im Gegensatz zu
heute — Raubbau an den Bodenschätzen. Man ruinierte auch den Erdboden noch
nicht durch Kahlschläge oder intensive Weide- und Landwirtschaft.
198
Diese
umweltschonende Lebensweise war jedoch nur solange zu praktizieren, wie sich
die Menschenzahl einigermaßen in Grenzen hielt. Als die Erdbevölkerung mit
dem Seßhaftwerden merklich zuzunehmen begann, verlor
sich auch der nur bei Nomadenvölkern und zurückgezogen, ärmlich lebenden
Eingeborenenstämmen noch anzutreffende Sinn für das Kleinhalten der
Sippen. Ackerbau und Viehzucht konnten schließlich mehr Menschen je
Quadratkilometer ernähren als Jagen und Sammeln. Der dem Menschen
innewohnende Trieb nach »immer mehr« und »immer weiter« bekam also neuen
Spielraum.
Doch
auch in den Siedlungen und auf seinen keineswegs aufgegebenen Jagdzügen
verhielt sich der Mensch so, als bliebe die Welt, in der er lebte, ein für
allemal ein offenes ökologisches System. So geschah es, daß er seine
Beutetiere zeitweise stark dezimierte und bestimmte Arten auch schon früh
ausrottete, wie etwa die aus dem Pleistozän
überkommenen Großtiere, die den nordamerikanischen Indianern zum Opfer
fielen.
Da
es mit dem bloßen Sammeln von Früchten, Beeren, Pilzen und anderem Eßbaren
bald nicht mehr getan war, versuchten die Seßhaften, geeignete Pflanzen
systematisch anzubauen. Der Ackerbau kam auf. Und dort, wo der Boden zu wenig
hergab, da reagierte der Mensch auch nicht etwa mit Geburtenbeschränkung,
sondern ließ den ausgebeuteten Landstrich zurück und zog weiter in andere
noch jungfräuliche Gebiete, um sein Glück erneut zu versuchen.
Inzwischen
sehen wir Menschen uns in einer Lage, in der es nicht nur keine
jungfräulichen Jagd- und Weidegründe mehr gibt, sondern die natürlichen
Ressourcen zur Neige gehen und abzusehen ist, wann die Erträge der
Landwirtschaft selbst bei massiver künstlicher Düngung und
Schädlingsbekämpfung nicht mehr ausreichen werden, die wachsende
Erdbevölkerung zu ernähren.
199
Schon
heute hält die Welt-Nahrungsmittelproduktion mit den zunehmenden
Menschenzahlen nicht mehr Schritt. Aus den paar Millionen Menschen, die in der
Altsteinzeit gelebt haben mögen, sind inzwischen fast fünf Milliarden
geworden, eine gespenstische und zudem rasch weiterwachsende Zahl, die längst
hoch über jener liegt, die der Planet Erde problemlos ernähren und auf die
Dauer menschenwürdig behausen könnte.
Die
Erde ist, wie Gerolf Steiner richtig erkennt, für uns Menschen von einem
zunächst weitgehend offenen zu einem geschlossenen ökologischen
Umweltsystem geworden, dem letztlich nur die Sonneneinstrahlung noch
dauernde Energie zuführt. Dessen ungeachtet treibt uns unser Gehirn ständig
zu einem Verhalten an, als habe diese Veränderung nicht stattgefunden. Es tut
so, als lebten wir noch in dem quasi offenen System von einst.
Und
diesem Trugschluß erliegen sogar Leute, die es eigentlich besser wissen
sollten.
Man erinnere sich nur an die Beschwichtigungen des
Wirtschaftsexperten
Fritz
Baade, die Erde könne bis zu 65 Milliarden Menschen und mehr (!)
ernähren, was dann allerdings einer Besiedlungsdichte des heutigen
Groß-New-York auf den besiedelbaren Erdgebieten entspräche.[1]
wikipedia
Fritz_Baade *1893 in Neuruppin bis 1974 DNB.Autor
Auch
Baades Kollege Meier von der
Universität Michigan schätzte, daß die Erde rund 50 Milliarden Menschen
satt machen könne, und der britische Nationalökonom
Clark
kam immerhin auf 28 Milliarden, die »mehr als ausreichend« ernährt werden
könnten, wenn in der ganzen Welt nur die landwirtschaftlichen Methoden
Hollands praktiziert würden.
Mit
derart wirklichkeitsfernen Milchmädchenrechnungen wird die Menschenvermehrung
nur noch gefördert, indem sich etwa die Kirche darauf berufen kann, um
ihr Verbot empfängnisverhütender Mittel zu rechtfertigen, tatsächlich
aber im Namen dessen, den sie den Schöpfer des Lebens nennt, den Untergang
jenes Wesens vorbereitet, das sie als »sein Ebenbild« ausgibt.
200/201
Faßt
man zusammen, so sind es im wesentlichen sieben große Probleme, die
uns mit dem »Aus« bedrohen, von denen aber auch jedes einzelne für sich den
Untergang der Menschheit herbeiführen könnte:
Erstens
die Bevölkerungsexplosion.
Sie
hält an, ohne daß ein weltumspannendes Konzept zur Geburtenkontrolle
gefunden, geschweige denn angewendet worden wäre.
Als
Folge davon hungert ein wachsender Teil der Erdbevölkerung oder ist
unterernährt. Pferchungsnotstände in den Ballungsgebieten lassen die
Kriminalität, die menschliche Entfremdung, Drogensucht und Terrorismus
ansteigen. Die ungleichen Vermehrungsraten (stürmisches Wachstum dort, wo vor
allem hilfebedürftige Menschen leben, und stagnierendes in den Ländern mit
vorwiegend produktiver Bevölkerung) verlangten nach einer wirksamen
Geburtenkontrolle vor allem in den Entwicklungsländern.
Also
Bremsen hier und allenfalls Ermunterung dort, doch
würden Pläne für solche »selektiven Eingriffe in die Menschenrechte« auf
heftigsten Widerstand stoßen — man vergegenwärtige sich nur die
Zusammensetzung der UNO.
Auch
ließe sich die Springflut menschlichen Lebens in den Problemgebieten schon
deshalb kaum künstlich aufhalten, weil dort das Analphabetentum wächst
und
die Einsichtsfähigkeit breiter Kreise immer geringer wird.
Illusionär
schließlich ist es anzunehmen, daß importierter Wohlstand in jenen Ländern
noch rechtzeitig zur Geburtenbeschränkung beitragen könnte.
Immer
wieder hört man die Legende, wenn es den Menschen dort erst einmal besser
gehe, hätten sie auch weniger Kinder.
Das
verkünden Bevölkerungsfachleute, als gebe es den Zeitfaktor nicht.
Schon in den Industrieländern hat dieser Prozeß aber mindestens zwei
Jahrhunderte gebraucht, um Wirkung zu zeigen. Mit Sicherheit würde sich der
gewünschte Erfolg selbst dann viel zu spät einstellen, wenn der
Wohlstandsexport den schnellwachsenden Bevölkerungen einen höheren
Lebensstandard bescherte.
Viel
wahrscheinlicher ist, daß solche einseitige Entwicklungshilfe über viele
Jahre das Gegenteil bewirkt und die Nutznießer erst einmal noch
geburtenfreudiger macht, wie es übrigens ein Vergleich der
Bruttosozialprodukte mit den Wachstumsraten einiger »neureicher« Länder
auch bestätigt (siehe Seite 32).
201
Nun
ist der Mensch mit seinem Expansionsdrang allerdings kein Sonderfall unter den
Lebewesen. Sehen wir uns im Tierreich um, so verhalten sich beispielsweise
Lemminge oder Heuschrecken ähnlich vermehrungsfreudig, nur verringern sie
periodisch ihre Gesamtzahl und passen sich so den Gegebenheiten, sprich den
überweideten Lebensräumen, wieder an.
Ein
solches »Gesundschrumpfen« ist dem Menschen jedoch aus mancherlei Gründen
verwehrt. Einen Instinkt dafür hat er nicht. Auch wäre
ein verordnetes Massensterben unmenschlich. Also müßte er mit Hilfe
seiner Vernunft dafür sorgen, daß es gar nicht erst zu überzähligen
Geburten kommt.
Offenbar
bereitet ihm aber auch dies die größten Probleme, wie die kümmerlichen
Erfolge einer Geburtenkontrolle in den Ländern der Dritten Welt zeigen. Alles
sieht vielmehr danach aus, als würde die Krise, in der er heute an der Grenze
seiner biologischen Verbreitungs- und Vermehrungsfähigkeit steckt, durch
Kräfte außerhalb seiner Einflußmöglichkeiten reguliert werden. Dies werden
indes sehr brutale und wirkungsvolle Kräfte sein, die gewaltsam das ersetzen
werden, was die Heuschrecken und Lemminge dem Menschen an Instinktverhalten
voraushaben.
Und
in dem bevorstehenden Drama wird ihm dann nicht einmal die Genugtuung bleiben,
seinen humanen Tugenden bis ans Ende seiner Tage treu geblieben zu sein.
Das
zweite große Problem ist die Zerstörung der Natur,
vor allem durch
maßlose Bau- und sogenannte Kultivierungsmaßnahmen. Mit ihnen vernichtet
der Mensch die Lebensgrundlagen zahlreicher anderer, für ein
funktionierendes Ökosystem wichtiger Tier- und Pflanzenarten. Die Umwelt
verarmt. Sie verliert zugleich auch an ästhetischem
Reiz. Die Vielfalt »schöner« natürlicher Erscheinungsformen
schwindet dahin und weicht zunehmend technischen Konstruktionen.
Keine
Art vor dem Menschen, findet der Kieler Zoologe Berndt
Heydemann, habe eine solche Dimension des Katastrophenumfangs
gegen die übrigen Arten, nämlich fast alle, bewirkt. In der Geschichte des
Lebens habe es noch nie eine Art gegeben, die gleichzeitig in fast alle
Ökosysteme an Land, im Süßwasser und im Meer hineingewirkt habe und nicht
nur einzelne Arten konkurrierend oder konsumierend ausschalten könne, sondern
auch noch ganze Ökosysteme von Grund auf ändere.
»Der
Mensch«, fährt Heydemann fort,
»verwandelte
die feuchten Laubwald-Ökosysteme mit ihren jeweils 5000 bis 8000 Arten
durch Rodung in die heute intensiv genutzten Acker-Ökosysteme mit nur noch
500 Arten und weniger. Diese bedecken mehr als die Hälfte der Fläche
Mitteleuropas. 50 Prozent der einst hier lebenden
Arten sind erst in den letzten hundert Jahren verschwunden. Im
Zeitmaßstab der Evolution gesprochen, wäre dies das mindestens
tausendfache Tempo des Niederganges im Verhältnis zur Entstehung neuer
Arten, wenn man für eine Art eine Existenzdauer von drei bis zehn Millionen
Jahren annimmt«.[28]
Drittens
die Umweltverschmutzung.
Mit
Wirtschaft und Industrie kommen zwar immer mehr Waren und Maschinen unter die
Menschen. Hilfsgüter und Technologien sorgen für ein immer komfortableres
Leben, doch hat dies alles auch seinen Preis: Gasförmige, flüssige und
feste, teils giftige Abfallstoffe aus den Produktionsprozessen belasten die
Umwelt. Als besonders problematisch erweist sich dabei in letzter Zeit der
radioaktive Abfall. Für seine ungefährliche Lagerung war Anfang der
achtziger Jahre noch immer keine sichere Lösung absehbar, dennoch werden in
aller Welt fortgesetzt neue Kernkraftwerke gebaut.
Sollte
es in absehbarer Zeit gelingen, Energie in großen, fast unbeschränkten
Mengen statt aus der Atomkernspaltung aus der Kernverschmelzung zu gewinnen
(ähnlich wie es auf der Sonne geschieht), so würde zwar die Strahlengefahr
verringert, andererseits aber nicht nur die weltweite Industrialisierung und
der Druck auf die verbliebenen Rohstoffvorräte zunehmen, sondern auch die
allgemeine Umweltbelastung würde neuen Auftrieb bekommen.
202-203
Viertens
der Rüstungswettlauf.
Die
Zahlen sind gespenstisch. Anfang der achtziger Jahre gab es zusammengerechnet
etwa 40.000 bis 50.000 Atomwaffen verschiedenen Kalibers auf der Erde mit
einer Sprengkraft von insgesamt mehr als einer Million mal derjenigen der
Hiroshima-Bombe. Das bedeutete ein Vernichtungspotential
von rund drei Tonnen herkömmlichen Sprengstoffs Trinitrotoluol (TNT) pro Kopf
der Erdbevölkerung.
Inzwischen
steigern die Staaten ihre Rüstungsetats von Jahr zu Jahr. Gerade jetzt
eskalieren sie wieder, nachdem die Sowjetunion die Zeit der sogenannten
»Entspannungspolitik« dazu genutzt hatte, ihr Waffenarsenal aufzustocken
und der Westen sich genötigt sieht, den Vorsprung auszugleichen. Nach einer
Schätzung fließen rund um die Erde derzeit etwa eine Million Dollar je
Stunde (!) in die Waffenproduktion.
Ein
Ende der Bedrohung ist nicht in Sicht, im Gegenteil, sie wächst.
Denn
mit der Verbreitung des know-how zur Herstellung von Atomwaffen erhöht sich
auch das Risiko, daß durch Unachtsamkeit oder im Affekt, ja sogar durch
Zufall ein alles vernichtender Atomkrieg ausgelöst wird.
Fünftens
die Zunahme des Analphabetentums in weiten Teilen der Erde.
Während
in den Industriegesellschaften der materielle Wohlstand weiterbesteht,
verarmen die Menschen in der Dritten Welt nicht nur, sondern es breiten sich
dort auch Unwissenheit und Unmündigkeit aus. Insgesamt sollen derzeit etwa 28
Prozent der Erdbevölkerung Analphabeten sein, mindestens also jeder vierte
Erdenbürger sei unfähig für die einfachsten Formen schriftlicher
Kommunikation und des Umgangs mit geschriebenen oder gedruckten Zahlen. In
Indien rechnen Beobachter mit einem Heer von 500 Millionen Analphabeten im
Jahre 2000.
Selbst
in Europa mehren sich die Erwachsenen, die weder richtig lesen, schreiben noch
rechnen können, also auch unzugänglich für gedruckte
Informationen sind.
Wer wollte von ihnen verantwortungsvolles Verhalten
in einer Gesellschaft erwarten, deren Weiterexistenz auch zunehmend vom
Informationsstand ihrer Mitglieder abhängt?
Allein
in der Bundesrepublik Deutschland sollen — nach Angaben von John
Blaschette vom Europäischen Jugendforum —
zur
Zeit etwa 800.000 Männer und Frauen mit dem Bildungsstand eines neunjährigen
Kindes leben.
204
Hier
kommt ein weiterer beunruhigender Tatbestand hinzu.
Es
wird zunehmend beobachtet, daß unsere Schüler immer weniger selbst
formulieren, sondern statt dessen häufig in Schlagworten und aufgeschnappten,
oft unzutreffenden Klischees reden. Zumal um das sprachliche
Ausdrucksvermögen jener stehe es schlecht, beklagte der Hessische
Philologenverband, die von den Grundschulen oder Förderstufen ins Gymnasium
überwechseln. Das liege wahrscheinlich daran, daß in den ersten Schuljahren
zu wenig darauf geachtet werde, sich in der deutschen Sprache korrekt und
angemessen auszudrücken.
Eine
besondere Unsitte sei es, die Schüler die Ergebnisse von Testaufgaben nicht
mehr in Worten ausdrücken, sondern bereits vorgeschlagene Lösungen nur noch
ankreuzen zu lassen (multiple-choice-Verfahren). Das Kreuz sei früher die
Unterschrift der Analphabeten gewesen, rügte der Verbandsvorsitzende Jacobi,
jetzt komme es an manchen Schulen wieder in Gebrauch.
Jacobi
verwies auch auf den Hintergrund dieser Entwicklung. Er gibt die Schuld daran
einer an den Hochschulen verbreiteten Theorie, wonach die Kinder aus den
unteren sozialen Schichten durch eine allzu strenge Bewertung der
Ausdrucksfähigkeit benachteiligt würden. Es sei aber eine falsche
Konsequenz, deswegen die »Sprachlehre« zu vernachlässigen, um so eine
vermeintliche Chancengleichheit herzustellen. Denn letztlich würden dann alle
Kinder geschädigt, indem man sie nicht auf die später auf sie zukommenden
Anforderungen vorbereite. So setze beispielsweise die Teilnahme an
demokratischen Entscheidungsprozessen gewisse sprachliche Fähigkeiten
voraus, fügte Jacobi hinzu. Schreib-
und Sprachverödung also als Vorstufe zum Analphabetentum.
205
Sechstens
die fragwürdige Zusammensetzung der Parlamente.
Honoriges
Bemühen der Abgeordneten in ihren Arbeitsbereichen sei unbestritten, doch
qualifizieren sie sich eben vorwiegend aufgrund ihrer rhetorischen Talente.
Außerdem kommen sie weitgehend aus der Wirtschaft, dem Beamtenstand, dem
juristischen und politischen Bereich, so daß ihnen ökologische
Zusammenhänge oft nur ungenügend bekannt sind. Darüber
hinaus — erzwungen durch die Verfassungen — denken und handeln die
meisten auch noch allzu kurzsichtig mit dem Blick auf die Legislaturperioden.
Ein
Beispiel für diesen Mißstand lieferte Ende der siebziger Jahre der Fall des
deutschen CDU-Abgeordneten Herbert
Gruhl. Weitsichtig und verantwortungsbewußt nannte er die
sich zuspitzenden ökologischen Weltprobleme beim Namen [25]. Er rief zur
Besinnung und Umkehr auf, doch weder in seiner Partei noch sonst im deutschen
Bundestag fand er viel Verständnis dafür. Politisch an den Rand gedrängt
und mundtot gemacht, resignierte er schließlich und kehrte der CDU den
Rücken, um sich seither für eine neugegründete »Ökologisch-demokratische
Partei« (ÖDP) zu engagieren.
detopia-2021:
Zwischen CDU und ÖDP hat Gruhl die Grüne Partei mit-erschaffen.
Siebentens
muß der technische Fortschritt im Bereich der Miniaturisierung und
Mikroelektronik genannt werden.
Hier
haben wir es mit einer besonders heimtückischen
Gefahr zu tun, weil sie vergleichsweise im Gewand des Menschheitsbeglückers
auftritt. Immer
kleiner und leistungsfähiger konstruierte elektronische Schaltelemente
übernehmen heute Funktionen, für die einst umfangreiche Apparate notwendig
waren oder anstrengende Denkarbeit geleistet werden mußte.
Sinnvoll
zusammengesetzt, besorgen die elektronischen Zwerge diese Arbeiten sicherer
und schneller, und sie tun es obendrein nahezu verschleiß- und wartungsfrei.
Meist sind sie in Geräte zur Lösung mathematischer oder
angewandt-mathematischer Probleme integriert. Sie begegnen uns in vielerlei
Gestalt, so als Taschenrechner, als Bestandteile von Raketensteuersystemen,
als Navigationshilfen oder als Computer für die verschiedensten Zwecke. Und
sie erobern rasch neue Anwendungsgebiete.
206
Der
Vormarsch der Mikroelektronik bedeutet für den Menschen zunächst einmal
Positives. Denn die rechnenden und schaltenden Winzlinge entlasten das
menschliche Gehirn von Routineaufgaben, außerdem erweitern sie seine
Möglichkeiten im Rahmen des logischen Denkens. Es wird mit ihrer Hilfe also
gewissermaßen mehr Zeit verfügbar für geistige Prozesse höherer Ordnung,
wenn man so sagen will: für künstlerische Betätigung, für schöpferisches
Tun aller Art, aber natürlich auch für Muße und Nichtstun.
Es wird Zeit gewonnen für den Feierabendspaß mit den ungezählten Angeboten
der Freizeit-Industrie, von der Reise bis zum ausgefallensten Hobby.
Das
kann man für erfreulich halten. Es hat aber auch Schattenseiten — zumindest
für solche Zeitgenossen, denen die Freizeit zum Danaergeschenk wird, weil sie
sie nicht sinnvoll ausfüllen können. »Da wir biologische Wesen sind, ist
das Bedürfnis, etwas zu leisten, ein angeborener Teil unseres Gehirns«,
schrieb der Streßforscher Hans Selye.
»Wir sind so beschaffen, daß wir etwas tun müssen; wenn wir nichts
Konstruktives leisten, verfallen wir auf destruktive Handlungen als
Kompensation für unsere Energie«.[64]
Noch
zwei weitere Konsequenzen hat die um sich greifende Mikroelektronik, die der
Menschheit alles andere als willkommen sein können.
Die
eine ist, daß mit der zunehmenden Gehirn-Entlastung
viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Es gibt Berechnungen darüber,
wie viele Arbeitsprozesse künftig in der Industrie, in den Verwaltungen, im
Versandhandel, bei den Behörden und selbst im privaten Bereich von den
mikroelektronischen Heinzelmännchen, sprich Computern, Mikroprozessoren
oder »Chips«, übernommen werden können. Bis zum Jahre 1990, so
befürchtet der Deutsche Gewerkschaftsbund, werde dies für 2,4 Millionen
Angestellte den Verlust des Arbeitsplatzes bedeuten.
Ob
die Betroffenen neue Arbeit finden, hängt davon ab, inwieweit die
mikroelektronische Revolution neue Arbeitsplätze schafft, ähnlich wie der
Autoboom oder der Bedarf an Wohnraum und Haushaltsgeräten in den fünfziger
bis siebziger Jahren, oder ob die hier anfallenden Arbeitsplätze doch gleich
wieder von denselben mikroelektronischen Elementen wegrationalisiert werden,
weil diese sich nach dem Verfahren »Schneller Brüter« quasi selbst
herstellen können.
207
Festzustehen
scheint, daß zumindest ein großer Teil der jetzt oder demnächst Betroffenen
keine Arbeit wieder finden wird, sich das Heer der Arbeitslosen also in jedem
Fall als unerwünschtes Nebenprodukt des mikroelektronischen Siegeszuges eher
vergrößern als verkleinern dürfte. Soziale Unruhen, zunehmende
Kriminalität mit der wachsenden Freizeit und Drogensucht aus Verbitterung
über ein »sinnlos« gewordenes Leben dürften den Menschen damit weiter
heimsuchen, nachdem ihm die Fließbandarbeit im weitesten Sinn ohnehin schon
lange die Freude am selbstgeschaffenen Ganzen verwehrt.
Die
zweite Folge der mikroelektronischen Welle werden wir in einer wachsenden
Kontrollier- und Überwachbarkeit des Menschen erleben. Schon im Jahre 1972
begann das Bundeskriminalamt in Wiesbaden, ein zentrales Informations- und
Auskunftssystem einzurichten, das mittlerweile zum fortschrittlichsten auf der
ganzen Welt entwickelt worden ist. Es beantwortet zur Zeit beispielsweise
Anfragen von nicht weniger als 2300 Datenstationen in der Bundesrepublik
innerhalb weniger Sekunden — darunter die von Polizeidienststellen,
Grenzkontrollpunkten, Flughäfen und des Bundesgrenzschutzes.
Ohne
daß wir es so recht bemerkt haben, sind wir dank der Mikroelektronik alle
schon mehr oder weniger von Datenspeichern »erfaßt«. Das heißt, wir sind
zumindest schon eines Teils unserer Intimsphäre beraubt worden.
Rentenversicherungen, Banken, Versandhäuser, Krankenkassen, Krankenhäuser
und Versicherungen — sie alle unterhalten elektronisch gespeicherte Karteien
und Datensammlungen, die gar nicht so gut abgesichert
sein können, daß jeder Mißbrauch ausgeschlossen wäre.
208
In
ihrem Buch <Der programmierte Kopf> [6] verweisen die Autoren Brödner,
Krüger und Senf auf eine solche Möglichkeit: »Wer von einem
Versandhändler fälschlicherweise als säumiger Zahler an die
Schutzvereinigung für das Kreditgewerbe gemeldet wird, gerät bei allen
Banken in Mißkredit, die bei dieser zentralen Datenbank anfragen.«
dnb
broedner+programmierte+kopf Eine Sozialgeschichte der
Datenverarbeitung
Ein
anderes Beispiel:
Eine
früher einmal eingespeicherte, inzwischen jedoch auskurierte Krankheit eines
Stellenbewerbers kommt dem Arbeitgeber zu Ohren, weil versäumt worden ist,
das betreffende Codezeichen zu löschen, oder, schlimmer noch, weil es bewußt
nicht gelöscht worden ist. So kann der Bewerber —
ohne Angabe von Gründen, versteht sich — abgelehnt werden, ohne daß er den
Vorgang durchschaut.
Was
schon in George Orwells Buch 1984
anklang, beginnt anscheinend Schritt für Schritt wahr zu werden —
mit Folgen auch für die Psyche des Menschen. Was die
Mikroelektronik da indirekt anrichtet, kann man einen schleichenden
Abbau der Individualität nennen: etwas, das uns scheibchenweise jener
Merkmale beraubt, die das eigentlich Menschliche am Menschen ausmachen.
Duckmäusertum,
Angst vor dem Risiko, Depressionen, Kuschen vor der Obrigkeit, Verlust an
Unternehmungsgeist und abflauende Entscheidungsfreude — solche und ähnliche
Konsequenzen sind zu erwarten, wenn die kleinen technischen Hilfen weiter
vordringen. Dann kann es dahin kommen, daß die Opfer nicht nur für den sozialen
Abfallhaufen reifgemacht, sondern mehr und mehr
Menschen auch zu bloßen Handlangern ihrer elektronisch gesteuerten
Apparatewelt degradiert werden.
Die
Mikroelektronik also als Großhirnprodukt, das zwar vordergründig segensreich
erscheint, das zahlreiche neue Möglichkeiten eröffnet, das den Menschen aber
auch daran hindert, sich selbst zu verwirklichen, indem
es ihn vollends zum Rädchen eines riesigen Getriebes macht: eines Getriebes,
das er immer weniger durchschaut und dem er immer weniger entrinnen kann.
209
So
könnte man weitere »Notstände« des Homosapiens an der Schwelle des
einundzwanzigsten Jahrhunderts aufzählen.
Man
könnte den schwelenden sogenannten Nord-Süd-Konflikt zwischen den reichen
Industrienationen und den ärmeren Ländern nennen, die
Weltwirtschaftskrise, den steuerlosen wissenschaftlichen Fortschritt, der
damit gerechtfertigt wird, die Forschung sei a priori »wertfrei«, die
schwindenden Möglichkeiten zur persönlichen Lebensgestaltung angesichts der
ständig und rasch sich verändernden Berufschancen, den immer schärferen
Wettbewerb zwischen den Industrienationen und die sich wandelnden moralischen
und ethischen Wertmaßstäbe.
Vor
allen diesen Entwicklungen wird seit langem eindringlich gewarnt, ohne daß
sich etwas geändert hätte oder viel ändern würde.
Der
Präsident des <Club of Rome>*, der Italiener Aurelio
Peccei, beklagte im Jahre 1981, seit Gründung des Clubs im Jahre 1968
sei kein einziges der großen Weltprobleme ernsthaft in Angriff genommen,
geschweige denn gelöst worden.[52]
Schon jedes einzelne dieser
Probleme für sich könne aber die Menschheit in die
Knie zwingen.
Besonders
bedenklich sei, daß die negativen Faktoren sich gegenseitig
beeinflußten, verstärkten und damit zu einer ausweglosen Situation
führten. »Die Menschheit«, erklärte Peccei auf dem Weltkongreß der
Sparkassen 1981 in Berlin, »befindet sich in einer rasch sich zuspitzenden
Krise, die ihre Existenz bedroht. Und dies zu einem Zeitpunkt, da sie einen
Höchststand an Wissen und Macht erreicht hat.«
Auch
Peccei sieht in der
Bevölkerungsexplosion den derzeit gefährlichsten Vorgang. Er hält sie
sowohl für einen Multiplikator aller bestehenden Probleme, als auch
für die Ursache von neuen.
Wenn
das nicht erkannt werde, schreibt er, dann werde die Lage nur noch schlimmer.
Ein
Wort, das sich insbesondere die katholische Kirche hinter die Ohren schreiben
müßte.
* Der Klub von Rom
ist eine Vereinigung von etwa 70 Persönlichkeiten aus 25 Staaten mit der
Aufgabe, die Ursachen und inneren Zusammenhänge der sich immer stärker
abzeichnenden kritischen Menschheitsprobleme zu ergründen und
Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Club
of Rome bei detopia
210
»Erkannt«
hatte die Gefahr freilich schon im Jahre 1798 der englische
Wirtschaftsfachmann Thomas
Robert Malthus, als er in seinem Essay »On the Principle of
Population« eine ebenso einfache wie furchtbare Wahrheit beschwor, die sich
in drei Sätzen zusammenfassen läßt:
»Erstens:
Die Bevölkerung neigt ständig dazu, sich stärker zu vermehren, als es den
verfügbaren Unterhaltsmitteln angemessen wäre — wenn sie nicht daran
gehindert wird.
Zweitens: Die Bevölkerungszahl wird durch die vorhandenen Nahrungs- und
Unterhaltsmittel begrenzt.
Drittens: Den Ausgleich zwischen Bevölkerungszunahme und
Nahrungsmittelproduktion besorgen natürliche Regulative wie Krankheiten,
Not, hohe Sterblichkeitsziffern, Seuchen und Kriege.«
Mit
sozialen Maßnahmen, schrieb Malthus in einer Streitschrift gegen die ersten
englischen Sozialfürsorgevorhaben, werde zur Linderung der Not wenig
ausgerichtet. Im Gegenteil, die bevölkerungspolitische Lage verschlimmere
sich nur noch mehr, denn Not und Elend gingen nicht auf soziales Unrecht
zurück, sondern seien naturgesetzlich bedingt. Malthus kam zu der
erbarmungslosen Konsequenz: »Ein Mensch, der in einem bereits
übervölkerten Land geboren wird, ist überflüssig in der Gesellschaft. Es
gibt für ihn kein Gedeck an dem großen Gastmahl der Natur.«
Allen
Anfeindungen und Verunglimpfungen des Engländers zum Trotz hat sich
inzwischen bestätigt, was ihm — der ursprünglich Pfarrer gewesen war —
vor fast zwei Jahrhunderten wie Schuppen von den Augen fiel.
Aber
zu viel und zu eingehend ist über seine Thesen schon geschrieben und
diskutiert worden, als daß wir sie hier nochmals ausbreiten müßten.
Zwei
Fragen sollten allerdings näher untersucht werden, nämlich, wo und wann die
Bevölkerungsexplosion begonnen hat und welche Folgen es für
die Menschen haben kann, wenn durch den einsetzenden Pferchungsdruck
die sozialen Gefüge zusammenbrechen.
211
Daran,
daß sich die Weltbevölkerung heute so stürmisch vermehrt, ist vor allem die
Medizin »schuld« — wenn man die Schuldfrage hier überhaupt stellen kann.
Dank medizinischer Fortschritte erhöhte sich das durchschnittliche
Lebensalter und verringerte sich die Säuglingssterblichkeit. Dabei muß man
bedenken, daß gerade in der Dritten Welt die Segnungen der Medizin vielfach
noch ausstehen — hier ist der medizinisch verursachte Bevölkerungsschub
also erst noch zu erwarten. In jedem Fall geht das übermäßige
Bevölkerungswachstum auf Erkenntnisse des Großhirns zurück — auf
gepriesene Geistestaten, die zwar dem Individuum zugute kommen, aber aufs
Ganze der Menschheit und langfristig gesehen, sich negativ auswirken.
Wie
war es früher?
Zu
der Zeit, als die ersten Aufrechtgeher lebten, dürfte ihre
Vermehrungsrate jährlich nur etwa 0,001 Promille der Gesamtbevölkerung
betragen haben (das wären bei einer angenommenen Zehn-Millionenbevölkerung
jährlich nur etwa zehn Menschen mehr!) Lange Zeit so gut wie gar nicht, und
dann auch nur ganz allmählich, stieg aber die Vermehrungsrate an. Warum blieb
die Kopfzahl der Menschen nicht konstant? Oder besser gefragt: Warum
vermehrten sich die Menschen nicht nur bis zu einem Stand, der ein Leben im
Einklang mit den Umweltgegebenheiten ermöglichte?
Eine
interessante Überlegung dazu führt wieder auf das Denkorgan im
Menschenschädel zurück. Denn das Großhirn lieferte das geistige Rüstzeug
für jene Wende in der Lebensweise, die aus den einstigen Jägern und Sammlern
schließlich seßhafte Bauern und Viehzüchter werden ließ. Bestimmte
Spekulationen beziehen sich nämlich auf eben diese Umstellung. So heißt es,
erst mit der »seßhaften«, also trägeren Lebensweise habe sich der Mensch
stärker zu vermehren begonnen.[53] Das fand sich sogar noch in letzter Zeit
bestätigt bei kleinen, zurückgezogen lebenden Nomadenstämmen, die aus
verschiedenen Gründen das Umherziehen aufgegeben haben und seither
ortsgebunden wohnen.
212
Beispielhaft
dafür ist die Eskimosiedlung Anaktuvuk im zentralen Alaska. Sie präsentiert
sich heute als ein registrierter Ort mit Postleitzahl, Flugzeug-Landepiste,
Grundschule und Postamt. Bis zum Jahre 1950 gab es hier praktisch nur Eskimos,
die als Jäger den Rentieren nachstellten. Demoskopische Erhebungen durch
Wissenschaftler der Universität von Neu Mexiko zeigten, daß sich die
Geburtenrate in Anaktuvuk zwischen 1950 und 1964 fast verdoppelte und die
Einwohnerzahl (ohne Zuzüge von außen) von 76 auf 128 Personen anstieg.
Ähnliches
gilt für eine Gruppe australischer Ureinwohner im nördlichen Teil des
Kontinents. Hier bekamen die Frauen zwischen den Jahren 1910 und 1940
durchschnittlich nur alle viereinhalb Jahre ein Kind. Dann aber, als die bis
dahin umherstreifenden Jäger und Sammler nahe einer Missionsstation (!) feste
Wohnsitze bezogen und dort offenbar auch zum christlichen Glauben angehalten
wurden, verringerte sich die Zeit zwischen den Geburten auf durchschnittlich
3,3 Jahre. Bis zum Jahre 1960 hatte sich die Bevölkerung hier bereits um mehr
als zehn Prozent vermehrt.
Ein
drittes Beispiel lieferten Buschmänner-Siedlungen in der südafrikanischen
Kalahariwüste. Solange die Frauen hier mit den Männern Jäger- und
Sammlergemeinschaften bildeten, brachten sie etwa alle drei Jahre ein Baby
zur Welt. Nachdem inzwischen immer mehr Frauen in festen Siedlungen wohnen,
liegen zwischen den Geburten nur noch durchschnittlich zweieinhalb Jahre.
Woran
mag das liegen?
Einige
Wissenschaftler vermuten, daß seßhafte Frauen ihre Kinder weniger lange
stillen und sie daher rascher wieder empfängnisfähig werden. Auch mögen
bei ihnen weniger Fehlgeburten vorkommen.
Eine
andere Ursache wäre bei den Männern zu suchen. Da sie jetzt längere Zeit in
der häuslichen Gemeinschaft verbringen, aber noch nicht durch äußere
Zerstreuungen wie etwa das Fernsehen abgelenkt werden, bietet ihnen die Liebe
einen um so begehrteren Zeitvertreib, als ihre Kräfte auch noch weniger von
der anstrengenden Jagd beansprucht sind.
Eine
dritte Möglichkeit wäre die, daß die seßhafte Lebensweise die allgemeine
Not linderte und deshalb die einst verbreiteten Kindestötungen entbehrlich
machte.
213
Schließlich
könnte die früher eintretende Geschlechtsreife bei den jungen Mädchen
mitentscheidend sein. Wahrscheinlich wird ja der Beginn der Monatsblutungen
beim jungen Mädchen weniger von dessen Alter, als von seinem Körpergewicht
bestimmt. Der allmonatliche Eisprung, so meint die amerikanische Ethnologin Rose
Frisch vom <Harvard Center for Population Studies>, setze voraus,
daß der Fettgehalt im Körper über einem bestimmten Minimum gehalten wird.
Dies sei bei seßhaften Frauen eher gewährleistet als bei solchen, die mit
den jagenden Männern umherzögen und Früchte und Beeren sammelten.
Daraus
ergäbe sich, daß die seßhafte, bequemere, notwendigerweise zu stärkerem
Fettansatz führende Lebensweise nicht nur frühere Geschlechtsreife bedeute,
sondern auch rascher wiederkehrende Empfängnisfähigkeit nach der kräfte-
und damit fettzehrenden Stillzeit.
Dank
der »problemlösenden« Fähigkeiten seines Gehirns gelang es dem Menschen,
seinen Lebensunterhalt auf eine neue Art und Weise zu bestreiten. Ackerbau und
Viehzucht in ortsfesten Siedlungen ließen immer mehr Menschen ihr Auskommen
finden. Vielleicht liegt hier tatsächlich die ursprüngliche Wurzel jener
weltweiten Bevölkerungsvermehrung, die seit etwa 100 Jahren ein so
gespenstisches Tempo angenommen und Folgeprobleme heraufbeschworen hat, die
die Menschheit jetzt in die Überlebenskrise gestürzt haben.
Ob
es erlaubt ist oder nicht, es muß hier auch gefragt werden, warum mit
dem »wachsenden Wohlstand« der Menschen (wenn man die schnelle Zunahme der
Weltbevölkerung einmal als vordergründiges Indiz dafür nehmen will) auch
die Krankheiten und erblichen Gebrechen anscheinend zugenommen haben.
Einer
der Gründe dafür liegt wahrscheinlich darin, daß überall dort, wo sich
Wohlstand ausbreitet, die Kranken und Schwachen besser gepflegt und gehütet,
also vor einem sonst frühen Tode bewahrt werden können. Mit anderen Worten:
Mehr krankhaft veränderte Organe, soweit sie keine tödliche Bedrohung für
den Träger bedeuten, bleiben erhalten. Biologisch gesehen können sich
nachteilige Erbveränderungen, wenn die natürliche Auslese nicht mehr wirkt,
fortpflanzen und so insgesamt einen »Erbverfall« der ganzen Population
herbeiführen, beispielsweise die Schwächung der Immunsysteme, was wiederum
den Nährboden für alle möglichen chronischen und akuten Erkrankungen
bereitet.
214
Angesichts
der stürmischen Menschenvermehrung und der zahlreichen erbschädigenden
Einflüsse im modernen Leben befürchtete dies schon der amerikanische
Genetiker Hermann
J. Muller:
»So
würde schließlich in diesem utopischen Bild kommender physischer
Minderwertigkeit, auf das hin wir schon Kurs genommen haben, die
Bevölkerung ihre Freizeit nur noch damit verbringen, ihre Leiden zu
pflegen, und sie würde so viel wie möglich arbeiten müssen, um die Mittel
zu erwerben, mit denen diese Leiden dann behandelt werden könnten. Dann
hätten wir wahrlich den Gipfel der Segnungen moderner Medizin, moderner
Industrialisierung und moderner Sozialmaßnahmen erklommen. Weil aber
derartige Evolutionsvorgänge von säkularer Dauer sind, kämen die
Verschiebungen so langsam und unmerklich in unsere Welt, daß niemand sich
dieser Wandlungen bewußt würde, abgesehen von ein paar Außenseitern, die
die Genetiker ernst nehmen, und vielleicht noch von einigen Archäologen
...«
Ein
Bevölkerungswachstum durch Wohlstand — um darauf zurückzukommen — kann
so vehement werden, daß schließlich »Hemmfaktoren« zu wirken beginnen, die
eine solche Population am Ende in kurzer Zeit völlig zusammenbrechen lassen.
Dazu
gehören zunehmende psychische Erkrankungen beim engen und »ausweglosen«
Beieinanderwohnen unter womöglich kärglichen Lebensbedingungen, sich
häufende Gewalttätigkeiten und Kriminalität. Aus Tierversuchen weiß man
von Verhaltensstörungen, übertriebenen Revierkämpfen und nachlassender
Fruchtbarkeit. Der Mensch vernachlässigt die Kinder und
gibt »humane« Verhaltensweisen auf, darunter Mitleid und Hilfsbereitschaft. Dies
kennzeichnet den Zustand einer Gesellschaft in extremer Notlage, wenn es nur
noch ums Überleben geht.
215
Versuche
an Säugetieren in künstlich übervölkerten Gehegen, in denen die Insassen
nichtsdestoweniger genügend Nahrung und Wasser vorfanden, ergaben Resultate,
wie wir sie vom Verhalten Gefangener in Massen-Internierungslagern kennen:
Streit und Mißgunst, Neurosen und Depressionen, vor allem auch Kämpfe um
einen wenn auch kleinen eigenen Platz, der dann erbittert verteidigt wird.
Der
Wuppertaler Verhaltensforscher
Paul
Leyhausen behauptet sogar, der heutige Mensch sei
angesichts seiner Massenvermehrung schon nicht mehr weit von der Situation
derart eingesperrter Lagerbewohner entfernt, und dies allein deshalb,
weil sein Bedürfnis nach einem eigenen Territorium immer weniger befriedigt
werde:
wikipedia
Paul_Leyhausen *1916 in Bonn bis 1998
»Gleichgültig,
wie groß oder klein der eigene Platz eines Menschen sein mag, und
gleichgültig, welchen Rang der einzelne in den verschiedenen Hierarchien
der Gesellschaft einnimmt, als Gebietseigner ist er Gleicher unter
Gleichen. In dieser Eigenschaft ist das menschliche Individuum in der Lage,
als verantwortungsbewußter, teilnehmender, mitarbeitender, unabhängiger
und sich selbst versorgender Staatsbürger in eine gemeinsame Organisation
einzutreten, die wir Demokratie nennen. Übervölkerte Verhältnisse sind
jedoch eine Gefahr für die Demokratie.
Tyrannei
ist das unvermeidliche Ergebnis jeder Überbevölkerung, ganz gleich, ob sie
nun von einem persönlichen Tyrannen oder von einem abstrakten Prinzip wie
dem des Gemeinwohls ausgeübt wird, das für die Masse der Individuen
überhaupt kein Wohl mehr ist. Solange die Bevölkerungsdichte noch zu
tolerieren ist, werden sich die für eine gemeinsame Sache gebrachten Opfer
auf die eine oder andere Weise für den einzelnen auszahlen und zu seiner
persönlichen Lebenserfüllung beitragen.
Bei der Überbevölkerung jedoch
steigen die Anforderungen des Gemeinwohls steil an, und was dem einzelnen
genommen wird, ist meist unwiederbringlich für ihn verloren — der
einzelne sieht meistens nicht einmal, daß das, was ihm genommen würde,
anderen zugute kommt, denn auch diese werden ohne Entschädigung beraubt.«
216
Welche
Folgen Übervölkerung unter sonst optimalen Umweltbedingungen hat, kann man
auch im Tierversuch demonstrieren.
Rädertierchen
beispielsweise, winzige Wasserbewohner aus der Klasse der Würmer, gedeihen
gut bei 15 Grad Celsius Wassertemperatur. Füttert man sie im Aquarium
regelmäßig, so vermehren sie sich innerhalb von zehn Tagen lebhaft bis auf
eine etwa gleichbleibende »Kopfzahl«. Erhöht man die Temperatur auf 20
Grad, so folgen einer anfangs raschen Vermehrung in Abständen von etwa zehn
Tagen Phasen des Zusammenbruchs, aber auch wieder Erholungsperioden. Bringt
man die Rädertierchen dagegen in Wasser von 25 Grad Celsius, so wächst die
Population zunächst stürmisch innerhalb von sechs Tagen bis zu einer hohen
Dichte an, die um etwa ein Drittel größer ist als die Zahl der bei 15 Grad
Celsius gehaltenen Tiere.
Nach
dieser Übervölkerung in der offenbar wohltuenden Wärme kommt es dann zu
einem dramatischen Rückgang, dem zwar noch zweimal
kurzfristige Erholungsphasen folgen, dann aber — nach
vier Wochen — das unweigerliche Ende: Die Rädertierchen-Gesellschaft
stirbt aus, ihr endgültiger Massentod ist besiegelt.[16]
Nun
ist der Mensch natürlich kein Rädertierchen. Trotzdem sollte der
Versuch zu denken geben. Er zeigt, daß eine Population gerade dann gefährdet
ist, wenn sie durch zunächst üppige Lebensbedingungen — abzulesen an der
stürmischen Vermehrung — zu hoher Blüte gelangt ist. Wird die
Bevölkerungsdichte dann aber zu groß, so sinkt die Geburtenrate rasch ab,
während die Sterblichkeit dramatisch zunimmt. Allenfalls hält sich die Art
jetzt noch kurzfristig dadurch über Wasser, daß die kranken und schwachen
Mitglieder sterben und Platz für andere schaffen, doch funktioniert dieses
Regulativ nicht immer.
Namentlich
in geschlossenen ökologischen Systemen und bei extrem rascher Vermehrung, wie
wir es bei der Erdbevölkerung mit ihrer steil nach oben schießenden
Wachstumskurve heute erleben, folgt der unausbleiblichen Anpassung an die
gegebenen Ressourcen durch ein Massensterben (wenn die »Grenzen des
Wachstums« erreicht sind) der Artentod. Für die Überlebenden bleibt dann
keine Zeit mehr für die Regeneration. Sie gehen zugrunde, während sich die
Umwelt von der Belastung erholt.
217
Setzen
wir den vielleicht gar nicht mehr so hypothetischen Fall eines baldigen
menschlichen Massentodes, so werden ihm weitverbreitet sicher Hunger
und Krankheit vorausgehen, wenn wir eine atomare Katastrophe hier einmal aus
den Überlegungen verdrängen. Aber auch zu moralisch-ethischen
Verfallserscheinungen wird es kommen, wie wir sie im 6. Kapitel
beschrieben haben. Manche gerade jener Merkmale werden dabei verkümmern und
verschwinden, die den Menschen nach seinem eigenen Verständnis erst zum
Menschen, also zu einem »humanen« Wesen, gemacht haben.
Auch
hierin, im »Abbau des Humanen« unter äußersten Notbedingungen, könnte man
einen letzten verzweifelten Anpassungsversuch der Natur an unerträglich
gewordene Lebensumstände sehen, auf die schließlich nur noch der Tod als
einzige Antwort bleibt.
Daß
dies keine bloßen Spekulationen sind, dafür gibt es auf der Erde mindestens
schon ein Beispiel, auf das der englische Anthropologe Colin
Turnbull und der deutsche Paläontologe Heinrich
Karl Erben aufmerksam gemacht haben [16]. Und
fast wie ein Hohn erscheint es, daß dieses Beispiel ausgerechnet aus jenem
Erdteil kommt, in dem wir die Entstehung des Menschen vermuten, nämlich aus
der Gegend des heutigen Turkana-Sees, des früheren Rudolfsees in Kenia.
Hier,
im Dreiländereck von Uganda, Kenia und dem Sudan, lebte im Tal des
Kipedo-Flusses viele Jahrhunderte das Jägervolk der Ik. Eines Tages aber
wurde ihre Heimat zum Naturschutzgebiet erklärt. Die Behörden zwangen die
Ik, ihre Hütten aufzugeben, sie siedelten sie in eine regenarme, gebirgige
Ecke im nördlichen Uganda um, wo sie nun schon über drei Generationen ein
kümmerliches Dasein fristen.
218
Nicht
nur blieb es ihnen wegen des dort spärlichen Wildvorkommens versagt zu jagen,
sondern auch der ungewohnte Ackerbau warf zu wenig ab, um ihnen eine neue
Ernährungsgrundlage zu bieten. So zerbrachen als Folge
der Vertreibung, des ständigen Hungers und der härtesten Existenznot nach
wenigen Jahrzehnten die sozialen Bindungen der Menschen untereinander in einer
Weise, wie es erschreckender kaum vorstellbar ist.
Heinrich
K. Erben schildert die erschütternden Eindrücke Colin Turnbulls vom
Leben der Ik aus dessen leider vergriffenem Bericht [16]. Der
gesellschaftliche Zusammenhalt bei diesem Volk sei völlig
zusammengebrochen, die Menschen erwiesen sich als extreme Egozentriker,
deren einziges Trachten der bescheidene Nahrungserwerb sei. Auf der Strecke
geblieben sei die Sorge für den Nachwuchs. Die Kinder würden nur lieblos
versorgt und im Alter von drei Jahren rücksichtslos ausgestoßen. Sich selbst
überlassen, bildeten sie Jugendbanden, in denen das Recht des Stärkeren
regiere. Diejenigen Kinder, die diesen brutalen Kampf ums Dasein überlebten,
seien für den Rest ihres Lebens negativ geprägt.
Hilfsbereitschaft,
schreibt Turnbull, sei bei den Ik durch Neid und Mißgunst ersetzt. Als ein
Überbleibsel früherer Sitten sei allein die Gewohnheit geblieben, daß
jeder, der etwas esse, einem zufällig dazukommenden Stammesgenossen davon
abgebe. Dies habe inzwischen dazu geführt, daß man sich im Dorf unablässig
gegenseitig belauere, um einen Bissen zu erhaschen, und jeder, der etwas
Eßbares habe, schlinge es hastig und heimlich herunter, um nicht mit anderen
teilen zu müssen. Darunter litten nicht nur die Kinder, sondern auch die
hilflosen Alten und Kranken. Ihnen etwas zu essen zu geben, sähe man
überdies als Verschwendung an, da sie ja sowieso bald sterben müßten.
Der
Sittenverfall bei den Ik habe aber noch andere Formen
angenommen. Turnbull schreibt:
»Ich
habe nur wenig gesehen, was man als Ausdruck von Zuneigung hätte bezeichnen
können. Vielmehr habe ich Dinge gesehen, über die
ich am liebsten geweint hätte. Aber bisher habe ich noch keinen Ik
Tränen der Trauer vergießen sehen. Nur die Kinder weinten — Tränen der
Wut, der Bosheit, des Hasses.«
219/220
Als
der Engländer selbst helfend eingreifen wollte, habe man ihn verhöhnt.
Bosheit und Schadenfreude seien zum alltäglichen Gebaren geworden:
»Ein
Blinder stürzt — er wird verlacht. Ein Kleinkind krabbelt ahnungslos zum
offenen Feuer — die Männer sehen erwartungsvoll zu und amüsieren sich,
wenn es sich die Händchen verbrennt.«
Turnbulls
Bericht, schreibt Erben, lese sich wie ein Alptraum. Aber der Engländer
liefere auch eine Erklärung. Die Ik seien offenbar zu der Auffassung
gelangt,
»daß
der Mensch selbstsüchtig und es sein natürliches Streben ist, als
Individuum vor allen anderen zu überleben. Dies halten sie für das
Grundrecht des Menschen, und sie haben immerhin genug Anstand, anderen
zu erlauben, dieses Recht nach Kräften wahrzunehmen, ohne deswegen irgend
jemandem Vorwürfe zu machen.«
Besonders
bedrückend wird die Situation der Ik noch dadurch, daß selbst
Hilfsmaßnahmen der ugandischen Regierung nichts an dem Verhalten des sozial
zerrütteten Stammes ändern konnten. Man habe regelmäßig Lebensmittel
bereitgestellt, jedoch den Fehler begangen, den gesunden und jungen Ik auch
jene Rationen zum Transport in die Dörfer anzuvertrauen, die den Älteren und
Kranken zugedacht waren. Statt redlich zu teilen, hätten sich die zum
Lebensmittel-Empfang Abgesandten nicht nur schon unterwegs sattgegessen,
sondern auch noch zusätzlich so viel als möglich in sich hineingestopft, nur
um zu Hause nichts abgeben zu müssen.
Turnbull
deutet die soziale Deformierung der Ik als eine Anpassungserscheinung, die dem
Einzelindividuum das Überleben ermöglichen soll. Ihr Verhalten lasse
erkennen, daß die sozialen Tugenden des Menschen sich letztlich als nutzloser
Ballast erwiesen, der nur unter günstigen Lebensbedingungen
aufrechterhalten werden könne. Der Mensch sei ursprünglich nicht sozial,
sondern aufgrund seines Selbsterhaltungstriebes primär egoistisch veranlagt.
wikipedia Ik_Ethnie
220
Erben
widerspricht in diesem Punkt, indem er darauf hinweist, daß gegenseitiges
Helfen letztlich allen Sozialpartnern nütze und die Sozialisierung bei der
menschlichen Stammesentwicklung offenkundig von großer Bedeutung gewesen
sei.
Wir
können dem nur hinzufügen, daß in der Tat Gemeinschaftssinn schon deshalb
einen hohen Auslesewert gehabt haben wird, weil eine intakte Gruppe in
Zeiten der Not oder Gefahr oft die einzige Gewähr für das Überleben des
einzelnen bot und sich Altruismus also indirekt auch als Egoismus erweisen
konnte.
Interessant
ist auch ein weiterer Hinweis Erbens.
Offenbar
bestehen Parallelen im Verhalten der Ik als Volksgruppe unter extremen
Streßbedingungen mit jenem von höheren Tieren, die man sehr zahlreich auf
kleinem Raum zusammenpfercht: »Hier wie dort handelt es sich um das
streßbedingte Ausfallen oder die Fehlentwicklung instinktgesteuerter
Verhaltensweisen: den Verfall des Brutpflege-Verhaltens und den Verlust der
sozialen Gruppenbildung.«
Haben
es also die Ik mit ihrem Verhaltenswandel fertiggebracht, um den Preis der
Menschlichkeit zu überleben? Vordergründig scheint es so. Näher jedoch
liegt, daß die verfallenden Sitten und der Verlust des Gemeinschaftssinns
auch nur Symptome des bevorstehenden totalen Untergangs sind. Ihre Situation
wäre also die eines Übergangs: eine Zwischenperiode, die zum gänzlichen
Erlöschen der Population führt, wenn etwa die Hilfeleistungen eingestellt
würden, aber vielleicht auch trotz der Hilfe, wenn die Ik weiterhin sich
selbst überlassen bleiben.
Wer
vom langsamen Sterben dieses afrikanischen Stammes hört, dem fallen
natürlich ähnliche Naturvölker ein, die dem gleichen Schicksal
entgegenzugehen scheinen oder schon ausgestorben sind: die Feuerländer
und einige süd- und nordamerikanische Indianerstämme, die krank und
degeneriert in ihren Reservaten dahinsiechen, oder die Lacandonen als letzte
mexikanische Hochland-Mayas.
wikipedia
Lacandonen
Gewiß: Jedes
dieser Völkerschicksale hat seine eigene Tragik. Es ist viel darüber geschrieben
und geklagt worden, wie hier Menschen unter den
erbärmlichsten Umständen zugrunde gehen, Völker, die sich dem
Fortschritt der Zivilisation nicht anpassen konnten.
Wäre
es aber denkbar, daß ein ähnliches Geschick eines Tages die Erdbevölkerung
insgesamt träfe?
Um
dieses Risiko abzuschätzen, muß man möglichst genaue Informationen über
die Entwicklungstrends der wesentlichsten Menschheitsprobleme zu gewinnen
suchen.
221/222
Diese
Einsicht und der Vorsatz, seine längerfristigen Regierungspläne so effektiv
wie möglich zu gestalten, bewogen den ehemaligen amerikanischen Präsidenten
Jimmy
Carter im Jahre 1977, eine »Zukunftserforschung« durchführen
zu lassen.
Die
Studie - später The Global 2000 Report - Bericht an den
Präsidenten genannt - wurde vom Mai 1977 bis zum Frühjahr 1980 vom
amerikanischen Außenministerium und dem Council on Environmental Quality
gemeinsam mit zahlreichen Forschungsinstituten und Fachbehörden erarbeitet.
Sie
sollte die wahrscheinlichen globalen Veränderungen bis zum Ende des
Jahrhunderts aufzeigen.
So
startete der bisher wohl umfassendste und ernsthafteste Großversuch mit dem
Ziel, ein Bild von der Zukunft der Menschheit und ihrem Lebensraum zu
gewinnen.
Das
dreibändige Werk [24] ist dann zwar zu einem Weltbestseller geworden
und es hat auch einen Nachfolgebericht mit dem Titel Global
Future — Time to Act
mit
Handlungsempfehlungen gegeben (deutsche Ausgabe im Dreisam-Verlag,
Freiburg i. Br. 1981), doch muß befürchtet werden, daß aus ihnen ebenso
wenig Lehren gezogen werden wie seinerzeit aus der beschwörenden Mahnung
des Clubs von Rom Die Grenzen des
Wachstums[44]. Und
dies, obgleich Global-2000
in mancher Hinsicht schon aufgrund der außerordentlich aufwendigen Recherchen
noch bedeutsamer ist.
wikipedia
Council_on_Environmental_Quality detopia:
Global
2000 Grenzen
des Wachstum
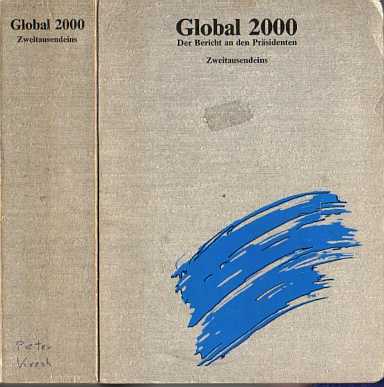

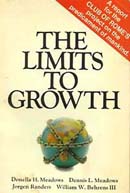
222/223
Da
es sich hier verbietet, auf das Gesamtwerk einzugehen, seien nur die
wichtigsten Erkenntnisse aus dem ersten Kapitel (<Entering the
Twenty-First-Century>) kurz zusammengefaßt.
Da
heißt es, in der Welt des Jahres 2000 werde es mehr Menschen und mehr Armut
geben als heute. Vier Fünftel der Weltbevölkerung würden in den
Entwicklungsländern leben. In absoluten Zahlen ausgedrückt läge der
jährliche Menschenzuwachs im Jahre 2000 um 40 Prozent höher als im Jahre
1975.
(Bei
einem angenommenen Bevölkerungswachstum von derzeit etwa 2 Prozent jährlich
wären dies 2,8 Prozent; statt rund 80 Millionen wie heute würde die
Menschheit im Jahre 2000 jährlich um 112 Millionen, also täglich um mehr als
300.000 Menschen zunehmen.)
Auch
die Kluft zwischen den armen und reichen Nationen sei trotz der gegenwärtigen
Anstrengungen, die Gegensätze zu lindern, größer geworden. Weiterer
Konfliktstoff würde sich angehäuft haben.
Während
im Jahre 1975 weltweit pro Kopf der Bevölkerung noch etwa 0,4 Hektar
anbaufähigen Landes verfügbar gewesen wären, würden es laut Studie um die
Jahrtausendwende nur noch etwa 0,25 Hektar sein. Die noch vorhandenen
Welt-Erdölreserven würden zwischen den Jahren 1975 und 2000 um etwa die
Hälfte schrumpfen.
Weiter
heißt es, der Druck auf die Wasservorräte der Erde werde sich erhöhen.
Allein als Folge des Bevölkerungswachstums werde das verfügbare
Süßwasser um etwa ein Drittel pro Kopf abnehmen. Schlimmer noch wird es um
die Holzreserven stehen, denn im Jahre 2000 soll kaum die Hälfte der 1975
noch nachgewachsenen Holzmenge verfügbar sein, vor allem als Folge der
maßlosen Rodungen und Kahlschläge in den tropischen Urwäldern.
In
den Entwicklungsländern werden von den 1978 noch vorhanden gewesenen Wäldern
weitere rund 40 Prozent abgeholzt sein. Und weil die Wälder nicht nur
Sauerstoff liefern, sondern auch Kohlendioxid aufnehmen, werden mit ihrem
Dahinschwinden auch die Hauptabnehmer des wachsenden Kohlendioxidgehalts der
Luft dezimiert sein. Das bedeutet: Es wird immer mehr Kohlendioxid in der
Atmosphäre geben. Die »Treibhauswirkung« wird sich also steigern. Dies
wieder wird zu einer Erwärmung führen, deren Folgen noch gar nicht absehbar
sind. Der Kohlendioxidgehalt wird laut <Global 2000> im
Jahre 2000 um fast ein Drittel höher liegen als vor der Industrialisierung.
223/224
Weiter
heißt es in dem Bericht, durch die Bodenerosion
würden im Jahr 2000 weltweit durchschnittlich mehrere Zentimeter fruchtbaren
Ackerlandes abgetragen worden sein. Die Wüsten würden sich weiter
ausgebreitet haben.
Eine
der beschämendsten Prophezeiungen aber besteht darin, daß in wenig
mehr als 2 Jahrzehnten 15-20% aller Pflanzen- und Tierarten der Erde
ausgerottet sein werden, was einem Verlust von mindestens 500.000 Arten
gleichkäme.
Steigende
Preise (z.B. um über 150 Prozent für Energien) und anhaltender
Inflationsdruck sind weitere Hiobsbotschaften. Anwachsen wird die Gefahr von
Mißernten und das Risiko von Kriegen. Über die Umweltprobleme heißt
es:
»Die
vollen Auswirkungen - einer zunehmenden Konzentration von Kohlendioxid, des
Ozon-Abbaus in der Atmosphäre, der Auslaugung der Böden, der Einbringung
immer größerer Mengen komplexer, bleibender Giftchemikalien in die Umwelt
und der massiven Artenausmerzung - werden wohl erst
einige Zeit nach der Jahrtausendwende zutage treten. Doch sind
solche Prozesse globaler Umweltveränderungen erst einmal in Gang gekommen,
lassen sie sich nur sehr schwer wieder umkehren.«
Am
unmittelbarsten, stärksten und in ihrer Auswirkung tragischsten zeige sich
laut <Global 2000> die abnehmende Belastbarkeit
der Erde in den ärmsten Entwicklungsländern:
»Afrika
erlebt südlich der Sahara das Problem einer Erschöpfung seiner
grundlegenden Ressourcen in besonderer Schärfe. Hier sind viele Ursachen
und Wirkungen zusammengekommen, um ein Übermaß der Umweltbeanspruchung
zu erzeugen, das zur Ausdehnung der Wüste führt.
Überweidung, Brennholzsammeln und destruktive Erntemethoden sind die
wichtigsten unmittelbaren Ursachen für tiefgreifende Veränderungen, die
aus offenem Wald erst Buschland, dann empfindliche semiaride Weidegründe,
wertlose Unkrautböden und schließlich die nackte
Erde werden lassen.
Die
Situation wird noch verschlimmert, wenn Menschen durch Brennholzmangel
gezwungen werden, Viehdung und Ernterückstände zu verbrennen. Der
organischen Stoffe beraubt, verliert der Boden seine Fruchtbarkeit und die
Fähigkeit, Wasser zu binden: die Wüste breitet sich aus.
In
Bangladesch, Pakistan und großen Teilen von Indien gehen die Anstrengungen
einer wachsenden Zahl von Menschen, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen,
zu Lasten der Äcker, Weiden, Wälder und Wasservorräte, auf die sie für
ihren Lebensunterhalt angewiesen sind.
Die Wiederherstellung der Ländereien und Böden würde
Jahrzehnte — wenn nicht Jahrhunderte — erfordern, nachdem die
Ausbeutung des Landes nachgelassen hat. Aber die Ausbeutung nimmt zu, nicht
ab.«
Bei
alledem gebe es keine schnellen und leichten Lösungen für die genannten
Probleme, sagt der Bericht. Am allerwenigsten
seien sie dort zu erwarten, wo der Bevölkerungsdruck die Belastbarkeit des
Landes schon überfordert.
»Tatsächlich
lassen die genauesten Unterlagen, die derzeit zur Verfügung stehen, darauf
schließen, daß im Jahre 2000 die Weltbevölkerung
vielleicht nur noch wenige Generationen von dem Zeitpunkt entfernt ist, an
dem die Grenze der Belastbarkeit des gesamten Planeten erreicht ist.«
Das
Kapitel schließt mit dem beschwörenden Hinweis:
»Die
Zeit zum Handeln, um eine solche Entwicklung abzuwenden, geht zu Ende. Wenn
die Nationen nicht einzeln und gemeinsam kühne und einfallsreiche Schritte
unternehmen, um die sozialen und ökonomischen Bedingungen zu verbessern,
die
Fruchtbarkeit zu verringern,
besser hauszuhalten mit den Rohstoffen und die Umwelt zu schützen, dann
muß die Menschheit auf einen ziemlich unruhigen Einstieg ins 21.
Jahrhundert gefaßt sein.«
225
#
detopia: Global-2000
www.detopia.de
Literatur-Löbsack
^^^^
Theo Löbsack 1983