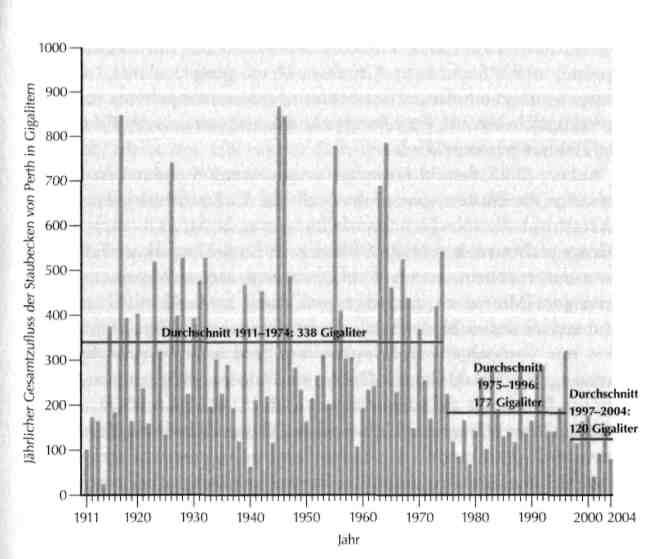Von
den Polen bis zum Äquator erstreckt sich über unsere Erde ein
Temperaturspektrum von rund -40°C bis +40°C, und Luft von +40°C kann vierhundertsiebzigmal so viel Wasserdampf aufnehmen wie solche von -40 °C.
Dieser Umstand verdammt unsere Pole dazu, riesige gefrorene Wüsten zu sein, und
uns dazu, dass wir für jedes Grad von uns verursachter Erwärmung global im
Durchschnitt ein Prozent mehr Regen bekommen werden.58
Die entscheidende
Tatsache dabei aber ist, dass dieser zusätzliche Niederschlag nicht in Raum und
Zeit gleichmäßig verteilt sein wird. Vielmehr wird es an einigen Orten zu
ungewöhnlichen Zeiten regnen, an anderen überhaupt nicht. Es wird sogar ein
paar auserwählte Stellen geben, an denen sich die Niederschläge kaum ändern
werden.
Über
weiten Teilen der Welt nehmen die Regenfälle zu, aber mehr Regen ist weder für
die Natur noch für die Menschen notwendigerweise gut. Eine der sichersten
Prophezeiungen der Klimawissenschaft besagt, dass in Folge der globalen
Erwärmung die hohen Breitengrade im Winter mehr Regen abbekommen werden, und
wie wir gesehen haben, kann das für die Bewohner der Arktis sehr schlecht sein.
Weiter im Süden führen vermehrte winterliche Niederschläge ebenfalls zu
unwillkommenen Veränderungen: 2003 lösten sie in Kanada eine tödliche
Lawinensaison aus, während in Großbritannien der Frühling 2004 so nass war,
dass es in vielen Regionen schwierig oder
unmöglich war, Heu zu machen. Natürlich erwartet man überall, wo die
Regenmengen zunehmen, auch mehr Überschwemmungen, aber je üblicher extreme
Wetterverhältnisse werden, desto häufiger wird das Hochwasser weit über das
hinausgehen, was die verstärkten Niederschläge allein zu verantworten haben.
Hier
will ich mich jedoch auf die Regionen konzentrieren, die der Klimawandel in ein
ständiges Niederschlagsdefizit stürzen wird, denn einige von ihnen werden zu
einer neuen Sahara oder zumindest zu Gegenden, in denen Menschen nicht mehr
leben können. In ein paar Fällen ist das bereits passiert. Ausbleibende
Niederschläge bezeichnet man oft als »Dürreperioden«, aber diese sind per
Definition vorübergehend, in den hier angesprochenen Gegenden aber gibt es
keinerlei Aussicht, dass der Regen zurückkehren wird. Was dort geschehen ist,
ist vielmehr ein rascher Wechsel zu einem neuen, trockeneren Klima.
Die
ersten Anzeichen eines solchen Wandels gab es in den sechziger Jahren in der
afrikanischen Sahelzone. Der betroffene Landstrich war riesig: Ein großer
Gürtel südlich der Sahara, der vom Atlantischen Ozean bis in den Sudan reicht.
Vier Jahrzehnte sind jetzt seit dem plötzlichen Rückgang der Niederschläge
dort vergangen, und es gibt keinerlei Anzeichen, dass die Leben spendenden
Monsunregen wiederkehren werden.59 Schon vor dem Rückgang gab es im Sahel nur
marginale Regenfälle, und das Leben dort war hart. In Bereichen mit besseren
Böden und mehr Regen konnten die Bauern von ihren Feldern leben, und in
trockenerem Brachland zogen Kamelhirten auf der Suche nach Futter für ihre
Herden ihre halb nomadischen Runden. Der Niederschlagsmangel hat das Leben für
beide Gruppen schwierig gemacht: Die Hirten finden kaum noch Gras in den
Bereichen, die jetzt eine echte Wüste sind, während die Bauern kaum noch
genügend Regen bekommen, um ihren Feldern ein Minimum an Ernte zu entlocken. Ab
und zu zeigen die Medien der Welt Bilder von den Folgen: Hungernde Kamele und
verzweifelte Familien, die sich durch ein staubiges Brachland kämpfen.
Ich
kann mich noch erinnern, wie ich als Kind im Fernsehen diese Bilder sah und
hörte, dass Überweidung und eine Bevölkerungsexplosion dieses menschliche
Elend verursacht hätten. Faktisch hat die westliche Welt sich jahrzehntelang
weisgemacht, dass die Katastro-