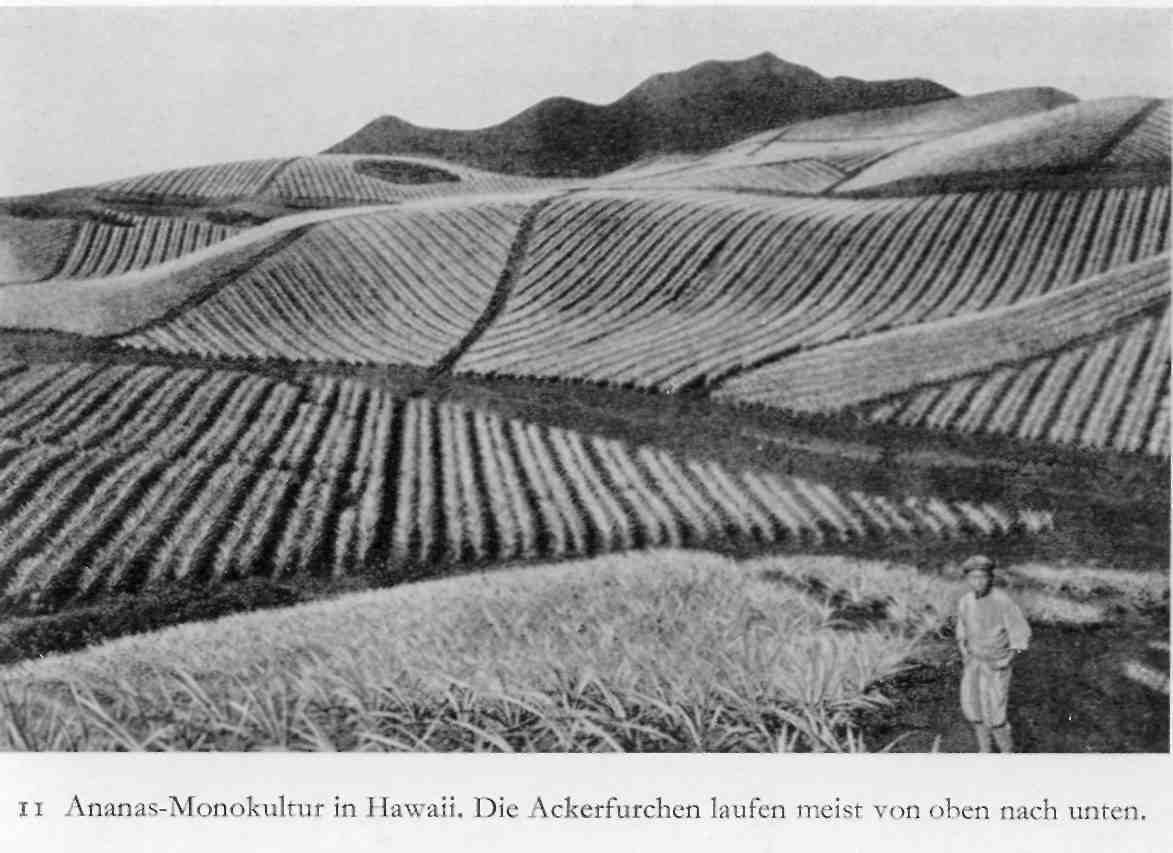

Ein schmerzlicher Tribut an die Zivilisation
162-184
Hier geht es um eine bedenkliche Todsünde, die die Zivilisation auf sich geladen hat. — Man braucht nur einem Grönländer in den Mund zu schauen, und mit großer Wahrscheinlichkeit läßt sich dann entscheiden, ob er von der Ost- oder von der Westküste kommt.
Nur etwa 2% der Zähne sind bei den von der Zivilisation kaum berührten Grönländern der Ostküste kariös. Mit 15% kranken Zähnen verrät der Grönländer der Westküste seine fortgeschrittene Zivilisation. An der Ostküste sind mehr als 85% der Erwachsenen vollständig frei von Karies, an der Westküste kaum 40%. — Der Neger im Busch ist bis etwa zum vierzigsten Lebensjahr nahezu kariesfrei. Geht er aber in die Industriestädte, dann zeigt er oft schon nach wenigen Monaten einen starken Kariesbefall.
Während die Menschen der Jungsteinzeit noch sehr gesunde Zähne hatten und nur etwa 1,7% aller Zähne Karies aufwiesen, ist bei den Germanen der vorchristlichen Zeit die Zahl der erkrankten Zähne schon etwa auf 3,5 % gestiegen. 400 Jahre n.Chr. sind es 4,3 % und im 16. und 17. Jahrhundert bereits 13%. Der große Sprung aber, der heute die Wartezimmer der Zahnärzte immer gefüllt sein läßt, kommt erst im 19. Jahrhundert. Heute rechnet man, daß bei den nordeuropäischen Stämmen 50 bis 90% aller Zähne karieskrank sind.
Während früher vornehmlich ältere Menschen befallen wurden, tritt der Kariesbefall jetzt immer mehr schon bei Jugendlichen und bei Kindern mit Milchgebiß ein. Verfeinerung der Küche und Fehlernährung mag viel dazu beitragen. Zur Zeit größter Armut, während des Dreißigjährigen Krieges, stieg die Gesundheit der Zähne. Die Ernährung ist also entscheidend. Eine Fehlernährung bei der Mutter kann nachgewiesenermaßen zu einer Schädigung der Zahnpulpa des Embryos führen.
Mit der Einfuhr der Kartoffel sank der Verzehr an Brot. Die Folge war ein Ansteigen der Karies. Ein gut behandeltes Bauernschwarzbrot ist für die Zähne ausgezeichnet, selbst dann, wenn üblicherweise etwas Mäusedreck hineingebacken ist. Das Backen hat ihn sterilisiert.
In der Goms, ein Gebiet des oberen Rhonetals, kannten die Einwohner keine Zahnschmerzen und keine Zahnfäulnis. Erst nachdem die Furka-Paßstraße eröffnet war und nun der Postillon regelmäßig in dem Tal erschien, weißes Weizenmehl brachte und so die Bewohner der Goms ihres kernigen, wenig ausgemahlenen Schwarzbrotes entwöhnte, stellte sich auch bei ihnen Karies ein.1)
Auch das Wasser beeinflußt die Zähne. Je weicher es ist, desto ungünstiger wirkt es sich aus. Bei Kindern fand man bei einer Gesamthärte des Wassers von unter 2,0 nur 1,3 % Kinder mit völlig gesundem Gebiß. Bei einer Gesamthärte von 15 bis 20 waren es 6,4%, bei 25 bis 30 bereits 14,5 % und bei einem harten Wasser von über 38° hatten über 20% der Kinder ein völlig gesundes Gebiß. Man sollte daher nicht Lokomotiven zuliebe ein bakterienhaltiges weiches Trinkwasser für die städtische Wasserleitung einem reinen, frischen und harten — allerdings den Maschinen weniger bekömmlichen Wasser aus dem Harz den Vorzug geben.
Die Nahrung der Zivilisation stellt zuwenig Ansprüche an die Zähne und an die Speichelproduktion. Ferner wirken viele Gewerbegifte auf die Zähne (Säurebetriebe). Die gehäufte Karies bei Zuckerbäckern ist eine Berufskrankheit. Bedingt wird sie durch den feinen Zucker- und Mehlstaub. Zuckergenuß dagegen erhöht die Karies nur dann erheblicher, wenn zwischen den Mahlzeiten häufiger klebrige Zuckerwaren genommen werden. Die Neger der westindischen Inseln kauen ständig Zuckerrohr und haben auffallend gute Zähne. Für die Malaien auf Java gilt ähnliches.
1) Bis 1800 wurde bei uns 90% Vollkornbrot und 10% Weizenmehl gegessen. Heute ist es umgekehrt.
163/164
Aber seltsam, wenn wir in gleichen Mengen Kristallzucker zu uns nehmen würden, dann würde auch bei künstlicher Zufuhr von B-Vitaminen ein schwerer Mangelzustand an Vitamin B1 eintreten. Rohrzucker ist ein ausgesprochener Vitamin-B-Räuber. Wieso tritt eine solche Avitaminose bei den Kubanern nicht ein? Es müssen im Zuckerrohr wohl Stoffe vorhanden sein, die der Räuberei des Zuckers wieder entgegen wirken.
Wildtiere leiden in Gefangenschaft oft erheblich an Karies (Wildkaninchen zu Hauskaninchen etwa wie 1:10), auch wenn man ihnen möglichst die gleiche Kost vorsetzt, wie sie sie in freier Wildbahn finden. Man muß hier daran denken, daß auch psychische Momente mitwirken. Wenn dies zutrifft, dann darf man wohl erwarten, daß auch des Menschen Unrast sich nicht nur auf Nerven, Herz, Magen und Geschlechtsorgane, sondern auch auf die Zähne auswirkt. Wenn Umsiedler mit hervorragendem Gebiß und aus einer Gegend stammend, wo Karies wenig verbreitet ist, schon nach vier Monaten die ersten Zahndefekte zeigten, so mag auch hier neben der Umstellung in der Ernährung ein psychischer Effekt vorliegen. Man muß um so mehr an eine seelische Einwirkung denken, als hier nach einem Jahr die Erscheinung wieder abzuflauen begann.
Zu all dem kommt noch eine indirekte Auswirkung der Zivilisation.
Der Mensch zeigt schon seit Tausenden von Jahren ein Merkmal der Domestikation, das die Zähne ungünstig beeinflußt: Seine Kiefer werden kürzer, kleiner, und als Folge davon drängen sich die Zähne immer dichter. Dadurch wird die Karies begünstigt. Möglich, daß diese Verkürzung durch den Gebrauch von Messer und Gabel bedingt wurde. Früher hat man das ganze Stück Fleisch zwischen die Zähne genommen und sich Stück für Stück heruntergerissen. Dadurch wurde der Kiefer immer in Längsrichtung gezerrt. Vielleicht war es der Gebrauch des Messers, der unseren Kiefer kürzer werden ließ. Doch müßten dann Völker wie die Amharen, die die alte Gewohnheit bewahrten, größere, geräumigere Kiefer haben. Dies trifft aber nicht zu. Außerdem würde dies die Annahme einer Vererbung erworbener Eigenschaften fordern.
Und schließlich die Paradentose!
Wer kennt nicht diesen heimtückischen Prozeß, der die scheinbar besten und gesündesten Zähne einen nach dem anderen Abschied nehmen läßt. Und die Ursache? Sie ist nicht bekannt; man muß aber sicher annehmen, daß sie innerhalb der Zivilisation und innerhalb »unserer« Zivilisation liegt. Unsere Voreltern wußten noch nichts von einem solchen Streik der Zähne, obwohl man früher meist viel üppiger als heutzutage gegessen hat.
Und seltsam, unsere Hunde neigen heute in Auswirkung der Domestikation in stärkerem Maße zu Paradentose als zur Karies. Nur gelegentlich trat Paradentose schon in zurückliegenden Zeiten auf. So als Folge von zu starkem Betel- und Tabakkauen. Vereinzelt findet man sie auch an den Schädeln der Alt- und Jungsteinzeit. Erst 200 Jahre n. Chr. fängt die Paradentose an, sich etwas mehr bemerkbar zu machen. Und heute befällt sie schon Jugendliche.
165
Der erloschene Ernährungsinstinkt
Frühstücken wie ein Fürst,
Mittagessen wie ein Edelmann,
Abendessen wie ein Bettelmann.
Und all dies tue mit Ruhe und Genuß, auch wenn du nur ein Käsebrot vor dir hast. — Mit Eiweiß, Kohlehydraten und Fett glaubte man vor 50 Jahren dem Menschen alles Nötige geboten zu haben. Heute kennt man bereits mehr als 100 Substanzen, die für eine natürliche Ernährung unerläßlich sind. Man darf sicher sein, daß die Entdeckungen damit noch nicht abgeschlossen sind und daß noch mancherlei dazukommen wird.
Um so mehr ist der Mut des Menschen zu bewundern, vollwertige Nahrungsmittel synthetisch herstellen zu wollen. Dazu kommt, daß die natürliche Nahrung niemals nur ein willkürliches, vom Menschen zusammenkomponiertes Aggregat sein kann, sondern zumeist einen harmonischen Komplex darstellt. Es sei nochmals auf das Zuckerrohr verwiesen, das den Vitamin-B1-Haushalt nicht zu beeinträchtigen scheint, während der von uns daraus isolierte Zucker dies in hohem Maße tut. Auch David Livingstone hat in Afrika lange Zeit nur von Rohrzucker gelebt und blieb dabei recht gesund.
Das Wort von Kollath: »Man lasse die Nahrung so natürlich wie möglich« bezieht sich auch darauf, daß wir beinahe grundsätzlich die natürlichen Nahrungsmittel zerlegen, isolieren, auslaugen, raffinieren und hinterher in anderer unnatürlicher Weise wieder zusammensetzen. Man träumt von Ernährungspillen, die die übliche Nahrung ersetzen sollen — wobei man vergißt, daß Ballaststoffe für Darmtätigkeit und Darmflora kein unnötiger Ballast sind. Synthetische Nahrungsmittel mögen wertvoll sein, sie sind aber nicht vollwertig.
Und doch muß hier ein großer Erfolg der Chemie erwähnt werden, der die Versorgung mit Eiweiß betrifft. Die wichtigsten Bausteine des Eiweißes sind die Aminosäuren. Der sich entwickelnde Organismus ist auf 10 Aminosäurearten angewiesen. Es hat sich nun gezeigt, daß man Versuchstiere ohne Eiweiß, nur mit den synthetisch hergestellten Aminosäuren am Leben erhalten kann, ohne daß sich eine Schädigung bisher hätte nachweisen lassen.
166
Etwa 40% der Gesamtnahrung des Menschen kommen vom Getreidekorn. Es mag daher genügen, hier nur auf die Denaturierung dieses wichtigsten Bestandteiles unseres Speisezettels einzugehen. Zunächst wird es seiner Wirkstoffe beraubt. Diese sitzen in der Kleie und kommen also ins Schweinefutter. Hinterher versucht man das Abgetrennte zum Teil wieder hinzuzufügen. Das Mehl wird »angereichert«. Dem weißen Mehl sind die wichtigsten Salze und Vitamine (A und B1 zu 80%) geraubt. Eine solche entwertete Nahrung halten nicht einmal die Ratten aus. Sie erkranken an Neuritis. Nicht viel anders verhält es sich mit dem polierten Reis. Aber auch die nachträgliche Anreicherung mit Vitaminen birgt Gefahren, wenn das gegenseitige Gleichgewicht der Vitamine nicht gewahrt wird. Es treten typische Vitaminmangelkrankheiten auf.
Es ist ein Gesetz: Erst Zerstörung des Nahrungsmittels (Wegnahme der Vitamine). Dann eine Mißhandlung, die die noch verbleibenden Wirkstoffe zerstört (Bleichen des Mehls mit Zerstörung des Karotins durch Stickstofftrichlorid). Dann setzt man bedenkliche Chemikalien zu (Jod-, Brom- und andere Verbindungen). Im ganzen ein Vernichtungsprozeß, der den Namen »Mehlveredelung« trägt.
Jetzt ist das Bleichen auch bei uns untersagt. Einen Vorzug hatte allerdings solches Mehl: Es wird von den Schädlingen nicht gefressen.
Damit ist aber noch nicht alles über unser Mehl gesagt. Zu den beabsichtigten Beimengungen kommen noch Substanzen, die auf anderem Weg ins Mehl gelangen, so Schädlingsbekämpfungsmittel, Beizmittel und verschiedene andere, die in größeren oder geringeren Mengen vorhanden sein können und sowohl Vitamine als auch Aroma zerstören. Wer kennt heute noch das köstliche Aroma eines guten Bauernbrotes? »Während noch vor 30 Jahren das Brot durch seinen Duft und Wohlgeschmack zum Essen reizte, fehlt dem gummiartigen Durchschnittsbrot der heutigen Zeit jeder Geschmackswert.« (W.Heupke.)
Versuchstiere, die durch den Genuß von weißem Weizenmehl krank werden, erholen sich schnell wieder, wenn ihnen 97prozentig ausgemahlener Roggenschrot angeboten wird.
Noch ein anderes wichtiges Lebensmittel sei hier kurz behandelt: die Kartoffel. Sie enthält Vitamin C. Jedoch in genügenden Mengen nur für den, der sehr viel ißt. »Sehr viel« soll hier sagen, soviel wie ein Schwerarbeiter aufnehmen und verdauen kann.
167
2) Man muß bedenken, unser Boden ist meist schon überfordert und ausgelaugt und braucht vielseitige Hilfe.Wer aber zur sitzenden Lebensweise durch Beruf verurteilt ist, hat keinen Appetit, der groß genug wäre, um die nötigen Mengen Kartoffeln aufzunehmen, und wenn er ihn hätte, wäre es für ihn ungesund; denn der Darm könnte bei einem solchen Menschen große Kartoffelmengen gar nicht verdauen. Der geistige Arbeiter, der immer bereit sein muß, mit seiner Aufmerksamkeit und Konzentration von einem Thema zum anderen überzuspringen, wie es heute von allen gefordert wird, die in leitender Stellung sind, er braucht eine konzentrierte Nahrung, d.h. eine Nahrung, die auch schon in kleineren Mengen alle wichtigen Nährstoffe unverdorben bietet. Wollte er sich mit einer Schwerarbeiterkost belasten, so würde sein Verdauungssystem bald streiken, auch wenn sein Appetit mitmachen würde.
Eine gesunde Nahrung kann nur von einem gesunden Boden kommen. Man hat merkwürdige Entdeckungen gemacht. Auf kobaltarmen Böden Schottlands und Australiens wird das Vieh blutarm. Ist zuwenig Bor im Boden, dann wird die Ernte nicht nur gering, das Obst und die Kartoffeln werden überdies krank. Alte Kulturböden sind oft kupfer- und kobaltarm. Derartige Erkenntnisse ließen schließlich das Problem der Kunstdüngung wieder lebendig werden. Künstliche Düngung vervielfacht die Erträge. Ohne sie wäre die Menschheit noch mehr unterernährt. Wie aber steht es mit der Qualität der Nahrung? Die Propheten der künstlichen Düngung verteidigen ihren Standpunkt genauso leidenschaftlich wie die der natürlichen. Und von jeder Seite werden »zwingende« Beweise angeboten.
Bei reiner Mineraldüngung läuft man auf die Dauer eine Gefahr, die bei der biologischen Düngung nicht gegeben ist: Es können dem Boden irgendwelche wichtige Spurenstoffe entzogen werden, die man zum Teil heute in ihrer Bedeutung noch gar nicht erkannt hat. Bei der biologischen Düngung werden diese im wesentlichen immer wieder dem Boden zugeführt1.
Immer mehr gewinnt man den Eindruck, daß man in dem umstrittenen Problem statt »oder« ein »und« setzen muß, daß man also beste biologische Düngungsart mit der Mineraldüngung vereinigen sollte. Dafür sprechen Versuche, die schon sehr lange laufen. Nicht nur hohe Ernte, sondern auch wertvolle Ernte wird so erreicht2.
Wohl hat man den Eindruck, daß früher viele Krankheitserreger beschäftigungslos waren und erst dank der Zivilisation reichlich Arbeit fanden. Auf der anderen Seite darf man aber auch die Fortschritte nicht übersehen.
1) Diese Gefahr ist größer geworden, seitdem man »gereinigten« Dünger verwendet.
1
68Das Kochen der Speise hat wesentliche Vorteile, auch kann es Parasiten und auch Gifte zerstören. Mit einigen Feuerbohnen, roh gegessen, kann sich der Mensch umbringen. Gekocht sind sie völlig unschädlich, da das Gift (Phasin) sehr hitzeempfindlich ist. In geringerem Maße gilt dies für alle Bohnen. Manche Kinder mögen auf solche Art schon durch den Genuß roher Bohnen plötzlich erkrankt sein.
Nicht nur Seuchen, auch manche Ernährungskrankheiten waren früher häufiger. So zum Beispiel Rachitis. An alten Skeletten wird sie oft festgestellt. In Mitteleuropa — nicht im sonnigen Süden — war Rachitis so häufig bei Kindern, daß man sie durchaus nicht als etwas Unerwünschtes empfand. Bilder aus dem Mittelalter zeigen häufig das Jesuskind stark mit Rachitis behaftet. Man sah nichts Krankhaftes dabei. Zwischen dem 40. und 60. Breitengrad findet man Rachitis überall da, wo die Kinder unter Lichtabschluß heranwachsen. Auf der Schattenseite tief eingeschnittener Alpentäler ist sie häufig, auf der Sonnenseite und auf den Höhen fehlt sie. Frauen, die weniger außer Haus kommen, und dann nur tief verschleiert (Mohammedanerinnen, Frauen einer indischen Sekte), sind häufig rachitisch.
Obwohl hier eine Vitaminmangelkrankheit vorliegt (Vitamin D), wird diese doch nicht allein durch die Ernährung bedingt. Ein Kind mag noch soviel Lebertran zusätzlich aufnehmen, wenn es aus dem Halbdunkel der Wohnung nie herauskommt, wird es rachitisch. Am meisten leidet bei uns die Stadtjugend unter dieser Mangelkrankheit.
Zuwenig Licht ist schädlich, zuviel schadet ebenso, besonders, wenn der Körper davon überrascht wird, wenn man ihm nicht Zeit genug läßt, Pigment zu bilden, das die ultravioletten Strahlen absorbiert und dadurch Gehirn und Lunge vor Schädigungen schützt. Ein Zuviel der Sonnenbestrahlung führt durch toxogenen Eiweißzerfall in der Haut zu Arteriosklerose und zu Magenentzündungen, zum Aufflammen von Tuberkulose und zu Menstruationsstörungen.
Dieses Kapitel kann nicht beendet werden, ohne noch darauf hinzuweisen, welche allgemeinen Folgen die Behandlung unserer Lebensmittel mit Maschinen mit sich bringt. Was wir auch essen, wenn wir vom frischen Obst und einigen wenigen anderen Dingen absehen, meist ist es vorher durch eine oder mehrere Maschinen gelaufen. Dadurch werden ihm Spuren verschiedener Metallteile beigemengt. Man weiß nicht, ob sie zu Schädigungen führen.
Dazu kommen die Krebsgefährdungen durch Reizstoffe, die in vielen Ländern der Nahrung hinzugefügt werden. Das Färben der Nahrungsmittel mit Teerfarbstoffen führt zu Speicherung in der Leber und kann hier Krebs erzeugen.
169
Das Buttergelb hat eine traurige Berühmtheit erlangt. Seine letzten Abbaustoffe sind starke Zellgifte. Noch vor 20 Jahren wurde es als garantiert unschädlich bezeichnet. Man färbt die Bohnen grün, Obstkonserven rubinrot. Es darf nicht verkannt werden, daß unansehnliche Marmeladen durch Färben ein angenehmes und vor allem ein appetitanregendes Aussehen erhalten. Auch Aroma und Konsistenz können günstig beeinflußt werden.
In Johannisburg wird Trinkmilch gefärbt. Rote und schokoladebraune Farbe wird besonders bevorzugt. In USA beginnt man Zucker himmelblau und Salz rosa zu färben.
Eine große Zahl Chemikalien (etwa 600) kommt in den verschiedenen Ländern zur Verwendung, zum Teil erlaubt, zum Teil werden schönende und konservierende Mittel auch »schwarz« verwendet, wobei es ganz unmöglich ist, auch nur einem Bruchteil der vielen »schwarz« angewendeten Mittel nachzuspüren. Wohl werden alle Färbe- und Zusatzmittel heute so sorgfältig wie möglich auf ihre Unschädlichkeit hin geprüft. Aber nur so sorgfältig »wie möglich«! Und diese Möglichkeit ist leider sehr begrenzt, wenn es sich dabei um Feststellung einer Schädigung durch Speicherung oder auch um eine Wirkungspotenzierung an sich unschädlicher Stoffe handelt.
Wohl verwendet man als Testtiere die besonders empfindlichen Ratten. Aber die Ratte lebt nicht lang. Was besagt dies schon, wenn diese Versuchstiere nach einem Jahr noch keine Leberschädigungen zeigen, wo doch bekannt ist, daß die Latenzzeit des Krebses beim Menschen bis zu 30 Jahren betragen kann. Man benützt außerdem auch Hunde, Katzen und Meerschweinchen, in USA auch Schweine als Testobjekte. Und immer geht man von der Voraussetzung aus, daß die Schädigungen sich um so schneller zeigen werden, je lebhafter der Stoffwechsel ist. Dies mag gelten. Aber nun folgert man weiter, daß die Intensität des Stoffwechsels an der Schnelligkeit des Lebensablaufes, also an der Kurzlebigkeit des Tieres, gemessen werden kann.
Und dieser Schluß ist falsch und sehr verhängnisvoll. Wenn dem so wäre, dann dürften die Vögel mit ihrem hochgetriebenen Stoffwechsel nur kurz leben und nicht bis zu 100 Jahre alt werden wie Krähen, Eulen und Adler, und 170 Jahre alt wie Schwäne. Der lebhafte Papagei kommt auf 140 Jahre, und selbst der unruhige kleine Kanarienvogel kann 30 Jahre erreichen. Ist sein Energieumsatz wirklich zehnmal (!) langsamer und der des Papageies sogar vierzigmal langsamer als der der Ratte?
170
Und das Nilpferd, das höchstens ein Alter von 40 Jahren erreicht, lebt dieses Bild des potenzierten Stumpfsinnes wirklich doppelt so intensiv und reagiert daher doppelt so schnell wie der Mensch? Wer wollte derartiges behaupten? Der Erhaltungsumsatz der Ratte ist nicht zwanzigmal so schnell, wie entsprechend der Lebensdauer, gemessen am Menschen, anzunehmen wäre, sondern höchstens viermal so schnell.1)
Wir müssen uns klar darüber sein: Die Menschheit ist völlig unbrauchbaren Testobjekten ausgeliefert, wenn es sich darum handelt, sie vor Dauer-Schädigung (Krebserzeugung) zu schützen. Auch die Leistungsprüfung kann nicht darüber hinwegtäuschen.
Es ist zu verlangen, daß man nach günstigeren Testobjekten und Testmethoden sucht. Vielleicht sind niedere Tiere, Einzeller, geeignet, die zwar noch kürzer leben, aber infolge ihrer Ungeschütztheit und relativ großen Oberfläche eine Sofortreaktion zeigen.
Wenn sie auch den Säugetieren und den Menschen sehr ferne stehen, es geht hier vor allem darum, festzustellen, ob man es mit Protoplasmagiften zu tun hat. Und diese Antwort könnte hier sehr schnell erlangt werden. Noch größere Hoffnung aber darf man wohl in die Prüfung mittels Gewebskulturen setzen, denn hier kann man Gewebe vom Menschen benutzen.
Zwischen Naturprodukt und unseren Magen schiebt sich die Industrie. Die Verteilung der Nahrung über die ganze Erde hin fordert dies, denn sie fordert Konservierung. Die Industrie schiebt sich aber geflissentlich auch da ein, wo es nicht nötig wäre. In allen Speisen gibt sie ihre Visitenkarte ab.
Und die Büchsenkonserven? Können nicht auch hier Spurenstoffe von der Büchse in die Nahrung übergehen und dort Unheil anrichten? Von Röstprodukten und hocherhitzten Fetten ist bekannt, daß sie Krebs hervorrufen können.
Man hat berechnet, daß der Mensch täglich 1 bis 2,5 g chemische Fremdstoffe aufnimmt. Welche davon schädlich sind, vielleicht schädlich erst, wenn sie 10 oder 20 Jahre lang aufgenommen wurden, darüber weiß man noch nicht viel. Daß es nur Spuren sind, darf nicht beruhigen. Wir haben gehört, was Spuren vermögen. Die meisten Zusatzstoffe müssen in der Leber entgiftet werden. Dieses Organ vor allen anderen bekommt es zu spüren, daß unsere Welt vergiftet ist. So wird die Leber ständig überfordert und geht darüber oft zugrunde. Seit 1925 hat die Zahl der Lebererkrankungen um das Zehnfache zugenommen.
»Man mache die Nahrung so un-natürlich wie möglich« — dies scheint heute die Losung zu sein, sofern man nur dadurch Geld verdient.
1) Man beruft sich auf Rubner. Aber gerade er hat erklärt, daß das für die Tiere geltende ökonomische Prinzip für den Menschen nicht in gleicher Weise gilt (»nur für den Menschen ist es durchbrochen«). Manche Rattengifte sind für den Menschen anscheinend unschädlich. Warum sollte es nicht auch umgekehrte Fälle geben?
171
Orangen haben zur Orangenzeit keinen besonders hohen Preis. Daher zwingt man sie, unzeitgemäß zu reifen. Noch völlig grün werden sie in Florida gepflückt und in drei bis vier Tagen einem Schnellreifungsprozeß unterworfen, indem man sie hohen Temperaturen in einer Gaskammer von Äthylenatmosphäre aussetzt. Nun werden sie gebleicht, bis sie das Aussehen von geschälten Kartoffeln haben. Als letztes bespritzt man sie mit Orangefarbe, damit sie wie »die Orangen glühn«. Dies wiederum gibt ihnen einen unangenehmen Geruch, der durch Aromatika beseitigt werden muß. Erst dann sind die Orangen fertig. Doch sind sie nicht ohne namhafte Zuckermengen genießbar. Auch hier muß das Make-up dafür sorgen, daß die bittere Frucht doch noch gut an den Mann gebracht wird.
Durch die Verirrung unseres Ernährungsinstinktes hat die Zivilisation die meisten Krankheiten des Menschen geboren.
Alkohol und Opium — Walhalla und Nirwana
Es wäre lasterhaft, wollte ein Volk einem Laster anhängen, das seinem Temperament, seinem Wesen und seiner Weltanschauung zuwiderläuft. So entspricht dem einen Volk der Alkohol, dem anderen das Opium. So wie der Körper des Eskimo vor allem nach einheizendem Fett, der des Südländers vor allem nach Kohlehydraten verlangt, so bestimmt auch die geistige Einstellung des Menschen die Reiz- und Genußmittel und die Gifte, die ihm die Welt in anderen Farben erscheinen lassen sollen.
Es sind also mildernde Umstände gegeben, sofern sich der Sünder an das ihm gemäße Gift hält. Andererseits verrät es den Willen zur Degeneration, wenn er dagegen verstößt, wenn z.B. der Europäer zum Opium übergeht. Es lohnt sich, darauf einzugehen.
Inder und Nordeuropäer — welch starker Gegensatz zwischen dieser beiden Kulturvölkern. Der Europäer sucht sich in seinen Taten, der Inder sucht sich im Kosmos. Durch die Tat wird das Individuum betont. Des Europäers Streben ist stärkstes Herausheben seiner Person. Nichts wird von ihm so pfleglich behandelt wie die Gloriole, mit der er sich zu umgeben trachtet. Sie gilt ihm alles.
Er hat herausgefunden, daß der Alkohol ihr besonders leuchtende Farben verleiht. Einige Gläser Schnaps, und der Heros auch im Alltagsmenschen ist fertig. Bewundernd steht der Gewaltige vor sich selber stramm.
Der Inder hat andere Ideale. Er will gar nicht nach außen wirken. Er interessiert sich nicht für seine eigene Herrlichkeit als Einzelausgabe, er fühlt sich als Teil der Natur. Dies ist ihm ungleich wichtiger. Seine Individuation stört ihn dabei. Er nimmt Opium, um dem blamablen Ich zu entgehen und um sich im Nirwana zu verlieren.
172
Die Germanen hatten das Empfinden, daß sie sich in diesem Leben noch lange nicht genug ausgetobt hatten. Sie benötigten daher einen Himmel, in dem man seine Waffen tragen und seinen Helm aufbehalten durfte, in dem man sich gegenseitig beim Zechgelage seine Heldentaten servierte. Wäre ihnen das Kino bekannt gewesen, es wäre zu einem wichtigen himmlischen Utensil avanciert. Immer wieder seine eigenen Heldentaten an sich genießerisch vorbeiziehen zu lassen, dazu bei einschlägigen Stellen der Applaus der anderen Recken, das wäre erst des Himmels Vollendung gewesen.
Für den Inder liegt ein solcher Himmel um 4000 Jahre zurück. Indras Hallen sind längst Nirwana gewichen, dem Himmel der Müden. Aber auch Abgeklärte treffen sich dort.
Nirwana. »Der auf dem Hindu lastende Alpdruck heißt nicht Tod, sondern unerbittliche Wiederbelebung.« Der Europäer fürchtet den Tod, der Inder das Leben. Nirwana ist die Ruhe, ein positives, ein existierendes Nichts, ein Entkommen dem Ich, diesem Ich, das nur ein Kristallisationspünktchen der Natur darstellt, eines der vielen Milliarden. »Death is so permanent«, seufzt der Amerikaner. Und der Inder denkt: Wenn er es doch wäre!
Ein so verschiedenes Denken und Empfinden hat der verschiedene Boden erzeugt, auf dem die Menschen gewachsen sind, der Boden, über den der Germane schreitet und der Inder schwebt.
Der Münchner reagiert sich am Fasching und auf dem Oktoberfest ab, andere Völker bei Ruderregatten, andere beim Stier- oder beim Hahnenkampf, wieder andere beim Lynchen und der Inder auf dem Nagelbrett. Und jeder belächelt das seltsame Vergnügen des anderen. Trotzdem zählen alle zur selben Spezies: Homo sapiens.
Den schroffsten Gegensatz zu dem Inder bildet der völlig verstädterte, der Zivilisation erlegene Mensch, wie er in den Büros, in den Börsen und Banken der Weltstädte nicht mehr selten ist. Hier finden wir den nackten Gestaltungswillen ohne Besinnlichkeit und ohne innere Beschaulichkeit — ein Defizit an Seele. Beim Inder erstickt die Beschaulichkeit den Gestaltungswillen — ein Defizit an Tatendrang. Die nördliche europäische Rasse steht in der Mitte.
Dem Inder ist der Tod die große Enttäuschung, ein jämmerlicher Versager. Dieser ewigen Wiederkehr, diesem Zwang, immer wieder in irgendeiner Gestalt auftreten zu müssen, vermag der Mensch nur zu entgehen, wenn er sich von seinem Ich völlig zu distanzieren vermag durch Beherrschung des Leibes und durch immerwährendes Sichversenken in Selbstschau. Nur eine Überwindung jeder Art von Ichverliebtheit, nur eine restlose Desavouierung seiner Individuation vermag schließlich dazu zu führen, seiner Reinkarnation zu entschlüpfen und mit tatenloser Anonymität und mit dem Gleichmut eines Gottes den Fluß der Dinge hinzunehmen.
173
Jetzt erst kann der Inder hoffen, daß der Tod es ernst meint mit ihm, daß er solchermaßen das große Ziel erreichen wird, das Ende aller Weisheit, »tot zu sein vor Unsterblichkeit«. So ist der Selbstmord für den Inder etwas völlig Widersinniges, ein Fluchtversuch mit untauglichen Mitteln. Erst bei dem Erleuchteten, bei dem, der herausgetreten ist aus dem Zwang ständiger Wiedergeburt, hat der Selbstmord Erfolg und Sinn. Ihm wird er bei fortgeschrittenem Alter von dem Brahmanismus sogar empfohlen: er hat seinen Auftrag erfüllt, er darf gehen.
Da aber nicht einem jeden durch Sichversenken im Dämmerschlaf die Flucht aus dieser Welt gelingt, so muß ihm das Opium dazu verhelfen.
Opium, vom Schlafmohn gewonnen, führt bei stärkeren Dosen zu einem tiefen Schlaf mit lebhaften Träumen. Wichtigster Bestandteil ist das Morphium. Dieses wirkt in kleinen Dosen zunächst erregend, dann aber lähmend. Durch Gewöhnung können Dosen ertragen werden, die selbst das Hundertfache der als schmerzstillend verschriebenen Menge darstellen. Morphium- und Opiumsüchtigkeit führt zum Zerfall der Persönlichkeit.
Sucht — wodurch wird sie bedingt? Ist die Zivilisation verantwortlich zu machen? Nur zum Teil. Sie intensiviert, sie verführt und sie erleichtert es, dem süchtigenden »Laster« zu frönen. Man kann aber auch Affen ohne weiteres süchtig machen. Die Zivilisation liefert alle Genußgifte in konzentrierter und in bequem käuflicher Form, und der gehetzte, ermüdete, abgeschlagene Mensch verlangt in höherem Maße nach Peitschen für das Nervensystem und nach Sporen (Höchstleistung im Sport) für den Körper. 250 Millionen, also ein Fünftel der Menschen, nehmen Haschisch (= indischer Hanf) zu sich. Jeder Mensch läuft Gefahr, durch fortgesetzte und immer gesteigerte Zufuhr eines Genußgiftes süchtig zu werden.
Es scheint, daß vor allem solche Stoffe süchtig machen können, auf die der Körper sich besonders einstellen muß. Wer den Umgang mit dem Alkohol erlernt hat, vermag das Alkoholmolekül an bestimmter Stelle zu zerreißen und es dadurch unschädlich zu machen. Damit aber entsteht die Gefahr, daß der Körper nach gesteigerter Zufuhr verlangt und daß eine so weitgehende Gewöhnung eintritt, daß bei plötzlicher Entziehung Störungen eintreten1.
Kein Zweifel, daß alle derartigen psychischen Seuchen insofern noch durch die Zivilisation gefördert werden, als es in der Stadt viel leichter ist, auf verbotenen Wegen zu solchen Giften zu gelangen, als auf dem Land.
1) Der Körper wehrt sich gegen diese Gifte. Diese Abwehrmaßnahmen werden unerträglich, sobald nichts mehr abzuwehren ist.
174
Noch auf andere Weise wirkt sich die Stadt aus.
Das biologische Dunkel der Großstadt führt zu einem Strahlungsmangel, der die Geschmacksempfindungen herabdrückt und die Neigung zu Stimulantien steigert (Tabak, Kaffee, Tee, Gewürze, Alkohol).
Die Dunsthaube der Großstadt stellt mildernde Umstände dar für den Menschen, der süchtig wird. Allerdings — der Strahlungsmangel könnte auch durch entsprechende Ernährung ausgeglichen werden.
Der Tabak ist ein Geschenk Amerikas. Doch wurde auch schon vor Kolumbus von den Kelten geraucht. Man verwendete Hanf, dessen wirksamer, d.h. giftiger Bestandteil im Haschisch liegt. Die meisten Völker inhalierten, indem sie um ein Hanffeuer herumsaßen. Die Indianer rauchten Zigarren aus Tabak.
Die Empfindlichkeit gegen Nikotin ist beim Menschen sehr verschieden. Bei chronischem starkem Tabakgenuß, gleich ob geschnupft, gekaut oder geraucht wird, verengen sich die Gefäße, auch die Herzkranzarterie oder auch die Beinarterien, so daß bisweilen intermittierendes Hinken auftritt. Angina pectoris, Magenkatarrhe, Impotenz beim Manne, Nachlassen der Libido bei der Frau, Unregelmäßigkeit der Menstruation, Zunahme der Eklampsie (= Bewußtlosigkeit und Krämpfe während der Schwangerschaft) können Folgen starken Rauchens sein.
Der Vitamin-C-Gehalt des Blutes geht zurück, da dieses Vitamin durch die Verbrennungsprodukte des Zigarettenpapiers zerstört wird. Die Folge davon können Lungentuberkulose, Magen- und Darmgeschwüre sein. Beim Kettenraucher wird im Laufe eines Tages das Kohlenoxyd-Hämoglobin bis auf 12% gebracht; ja, bei Zigarrenrauchern konnten sogar schon 20% Kohlenoxyd-Hämoglobin nachgewiesen werden. Die Frau ist empfindlicher als der Mann. Sie verlangt daher weniger starken Tabak. Der Raucher raucht stark, die Raucherin raucht viel. Jugendliche sind empfindlicher als Erwachsene. Die peripheren Blutgefäße werden durch Nikotin stärker geschädigt.
Ob durch starken Nikotingenuß auch die Empfängnismöglichkeit herabgesetzt wird, ist noch nicht sicher entschieden, wenn es auch wahrscheinlich ist. Der Tierversuch gibt auf diese Frage noch keine eindeutige Antwort.
Übermäßiges Rauchen trifft aber nicht nur den Raucher selbst — es zählt dies auch zu den Sünden der Eltern gegen die Kinder. Nikotin vermag sehr stark die Eier und die Samenzellen zu schädigen. Der Keim kann also schon, bevor er sich zu entwickeln beginnt, erheblich vergiftet sein. Wird auch während der Schwangerschaft weitergeraucht — nicht selten tritt eine schützende Abneigung gegen Nikotin in dieser Zeit ein —, so steigert dies noch die Gefahr der Tot- und Fehlgeburten, zumal das Nikotin in der Uterusmuskulatur Krämpfe zu erzeugen vermag, die zu Aborten führen.
175
Aber auch der Embryo selbst wird dadurch noch weiter geschädigt. Raucht die Mutter, so bleibt ihm gar nichts übrig, er muß mitrauchen. Denn das Nikotin geht in das Fruchtwasser über und ebenso auch in die Frucht. Kaum hat sich die Mutter eine Zigarette angezündet, so nimmt auch schon der Herzschlag des Embryos bis zu zehn Schlägen in der Minute zu. Aber noch schlimmer als dies: Mit der Entbindung wird dem Neugeborenen mit einem Schlag das Nikotin entzogen. Wie will man dies verhindern? Man kann dem Säugling nicht als erstes eine Zigarette anbieten. Nur wenn die Mutter stillt und mittels der nikotinhaltigen, ausgesprochen vitamin-C-armen Milch ihr Kind weiterhin mit diesem Gift versieht, können solche akuten Entziehungsschädigungen vermieden werden. Auch Alkohol geht in die Milch über.
Zwei Feinde lauern im Tabak: das Nikotin und für den, der inhaliert, der Teer.
Daß bei Rauchern häufiger als bei Nichtrauchern Lippen- oder Zungenkrebs entsteht, ist schon lange bekannt. Große Beunruhigung hat in den letzten Jahren der Lungenkrebs hervorgerufen. Seit 10 Jahren hat er um das Dreifache, seit 40 Jahren um das Zehnfache bis zum Dreißigfachen zugenommen. Die Männer sind heute fünfmal so stark beteiligt wie die Frauen: 1905 war das Verhältnis 3:1. Man darf erwarten, daß die Frauen in den nächsten Dezennien, wenn die heutige Jugend krebsreif geworden ist, aufgeholt haben werden. In den nordischen Ländern, in denen die Frauen schon seit längerer Zeit beim Rauchen stark beteiligt waren, trat der Anstieg des Lungenkrebses bei der Frau auch schon früher ein, bei uns erst in den letzten Jahren. War der Lungenkrebs vor einigen Jahrzehnten noch die seltenste Krebsart, so rückt er heute an erste Stelle. In England sterben jährlich 10.000 daran. Von den 70 Millionen Deutschen erliegen etwa 1 Million dem Lungenkrebs.
»Beinahe 60% aller Krebse bei erwachsenen Männern liefert heute noch der Magenkrebs.« So schrieb ich in der ersten Auflage und habe diesen Satz absichtlich hier stehenlassen, nur habe ich »liefert« in »lieferte« ändern müssen (siehe vorn). Denn nach einem Jahr war bereits eine Korrektur nötig: »Damit steht das Bronchial-Karzinom unter den Krebstodesfällen mit Abstand an der Spitze und hat bei Männern das früher führende Magen-Karzinom weit hinter sich gelassen.« (E. Frey.) Ein erschreckender Siegeszug des Lungenkrebses.1)
1) Die Med. Akad. Düsseldorf stellte zwischen 1920-23 fest, daß der Anteil des Lungenkrebses 4 % betrug. 25 Jahre später (1946-50) war er auf 31 % gestiegen.
176
Es ist naheliegend, den Grund für die Häufung des Lungenkrebses in der Zunahme des Zigarettenrauchens zu sehen. Der Verbrauch an Zigaretten ist in USA seit 35 Jahren auf mehr als das Fünffache gestiegen. Eine Senkung der Zigarettensteuer führte zu einer 40prozentigen Steigerung des Konsums. Es wurde festgestellt, daß 95 Prozent aller Lungenkrebspatienten seit mehr als 20 Jahren sehr viel geraucht hatten und daß 85 Prozent ausgesprochen stark Raucher und nur wenige Prozent Nichtraucher waren. Starke Raucher erkranken doppelt so häufig wie der Durchschnittsraucher1.
Entscheidend dabei ist aber immer das Inhalieren. Ein starker Zigarettenraucher hält, wenn er inhaliert, in zwanzig Jahren etwa 3 bis 4 kg Teerprodukte in seiner Lunge zurück. Bei besten Filtern mindert sich diese Menge etwas. Aber wesentlich zurückgehalten werden die höheren, aromatischen, krebserzeugenden Kohlenwasserstoffe durch keinen Filter. Diese Brenzpyrene kommen auch reichlich in der Großstadtluft vor. Sie sind aber hier relativ unschädlich, da sie an Ruß gebunden sind und daher von der Lunge nicht resorbiert werden.
Wer nicht inhaliert, nimmt keinen Teer in den Körper auf. Gegen Nikotin kann man sich schützen durch gute Filter; gegen Teer nur durch Nichtinhalieren. Die sonst so tyrannische Mode wird jetzt von der Amerikanerin, die um ihre Lunge fürchtet, kommandiert: Man raucht die kleine Pfeife. Diese hat zwei Vorteile: Man inhaliert nicht und man raucht nicht. Man raucht insofern nicht, als alle Zeit dazu verwendet werden muß — insbesondere bei einer zierlich kleinen Pfeife —, zu stopfen, anzuzünden, zu säubern, auszuklopfen, wieder zu stopfen und wieder anzuzünden, so daß das Rauchen selbst nur noch kultische, aber keine faktische Bedeutung hat.
Man muß aber damit rechnen, daß unter den Zusätzen, mit denen man den Tabak versieht, noch manche Stoffe sind, die bei Temperaturen von 7000 zu Giften werden. Zwischen A und Z, zwischen Angelika und Zimt, gibt es einige Dutzend solcher Beimengungen. Dazu kommt immer eine starke Anreicherung von Kohlenoxid im Blut. Der Kettenraucher ist auch von dieser Seite stark bedroht.
Neuerdings wurde festgestellt, daß auch der Nichtrauchende durch dauernden Aufenthalt in verrauchtem Räume geschädigt werden kann.
Ebenso wie Tabakteer wirken auch die Auspuffgase schlechter Verbrennungsmotore. Auch hier droht Lungenkrebs, und nicht nur dem Chauffeur.
Wenn man beim Kaffee das Koffein anklagt, so hat man nur den einen der zwei Attentäter gefaßt. Der andere besteht in der äußeren Schicht der Kaffeebohne, in der Wachshaut, die bei der unvollkommenen Verbrennung beim Röstprozeß giftige und süchtig machende Stoffe bildet.
1) An Lungenentzündung und Influenza sterben viermal so viel Raucher wie Nichtraucher.
177
Eine neue Droge ist gefunden, die den Menschen süchtig machen und seine Persönlichkeit zerstören kann: das Meskalin. Es wird aus Kaktus gewonnen, kann aber auch schon synthetisch hergestellt werden. Bisher wurde es bei Geisteskranken zum Testen verwendet. Jetzt soll es dem Normalen zu einer Art Gefühlsprothese werden, die den durch Quantität der Erlebnisse Lahmgewordenen wieder zwischen allen Höhen und Tiefen der Empfindungen hin und her zu werfen vermag, und ihn ahnen läßt, wie herrlich es ist, verrückt zu sein. Seine Wirkung auf verschiedene Menschen ist sehr verschieden. Aber auch in ein und demselben Menschen sind die hervorgezauberten paradiesischen Träume nur durch eine dünne Papierwand von den Qualen der Hölle getrennt, und bisweilen scheinen sich diese zwei Welten auch völlig zu mischen.
Wiederum hat ein Tor sich auf getan, durch das die Flucht aus der Wirklichkeit und aus der Verantwortung gelingt. Welche Verführung: Eine Dosis Meskalin — und man spielt eine Zeitlang echte Schizophrenie. So wird gelegentliches Irresein künftig zur Liebhaberei des modernen Menschen, zur Belustigung, zum Gesellschaftsspiel.
Der Mensch hat allerlei Genußgifte in der Natur gefunden. Wer wollte deshalb der Rebe, die einen köstlichen Wein gewinnen läßt, fluchen, wer über die Kaffee- oder Teestaude den Stab brechen. Warum sind alle Abstinenzler Fanatiker? »Nur die Dosis macht es, ob etwas Gift ist«, sagt schon Paracelsus. Hat der Mensch die Zivilisation so weit vorgetrieben, daß für ihn die Versuchung, zu Reizgiften zu greifen, wächst, so muß er auch die sittlichen Kräfte entwickeln, den Wein zu genießen, ohne sich zu betrinken.
Abstinenz ist gut, Mäßigkeit ist nicht schlechter und übt die Tugend. Nur die gesegnete Frau muß sich enthalten um des Kindes willen. Aber die süchtig machenden Stoffe muß jeder meiden, wenn er sich nicht der furchtbaren Qual aussetzen will, den Zerfall und Verlust seiner Persönlichkeit erkennen zu müssen.
Die Stadt
Eine gefährliche Krankheit, die alle Kontinente bereits befallen hat, ist die der Verstädterung. Was sind Millionenstädte anderes als »eitrige Geschwüre«, die dem Volkskörper alle Kraft nehmen und ihn schließlich zum Erliegen bringen? Riehl hat der Stadt Paris dieses Prädikat erteilt. — Gilt es nicht für alle Großstädte?
Derselbe Gewährsmann wies aber auch eindringlich auf die Vorteile dieser Ballung menschlicher Energie und menschlichen Könnens in den Großstädten hin: "Riesen-Enzyklopädien der Kultur und der gesamten wirtschaftlichen und technischen Fähigkeiten«, der guten, ebenso allerdings auch der Raubtierinstinkte; Förderungsstätten des geistigen Stoffwechsels; Werkstätten, in denen der Strebende sich mit Macht hinaufgestoßen fühlt." — Auch so kann und muß man die Städte sehen.
178
Gewiß ist es verdienstlich, drohende Gefahren klar zu erkennen und aufzudecken; aber man soll auch das Gute gelten lassen. Die Millionenstädte verlocken allzusehr zu einem summarischen Richterspruch, der dann meist nicht sehr schmeichelhaft ausfällt. Viel Gutes wird dabei übersehen, viel Schlechtes als unabwendbares Fatum angesprochen. Und auch der, der den Typus des Großstädters zu fassen sucht, unterliegt leicht ähnlicher Versuchung; er neigt zum Extremen; er übersieht die Hauptmasse der Stadtbevölkerung, weil sie ihm zu bieder, zu uninteressant und zuwenig verderbt vorkommt, um ein markantes Gegenstück zum Landbewohner abgeben zu können. Viel »dankbarer«, weil mit lebhaftestem Kolorit versehen, ist bei solcher Betrachtung die Hefe und die Unterwelt der Großstadt, die Hochstapler, Zuhälter, Verbrecher und Dirnen. Der Sensationsfreudige sieht die Straßen von Berlin und Hamburg von solch aufregenden Gestalten wimmeln.
Immerhin, hier muß man als Arzt denken. Leidet unter bestimmtem Milieu und Seelenklima nur eine der lebenswichtigen Funktionen des Körpers in unabänderlicher Weise, so ist dieses Klima eben Verderb. Ob es daneben Vorteile bietet, kann dann nicht mehr zählen; ebensowenig wie gesunde Lungen, unverwüstlicher Magen und prächtige Muskeln zu helfen vermögen, wenn Herz und Niere oder auch das Gehirn krank sind. Das untauglichste Organ entscheidet jeweils über die Leistungsfähigkeit des Körpers.
Es ist, als ob die Natur selbst sich gegen den Großstädter verschworen hätte, sein Selbstzerstörungswerk noch zu vollenden. Jede Großstadt hat eine respektable Dunsthaube. Diese ist nicht nur unangenehm, sie ist auch ungesund. Wohl hat man sich geirrt, wenn man ihr eine besonders starke Absorption der ultravioletten Strahlen zuschrieb. Aber richtig bleibt es doch, daß der Städter, der den ganzen Tag hinter Fensterscheiben verbringt, schon dadurch von den ultravioletten Strahlen völlig abgeschlossen wird. Außerdem ist in tiefen Straßenschluchten der Anteil der ultravioletten Strahlen sehr viel geringer als oben auf den Dächern, wo all die Messungen vorgenommen worden sind. Dazu kommt, daß ein kräftiger »Rußhimmel« 20 bis 30 Prozent aller Strahlen vorweg zu absorbieren vermag.
In Wien waren im Jahre 1917 90% der Neugeborenen rachitisch, in Frankfurt 70%, in Basel im Winter 75 Prozent, im Sommer 50 Prozent, im Durchschnitt 62 Prozent. Je größer die Stadt, desto höher das Defizit an ultravioletten Strahlen.
179
Diese aber sind das beste Bekämpfungsmittel der Rachitis durch Aktivierung des Ergosterins und Umwandlung in D-Vitamin in der Haut. Nur einige Minuten täglicher Sonnenbestrahlung können schon vor Rachitis schützen. Das »biologische Dunkel« der Großstadt verhindert aber während des Winters bisweilen wochenlang die Einwirkung von U-Strahlen.
Nicht nur Herz, Leber und Lunge sind von großer Bedeutung, sondern auch die Haut. Und auch sie stellt ihre Bedingungen, wenn gute Funktion von ihr verlangt wird. Berührung mit der Luft, Besonnung, Wettereinwirkung, Reizklima, all das ist ihr bekömmlich. Das Reizklima fehlt aber in der Stadt; ebenso die Sonne; und vor dem Wetter schützt man sich. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind in der Stadt erheblich ausgeglichener. Karlsruhe, eine mittelgroße Stadt, zeigt an heißen Sommertagen gegen Mitternacht gegenüber einer Vorstadt (Rüppurr) eine Temperaturdifferenz von etwa 6°. Es bleibt in der Stadt auch während der Nacht sehr warm.
Der Mangel an kurzwelligem Licht macht aber auch nervös, gereizt und explosionsbereit. Das Licht, dem der Großstädter ausgesetzt ist, zeigt eine starke Verschiebung gegen Rot hin. Blau beruhigt, Rot regt auf (jedoch nicht auch den Stier, der nur auf die Bewegung der Capa, nicht auf ihre Farbe reagiert). Und doch, wie sehr hätte es gerade der Großstadtmensch nötig, unter den beruhigenden Strahlen des blauen Lichtes zu spazieren. Die Juckflechte (Neurodermitis) tritt vor allem beim Städter auf.
Deutlich reagieren auch Baum und Strauch auf das Großstadtklima. Sie zeigen stark verminderte Fruchtbarkeit, obwohl sie eine Woche früher als auf dem umgebenden Land zu blühen beginnen, obwohl die frostfreie Zeit bis zu acht Wochen verlängert sein kann und obwohl die Großstadt einen Sommer gewährt, der eine Woche länger dauert — mit dem Thermometer gemessen. Daran ist keineswegs nur die Dunsthaube schuld. Sie ist wohl berühmter und populärer geworden, als sie es verdient. Denn schließlich ist das ganze Klima der Stadt verändert und wirkt sich aus. Das Wasser läuft schneller ab, so daß schon kurze Zeit nach einem starken Regen der Boden wieder völlig trocken ist; der Wind wird durch die Häuserreihen gebrochen, und die Tag- und Nachttemperaturen werden in den Städten stark ausgeglichen.
Diese Unnatur von wüstenartigem, trockenem Klima, von Zugluft in den Straßenzügen statt gleichmäßiger Windbewegung, von Gerüchen, bisweilen auch von Gestank und von einer mit Gewerbestaub verschiedenster Herkunft beladenen Luft, die nie richtig ventiliert und abtransportiert, sondern nur von Straße zu Straße hin und her geschoben wird, vereinigt sich mit der Gewohnheit des Menschen, jedem Luftzug auszuweichen, sorgsam den »Stubenluftkörper« zu bewahren, auch beim Schlaf die Fenster geschlossen zu halten, und aus der winterlichen Temperatur die Konsequenz zu ziehen, seinen Arbeitsraum zu überhitzen und sich möglichst wenig Bewegung zu machen, dafür aber erheblich mehr zu essen, als nötig ist.
180
Die Zentralheizung sorgt dafür, daß alle Räume, auch der Flur, gleichmäßig temperiert sind, so daß die Fähigkeit der Wärmeregulierung im menschlichen Körper mangels Beanspruchung vollständig einschläft. Zur Zeit, als kein Koks für Zentralheizungen zu bekommen war, fehlten viele chronische Winterpatienten bei den Ärzten, weil sie — ähnlich wie die Soldaten im Feld — nichts mehr mit Erkältungen zu tun hatten.
Die durch Zentralheizung verbrannten Staubteile stellen neben der allzu trockenen Luft eine weitere Belastung der Atmungsorgane dar.
Wie beneidenswert also unsere Urväter! Sie wußten in ihren gut durchlüfteten Höhlen nichts von Schäden durch Zentralheizung. Sie haben uns aber Skelette hinterlassen, die starke Zeichen chronischer Gelenkentzündung tragen. Es ist also doch fraglich, ob die Zivilisation uns eine Behausung geschenkt hat, die weniger gesund ist als die Höhle oder das Blätterdach. Bleiben wir also in unserer behaglichen Wohnung und sehen, was sich daran bessern läßt.
Auch über unsere Kleidung lohnt es nachzudenken, nicht etwa, um sie modischer, sondern um sie noch gesünder zu gestalten. Vergleichen wir uns mit den Perückenträgern des Rokoko, so stellen wir schon ermunternde Fortschritte fest. Immerhin tragen wir Männer im Sommer noch ein ausgesprochen tropisches Klima in unseren Hosen mit uns herum, während sich die Frauenwelt mit den Subtropen begnügt. Daß unser »Kleidungsluftkörper« noch als mangelhaft empfunden wird, zeigt der Siegeszug der luftigen oberbayerischen Hosen bis zum Nordkap und in die USA.
In der Renaissance legten die Menschen Wert darauf, auf der Bühne des Lebens möglichst eindrucksvoll und gravitätisch zu spazieren; und doch hatten sie noch keine Absätze. Man kann also auch zivilisiert sein, ohne auf hohen Sockeln zu balancieren und dadurch eine Verkürzung der Achillessehne, eine Beeinträchtigung der Lendenwirbelsäule, eine Überanstrengung der Streckmuskeln am Rücken und eine bedenkliche Erschlaffung der Bauchmuskeln in Kauf nehmen zu müssen.
Dagegen ist als zivilisationsbedingt der Zwang für den Städter anzusehen, auf künstlich gehärtetem Boden, auf Pflaster und Asphalt zu gehen. Die Fußbewegungen sind auf der planierten Straße immer dieselben, während beim Steigen auf einem Jägerpfad, um einen scharfen Gegensatz aufzuzeigen, jeder Tritt andere Muskeltätigkeit herausfordert. Der harte Stoß eines jeden Schrittes in der Stadt setzt sich vom Fuß bis in den Kopf fort und führt zu ständigen Erschütterungen des Gehirns. Auf die Dauer verlieren die Bänder ihre Dehnbarkeit und die Gelenke ihre Elastizität.
Nicht nur das Pferd wird pflastermüde. Der Mensch noch mehr, zumal sein Gehirn infolge des aufrechten Ganges stärker in Mitleidenschaft gezogen wird.
181
Reizklima erhöht die Atem-Intensität. Der durch das Klima nicht gereizte Städter gewöhnt sich an ein verflachtes Atmen. Wenn es richtig ist, daß die Krebszelle durch Sauerstoffmangel entsteht, so könnte die Krebshäufigkeit in der Stadt zum Teil darin ihre Erklärung finden.
In New York konnte man bei Verkehrspolizisten feststellen, daß schon nach achtstündigem Dienst auf belebtem Platz ihr Blut in lebenbedrohendem Maße mit Kohlenoxydgas belegt war. Eine durchgehende Dienstzeit von sechzehn Stunden würde allein schon daran scheitern, daß die Bedauernswerten bereits vor ihrer Ablösung erstickt sein würden. Wird dieses Gas eingeatmet, so geht es eine sehr innige Verbindung mit dem roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin, ein, so daß dieses für den Sauerstofftransport ausfällt. Dies kann zur Erstickung führen. Die Auspuffgase enthalten 7% Kohlenoxid und mehr. Bei einer Verdünnung auf das Hundertfache kann in 2 Stunden bereits 50% des Blutfarbstoffes festgelegt sein, bei zweihundertfacher Verdünnung in 4 Stunden 30% des Blutes. An Verkehrszentren findet man bis zu 0,03 % Kohlenoxyd in der Luft. 0,2 % sind bereits tödlich. Die Empfindlichkeit ist sehr verschieden. Jugendliche und Kinder sind besonders gefährdet. Auch schon viel geringere Dosen beeinträchtigen den Organismus. Bei Verkehrsbeamten hat man eine 20-prozentige Bindung des Blutfarbstoffes durch Kohlenoxyd festgestellt. In Stockholm zeigen 50% der Chauffeure deutlich eine chronische Kohlenoxydvergiftung.
Kohlenoxid schädigt außerdem die Blutbildungsstätte, das ist das Knochenmark. Darin wird es noch unterstützt von Benzin- und Benzolgasen, die ebenfalls diese Blutfabrik treffen. Und schließlich gilt dasselbe auch noch für Bleidämpfe, die allerdings außerdem noch verschiedene andere Organe schädigen (Schrumpfniere, Blutdruckerhöhung). Blei ist als Antiklopfmittel bis zu 0,5 cm3/l häufig dem Benzin zugesetzt (als Bleitetraäthyl) und erscheint wieder in den Auspuffgasen. Der feine Bleistaub bleibt lange in der Luft schweben. Verhängnisvoll ist, daß Blei zum größten Teil (98%) im Knochenmark zurückgehalten und gespeichert wird. Dazu kommt, daß der Mensch der Stadt täglich schon ½ mg Blei aus Luft, aus Nahrung usw. aufnimmt. Die Schädlichkeitsgrenze kann daher durch solchen Zuwachs aus den Auspuffgasen eher erreicht werden.
Schlechte Verbrennungsmotore liefern außerdem Stoffe, die wie Teer Lungenkrebs zu erzeugen vermögen.
182
Damit ist noch nicht alles aufgezählt, was ausgepufft wird und was die Betroffenen Sanatoriums- und krankheitsreif zu machen vermag.
Ein alter Motor verbraucht viel Öl, das zum Teil als Öldämpfe im Auspuff erscheint. Eine imponierende Liste von Atemgiften. Am meisten von ihnen ist jedoch das Kohlenoxid zu fürchten. Neben augenblicklicher Übelkeit oder Unbehagen setzt es »kleine, für sich allein unauffällige Einzelschäden, die sich summieren und chronische Vergiftungen bedingen« (Blume).
Die Wirkung der Öldämpfe ist aber auch nicht leicht zu nehmen. In verkehrsreichen Straßen ist schon nach zweistündigem Aufenthalt bereits ein Zehntel der resorbierenden Fläche der Lunge mit öl überzogen und dadurch merklich im Gasaustausch behindert. Die Öldämpfe rufen außerdem eine Reizwirkung in den Lungenbläschen hervor. Dazu kommt die psychische Einwirkung, die sich auch wieder physiologisch in zu flacher Atmung äußern kann.
Am ernstesten wird unsere Gesundheit bedroht von den schweren Lastzügen mit ihren qualmenden Motoren. Dieses Konzentrat giftiger Gase wirkt nicht nur in geschlossenen Straßen der Stadt, sondern auch im offenen Gelände. Die Bundesbahn hat auf Autostraßen darauf hingewiesen; sie mußte aber die Plakate wieder entfernen lassen.
Aber auch noch andere kräftige Ingredienzen gehören zur Stadtluft. Schwefeldioxyd, das den Schornsteinen entströmt, wird bei feuchter Luft (Nebel) zu schwefeliger Säure. Zum Londoner Straßenbild gehört bereits die Nebelmaske, deren sich schon die Mode bemächtigt hat. Für Damen wird sie in verschiedenen Mustern geliefert; vor allem aber wollen die Farben auch hier wie bei allen Maskierungen der Damen sorgfältig ausgewählt sein.
Es kann aber noch schlimmer kommen. Manche großen Städte produzieren noch ein viel stärkeres Gift, den Smog (= smoke Rauch und fog Dunst). Los Angeles mit seinen 2½ Millionen Autos leidet wohl am meisten darunter (100 Tage im Jahr). In jeder Wohnung wird der Müll in besonderen Müllöfen verbrannt. Diese Abgase (Stickoxyde) verbinden sich bei Licht mit unverbrannten Autogasen (Kohlenwasserstoffen), wie sie beim Leerlauf der Motore vor Rotlicht entstehen. So bilden sich hochgiftige Ozonide. Daß diese die Pneus brüchig werden lassen, ist unwesentlich. Daß sie Pflanzen vernichten, ist sehr bedauerlich. Daß sie für den Menschen 1000mal giftiger sind als das gefürchtete Kohlenoxydgas, ist erschreckend. Scheint die Sonne stark, so muß oft Alarm gegeben werden: die Müllöfen sind dann sofort zu löschen. Die zweite Alarmstufe fordert Abstellen aller Automotoren. Giftalarme in paradiesischer Landschaft.
183
Über die direkte Gefährdung des Automobilisten und der Passanten durch das Auto informiert zur Genüge ein Blick in die Tageszeitung. In Deutschland forderte das Auto bereits vor dem Krieg jährlich 8000 Tote und 160.000 Verletzte. Dies entspricht den Jahresverlusten eines großen Krieges. Die Verluste durch das Auto waren also damals schon so, wie wenn alle zivilisierten Staaten dauernd miteinander im Kriegszustand leben würden. Unter den Verkehrstoten sind zehnmal soviel Motorradfahrer wie Autofahrer.
Zur Großstadt gehört das Auto. Und zu diesem die Entwöhnung vom Gehen und vom Wandern in der Natur. Aber nur dem Fußgänger erschließt sich die Natur und hält mit ihm Zwiesprache. Jeder Organismus ist auf seine Eigengeschwindigkeit abgestimmt. Leiht er sich eine fremdartige Geschwindigkeit aus, so entsteht eine Diskrepanz mit der Leistung der Nerven. Die Welt wird zu einem allzu schnell abrollenden Film, der zur Oberflächlichkeit verführt. Das Menschsein kommt zu kurz.
Die Großstadt züchtet das materialistische Denken. Nur hier konnte aus dem schönen »Gesegnete Mahlzeit« ein dummes, sinnloses, nur materialistisch-sinnvolles »Mahlzeit« werden. Daß dieses nach Abschaffung des »Heil Hitler« wieder zur Herrschaft gelangte, stellt dem Stumpfsinn ein glorreiches Zeugnis aus, ebenso der Gesundheit, der sich das materialistische Denken immer noch erfreut. Mahlzeit! Von morgens bis abends. Der Ausländer fragt erstaunt, was damit gemeint sein soll. Man wird ihm erklären, es bedeutet »essen«, bei dauerndem Gebrauch auch »fressen«. Und man wird entschuldigend hinzufügen: Die meisten denken sich gar nichts bei diesem seltsamen Gruß. Gibt es noch irgendwo in der Welt eine gleich abstoßende Grußformel?
Vielleicht das aufdringlichste Charakteristikum der Stadt ist heute noch der Spektakel.
Zur Hauptverkehrszeit übersteigt der Lärm, der etwa 80 Phon, 90 Phon (Preßhammer) und mehr erreicht, bereits die gesundheitsbedrohende Grenze, die etwa bei 72 Phon liegt. Nicht allein das Ohr wird betroffen, auch das ganze Nervensystem und damit die nervöse Steuerung des Herzens, des Blutdruckes, der Magensekretion und anderer Organe. Puls, Blutdruck, Atmung und Muskelspannung werden gesteigert, Hauttemperatur und Magen- und Darmperistaltik erniedrigt. Besonders aber wird die geistige Leistungsfähigkeit herabgesetzt.
Das Gehirn des Städters, von dem immer Höchstbereitschaft gefordert wird, ist aber nicht allein durch akustische Reize ständig überbeansprucht und dadurch in seiner Leistung geschwächt. Mit dem Lärm vereinigt sich der nervenaufpeitschende Tanz der Reklamelichter. Bedauernswerte Kreaturen, die in solchem Hexensabbat ständig zu leben gezwungen sind!
Und doch muß man sich hier eine Frage vorlegen:
Sicher bedeutet die Zivilisation mit all ihren technischen Errungenschaften eine außerordentliche Nervenanspannung, die den Blutdruck erhöht, Zuckerkrankheit fördert und die allergischen Krankheiten häufiger werden läßt. Aber — würden wohl die Menschen der Biedermeierzeit, deren Nerven unverbraucht waren, leichter einen vierjährigen Schützengrabenkrieg und dann mit Frauen und Kindern einen Bombenkrieg ausgehalten haben?
Die Zivilisation beansprucht die Nerven, das ist wohl richtig. Sie trainiert sie aber auch oder stumpft sie ab.
Trotzdem — wenn auch durch richtige Ernährung sich manche der erwähnten Krankheiten der Großstadt wohl etwas eindämmen lassen, so ist doch mit allen Mitteln gegen diese Auswüchse anzukämpfen.
Eine Befürchtung kann allerdings nicht unterdrückt werden:
Der Großstädter ist bereits weitgehend verbildet, er will nicht beruhigt sein. Seine Art von Wachsein verlangt nach ständigen Reizen; er kann nicht mehr anders. Selbst bei der Erholung und bei dem Genießen bleibt es bei Hast und Eile. Aber dieses gesteigerte Wachsein gilt nur seinen Sinnesorganen. Um so tiefer schläft die Seele. Der Mensch kann nicht gleichermaßen gesteigert nach außen und nach innen leben. Die stärkere Durchblutung der Aufnahmeapparate bedingt Blutleere des Gefühlslebens. Daher die ständig drohende Langeweile.
184
#
(d-2014:) mal bei den textstellen einordnen
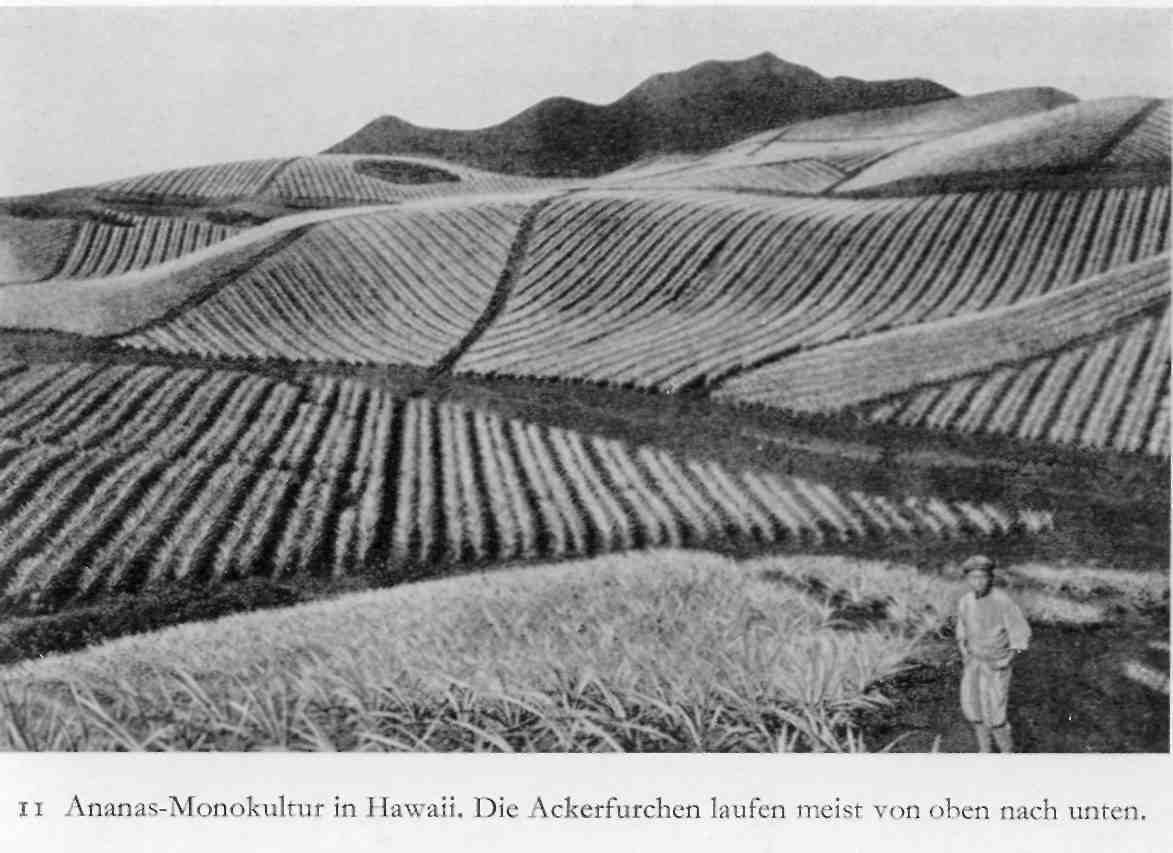

(1957) Professor Reinhard Demoll