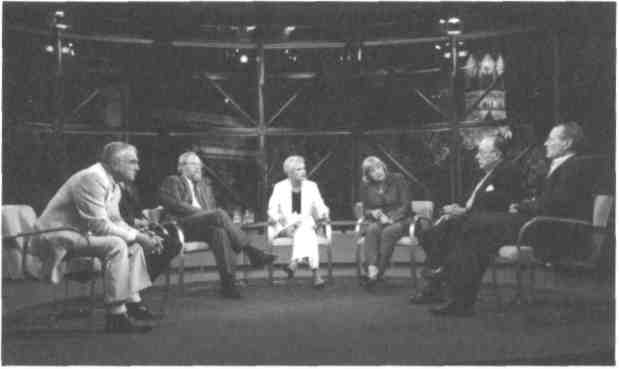
Henrich-2019
Verspäteter Widerstand durch herabsetzendes Nachstellen Zonen des Verdachts Wie sieht nun die Bilanz aus?
#
Deutschsein in Europa
338-369
Auch die anpassungsfähigsten SED-Funktionäre, also jene, die noch immer in den Ämtern ausharrten, begriffen zum Jahresbeginn 1990, dass sie ihre Schreibtische bald würden räumen müssen. Die »Arbeiter-und-Bauern-Macht« war perdu. Denn die Menschen, die in Leipzig, Dresden, Plauen und all den anderen Städten demonstrativ von sich behaupteten, sie seien das Volk, erkannten in der DDR-Regierung und deren Apparat nicht mehr ihre Regierung. Ein über Jahrzehnte durchgehaltener Schwindel flog endgültig auf; ein Schwindel, von dem zuletzt jeder gewusst hatte und der dennoch das politische Leben östlich der Elbe lange lähmen konnte, bis die Dinge endlich lautstark beim rechten Namen genannt wurden und die Massen feststellten: Der Kaiser ist nackt! Was nichts anderes hieß, als dass es auch der weiterwurstelnden Modrow-Regierung so wie ihren Vorgängern an jeglicher Legitimation mangelte. Die einst zu Mündeln des vormundschaftlichen Staates degradierten Bürger nahmen das Land per Akklamation nun in ihre Obhut, indem sie sich auf der Straße als Volk beschworen.
Aber wer war das Volk? Und was bedeuteten eigentlich die jetzt skandierten Parolen »Wir sind ein Volk« und »Deutschland, einig Vaterland«? Wer war das »Wir« dieses Volkes? Die Akklamation des Volkswillens auf den Straßen der zur res publica verwandelten sozialistischen Republik litt doch ersichtlich darunter, dass es sich dabei um eine einseitige Willenserklärung handelte. Denn zu dem Volk, auf das die Demonstranten lautstark rekurrierten, gehörten schließlich ebenso die Brüder und Schwestern westlich der Elbe. Die aber hatten sich, wie wir es nun in zahlreichen Begegnungen erleben durften, in ihrem Rumpf-Deutschland bestens eingerichtet. Bei aller historischen Erinnerung war ihnen Brüssel näher als Leipzig, Washington vertrauter als Ostberlin und Mailand lieber als Weimar. Die sich darin ausdrückende Geschichtsvergessenheit führte zu skurrilen Erlebnissen. In München fragte mich beispielsweise die Frau eines Freundes, ob ich »das erste Mal in Deutschland« sei.
Über die nationale Identität eines vereinigten Deutschlands hatte ich mir bereits seit längerem den Kopf zerbrochen und mit Freunden diskutiert. Öffentlich stellte ich meine Überlegungen dazu am 19. März 1990 im Nationaltheater Weimar zur Diskussion. Hier, am Ort der verfassungsgebenden Versammlung von 1919 eine illustre Runde bekannter Intellektueller aus West und Ost zusammenzubringen, damit sie sich darüber austauschen konnten, was sie sich von einer deutschen Einigung erhofften, war eine Initiative, welche im Haus Rolf Kreibichs in Westberlin aus der Taufe gehoben wurde. Kreibich leitete das Sekretariat für Zukunftsforschung. Seit dem Mauerfall lud er regelmäßig zu sich ein, und es gelang ihm jedes Mal, tatkräftig unterstützt durch seine Frau Renate, eine freimütige Gesprächsatmosphäre herzustellen.
Zu Kreibichs Gästen gehörte Christoph Zöpel, der Minister für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr aus Nordrhein-Westfalen. Zöpel war unter uns vermutlich der Einzige, der - belehrt durch den schmerzhaften Strukturwandel im Ruhrgebiet - genauer wusste, mit welchen Schwierigkeiten man beim Umbau der volkseigenen Wirtschaft in den nächsten Jahren im Osten rechnen musste. »Da wird das Gemeinschaftsgefühl der Deutschen auf die Probe gestellt werden«, prophezeite er und entwickelte gemeinsam mit der Journalistin Lea Rosh die Idee einer Zukunftswerkstatt. Ich fand ihr Anliegen angesichts der verbreiteten Einfallslosigkeit über Deutschlands zukünftigen Weg begrüßenswert. Die Frage »Wer sind wir?« musste jetzt neu gestellt werden, wenn man damit aufhören wollte, das zu tun und zu sein, was uns die Siegermächte vorgeschrieben und im Rahmen der Umerziehung eingebläut hatten. In einem ersten Anlauf wollten wir, so der zügig entworfene Plan, in Weimar europapolitische Aspekte der deutschen Einheit behandeln. Da Kreibich meinte, das Grundsatzreferat Deutsch-Sein in Europa müsse unbedingt ein »Noch-DDR-Bürger« halten, fiel die Wahl auf mich.
Voller Zuversicht reisten Heidelore und ich nach Weimar. Beim geselligen Abendessen im Elephanten verkündete Lea Rosh unserem kleinen Trupp, wer anderntags alles mit dabei sein würde. Die von ihr verlesene Namensliste imponierte mir:
339
Margherita von Brentano di Tremezzo, die »rote Maggie« der Freien Universität, der von mir bewunderte Publizist Peter Bender, Erhard Eppler vom Parteivorstand der SPD, der Schriftsteller Rolf Schneider, der in meinem Freundeskreis viel gelesene Psychoanalytiker Eberhard Richter, der SDS-Veteran Tilman Fichter, die Dramaturgin Gisela Kahl, Christoph Stölzl, der spätere Direktor des Deutschen Historischen Museums, Hans Christoph Binswanger aus St. Gallen, den ich wegen seines Buches »Geld und Magie« immer schon mal kennenlernen wollte, der Physiker Klaus Traube, Monika Griefahn von Greenpeace.
Wie hatte Lea sie nur alle zum Kommen überredet? Ich war heilfroh an diesem Abend, dass ich mein Referat schriftlich ausgearbeitet hatte. (Unter dem Titel »Deutsch-Sein in Europa. Ein Streitgespräch« hat der Forum Verlag Leipzig den vollständigen Text und sämtliche Redebeiträge der vorstehend Genannten abgedruckt.)
Als ich am nächsten Morgen zum Rednerpult schritt, war der Saal überfüllt. Ein beachtlicher Teil des Publikums begnügte sich mit Stehplätzen, lehnte an den Wänden oder saß auf den Treppenstufen. Es würde ein Heimspiel für mich werden - das hörte ich sofort aus dem mich begrüßenden Beifall heraus. Ich strapazierte die Ohren meiner Zuhörer eine knappe Stunde. Mein Unmut über die in beiden deutschen Reststaaten grassierende Geschichtsvergessenheit war sicherlich einer der Gründe, warum ich so sehr betonte, die Deutschen seien für mich im Unterschied zu den Franzosen in ganz wesentlicher Hinsicht eine Sprach- und Kulturgemeinschaft, weniger eine ethnisch wurzelnde Volks- oder Staatsnation.
»So gesehen«, darauf beharrte ich, »ist man nicht Deutscher in Mitteleuropa. Sondern: Man wird es, indem man mitteleuropäisch denkt, fühlt und handelt.« Und das herumspukende Schreckgespenst eines neuen Nationalismus könne man nicht bannen, wenn man in multikulturelle Beliebigkeit verfalle, sondern nur durch ein der Menschenbildung förderliches nationales Wir-Bewusstsein. Zusammengehörigkeitsgefühl, Heimat und Herkunft stünden für mich nicht gegen Weltoffenheit; Respekt gegenüber anderen würde sich eher einstellen, legte ich dar, wenn man das modische Naserümpfen über das Eigene endlich lassen und die bei allem 12-jährigen Unheil kulturvolle deutsche Vergangenheit achten und hochhalten würde. Wie ein kostbares Erbe, das man mit den zu uns Kommenden gern teilen wolle.
340
Herders staatsphilosophische Aussage, wonach die Pluralität der Nationen das Europas Eigenart charakterisierende Spezifikum sein müsse, erklärte ich zu einer Wegmarke, an der sich jedes Denken über die Zukunft Europas ausrichten müsse. Herders Abneigung gegen jede die nationale Vielfalt nivellierende Ordnung teilte ich uneingeschränkt, denn wohin eine zentralistisch-bürokratische Konstruktion führt, das hatte unsereiner ja nun wirklich in der gewaltsam zusammengeschweißten Lagerwelt unter Moskaus Aufsicht gelernt. Ich bestand darauf, dass für die jetzt zu leistende staatlich-politische Einheitsstiftung in Einigkeit und Recht und Freiheit eine Rückbesinnung auf die geografische Mittellage Deutschlands unverzichtbar sei. Daraus resultiere für mich geo-politisch die anknüpfend an Kants »Idee der Föderalität« formulierte Mission eines vereinigten Deutschlands bei der Schaffung »einer dauerhaften Friedensordnung« mit unseren Nachbarn in Polen, der Ukraine, dem Baltikum, mit Russland und den Tschechen und Slowaken.
Nachdem Lea Rosh die Diskussion freigegeben hatte, sie fungierte als Moderatorin, meldete sich als Erste Margherita von Brentano. Ihre Empörung über mein Referat brachte sie blitzschnell auf den Punkt. »Wie soll das entstehende deutsche Gebilde und wonach seine Identität finden?«, fragte sie empört in meine Richtung blickend. Ihre Antwort fiel knapp aus: »Ich würde sagen: nicht als Nationalstaat. Nämlich überhaupt nicht.« In diesem Stil ging es weiter. Aufgebracht wütete die rote Maggie gegen ein Deutschland, von dem sie selbst augenscheinlich nicht loskam. Hasste sie es in sich? Hasste sie sich?
Mit einem solchen Unwillen, wie er mir von dieser Weisheitsfreundin entgegenschlug, hatte ich nicht gerechnet. Auf Vorbehalte zu stoßen nach all dem Weltanschauungsgerangel, das den Kalten Krieg stets begleitet und vier Jahrzehnte der Nachkriegszeit ausgefüllt hatte, darauf war ich eingestellt. Weshalb Margherita von Brentano sich aber vor einer kulturell flankierten politischen Einigung derart ängstigte, blieb mir völlig unbegreiflich. »Auch kulturelle Identität halte ich für gefährlich«, fauchte sie mir mit geblähten Nüstern entgegen. Was sollte daran schlecht sein? Waren wir nur noch als durch angelsächsische Demokratievorstellungen und amerikanische Kultur geprägte Gesellschaft, als Atlantiker oder Weltbürger gesellschaftsfähig?
341
Es dauerte ein Weilchen, bis ich verstand, dass die Philosophin den von ihr empfohlenen Verfassungspatriotismus - statt eines Vaterlandes sollte ein Text als Heimatangebot ausreichen - deshalb hochhielt, weil sie damit jeglicher Form eines wie immer gearteten Deutschseins alle Luft und jeden Boden entziehen konnte. Ausschließlich und nur auf das Grundgesetz zu setzen, welches ich durchaus für vorbildlich hielt, hieß ja aber nichts anderes, als den von mir beklagten historischen und kulturellen Erinnerungsverlust festzuschreiben.
Als Nächster fuhr mir Tilman Fichter, der SDS-Veteran in unserer Runde, in die Parade. Fichter, der mich unbedingt mit dem zum Chefideologen der SPD emporstrebenden Peter Glotz zusammenbringen wollte, meinte spitz, »den ganzen Vortrag hätte auch Thomas Mann 1948/49 halten können«. Ein Kompliment sollte das nicht sein. Er deutete mir damit an, unsereiner habe die letzten Jahrzehnte hinter dem Mond gelebt. Meine Rede vom Brückenschlag und einer Mittler-Mission Deutschlands hielt er für irregeleitet. »Mit der Geschichte«, so sein Einwand, »die wir in beiden deutschen Staaten zu verarbeiten haben, besitzen wir keine Legitimation, uns aus unserer geopolitischen Position heraus schon wieder eine neue Mission - und diesmal eine demokratische - zu verordnen.« Eine Mission zu reklamieren, und sei es eine Friedensmission, erschien ihm als Teufelszeug. Als Gegenposition zu meinem von ihm verdammten »deutschen Sonderweg« warb er dafür, »dass wir ein ganz >stinknormales< Volk werden - wie beispielsweise die Holländer«. Passender konnte man den geistigen Horizont der westdeutschen Linken nicht beschreiben.
Aus der deutschen Misere heraus sich in eine deutsche Mimikry zu mogeln, fand ich putzig. Ich wusste nicht recht, ob das ein Opera-buffa-Streich sein sollte, zum Ärgern oder zum Lachen. Ein George Grosz hätte ihn und Margherita von Brentano malen müssen. Ihre Gesichter trugen sehr den Ausdruck von Oberlehrern. Nur im Erwerb materieller Güter, in deren Genuss und Verteilung, in Wirtschaftswachstum und quotenträchtiger Fernsehunterhaltung die zukünftige Gemeinschaft und Identität der Ost- und Westdeutschen verankern zu wollen, hieß ja wohl nichts anderes, als sich bis zur Selbstaufgabe zu verleugnen.
Ostdeutschland erschien aus so einem Blickwinkel als Raum ohne Volk,
342
der wie eine leere Einkaufstasche nur darauf wartete, mit westlich der Elbe produzierten Konsumgütern vollgestopft zu werden. Natürlich hofften die meisten Bürger der DDR auch auf eine bessere Versorgung. Jahrelang hatten sie ja davon geträumt - insgeheim oder ganz offen -, irgendwann so zu leben wie ihre westdeutschen Verwandten, aber doch wohl nicht nur. Im Gegensatz zu ihnen konnten die Westdeutschen darauf aber gar nicht hoffen, da sie mit Konsumgütern und der Deutschen Mark bereits gesegnet waren. Was erwarteten sie denn nun eigentlich? Gab es da etwas Verbindendes? War es vielleicht, pathetisch gesprochen, die Rückkehr ins Vaterland?
Christoph Stölzl verteidigte meine Sicht der Dinge. Auf Margherita von Brentanos Ängste ging er gar nicht erst ein. »Die Hoffnung, man könnte ein stinknormales Volk sein«, hielt er Fichter vor, »ist selbst für kleine Völker ein Trugschluss. Nation bezieht sich immer auf die Zukunft und hat Bekenntnischarakter.« Und die Vorstellung, die Deutschen könnten wie die Schweizer werden, wenn sie nur aus der Geschichte austräten und »in die Geschäfte« eintreten würden, diese Sichtweise sei »spätestens seit dem 9. November 1989 erledigt«. Stölzl warnte vor der linksliberalen Drückebergerei, »in einer anonymen westlichen Gesellschaftsordnung verschwinden« zu wollen. Wie ich war auch er überzeugt, dass die Deutschen jetzt genauer sagen müssten, was sie »als Sprach-, als Kulturgemeinschaft mit diesen Übergangszonen nach Österreich, nach Oberitalien, nach Holland hinein wollen«. Es ging eben nicht darum, sich zwischen zwei Wegen - Deutschland übermächtig, Deutschland zwergenhaft - zu entscheiden; eher schon lautete die schicksalhafte Frage, welche Schlüsse jeder für sich in diesen Tagen der Vereinigung ernsthaft aus den deutschen Erfahrungen ziehen würde. Und die seien eben »nicht das Gleiche wie ein Mordmodul in unserem Nationalcharakter«, meinte Stölzl.
Auch meinem Gedanken einer Friedensmission pflichtete Christoph Stölzl bei, darin unterstützt von Rolf Schneider und Erhard Eppler. Letzterer wollte natürlich ebenfalls den Terminus »Mission« meiden. »Keine Friedensmission! Aber ein Land, das sich anstrengt, damit von ihm nur noch Frieden ausgeht. Das wäre ein Stück politische Identität.«
343
Alle drei fanden meine Idee anregend: nämlich »den Schluss«, wie Stölzl rekapitulierte, »aus unserer Geschichte und den beiden extremen Polen unseres Nationalcharakters zu ziehen«. Was grosso modo bedeutete: »Der Nationalcharakter, das hat sich ja gezeigt seit der Gründung des Bismarck-Reiches, ist zu unglaublich gewalttätiger Kraftentfaltung fähig. Und er ist auf der anderen Seite, wenn man hier nach Weimar zurückkehrt, zu Goethe, zu Herder, einmal ein Samen gewesen, friedensstiftende Ideen zu entwickeln.«
Wie viele meiner Freunde bewunderte ich lange Zeit die Stars des westdeutschen Kulturbetriebs. Verglichen mit unseren Klopffechtern an den Hochschulen und in den Redaktionsstuben erschien mir das, was ich von ihnen gelesen hatte, allemal als hinreichender Beweis für ein freiheitlicheres Denken. Seit ich in Weimar aber Brentanos und Fichters maulenden Unwillen gegen jedes Selbstbestimmungsrecht der Deutschen erlebt habe, bröckelte der Lack von diesem Idealbild, das ich mir zusammengeschustert hatte, schichtweise mit jeder weiteren Begegnung ab. Eins habe ich jedenfalls an diesem Weimarer Wochenende gelernt: Was jedem anderen Volk als selbstverständlich galt und fraglos zugestanden wurde, bedurfte auch in einem neuen Deutschland einer sich nach allen Seiten hin absichernden Rechtfertigung. Wer das eigene Land liebte, wurde schnell zur komischen Figur oder gar zu einem Ewiggestrigen abgestempelt.
Auf dem Rückweg nach Berlin fuhr Margherita von Brentano bei Heidelore und mir im Wagen mit. Lea Rosh hatte mich gebeten, sie nach Westberlin zu chauffieren. Ein mit Schneewolken verhangener Himmel passte gut zu meiner gedrückten Stimmung. Als linker Hand Jena-Lobeda auftauchte, wo ich mir einst beim Trampen die Beine in den Bauch gestanden hatte, fragte ich sie, warum es ihr eigentlich so schwerfalle, die seelischen Verwüstungen einer Ideologie nachzuempfinden, welche die DDR-Deutschen in ihrem überlieferten Nationalbewusstsein zwangsweise umpolen und unbedingt auf einen sozialistischen Internationalismus vergattern wollte. Ich schilderte ihr, wie sehr sich selbst SED-Genossen empört hatten, als in den Siebzigern kurzerhand aus der erst wenige Jahre zuvor durch einen Volksentscheid angenommenen Verfassung der allerletzte Hinweis auf die »deutsche Nation« getilgt wurde.
344
»Es war absurd. Die Leute fragten ernsthaft, ob sie weiterhin Deutsche sein durften.«
»Das ist an mir vorbeigegangen.«
Margherita von Brentanos Antwort bewies mir noch einmal das ganze Elend unseres geteilten Landes und der postnationalen BRD-Idylle. Sie hatte sich für die Emanzipation der Frauen, der Homosexuellen und gegen die Stationierung von Kurzstreckenraketen eingesetzt, wie sie stolz berichtete - nur wie es, von ihrem Wohnzimmerfenster aus gesehen, um die Freiheitsrechte ihrer Landsleute ein paar Straßen weiter auf der anderen Seite der Berliner Mauer bestellt war, darum hatte sie sich nie ernsthaft gekümmert. Da war es kein Wunder, dass sie auch die polnische Solidamosc geringgeschätzt hatte, denn ihr Interesse galt eher den Dritte-Welt-Läden, die sich mit Nicaragua solidarisierten. Am liebsten hätte ich sie auf dem Seitenstreifen der Autobahn abgesetzt.
»Wenn die Leipziger <Deutschland, einig Vaterland> rufen«, hielt ich ihr noch vor, »ist das nicht nationalistisch gemeint. Die Menschen wollen damit eher wieder an ihr geschichtliches Gewordensein anknüpfen, von dem man sie abgeschnitten hat.«
»Ein Deutschland, wie Sie es sehen, darf es nicht mehr geben. Es wäre unverantwortlich. Ja, ich würde sogar sagen, unverzeihlich!« Angesichts der Naziverbrechen sei die Wiedervereinigung eine moralische und politische Katastrophe, weil damit die als Folge der Verbrechen erfolgte Bestrafung revidiert würde. Das saß. Warum hatte ich sie nur mitgenommen?
Heidelore mischte sich ein und sagte, des Zankens müde, das könne doch wohl nicht ernst gemeint sein. Aber so war es nun mal. Mit einer Eskimofrau hätte ich mich verständigen können, mit Margherita von Brentano ging das nicht. Während der ganzen Fahrt blieb sie fixiert auf ein Totschläger-Deutschland, über das sie bramarbasierte - und welches sie variantenreich auf die Formel Der-Schoß-ist-fruchtbar-noch-aus-dem-das-kroch reduzierte. Adolf Hitler, aus ihrer Sicht blieb er Deutschlands unsterblicher Sohn! Alles verdunkelte sich in mir. Wessen Verblendung war nun blöder, die eines deutschlandfeindlichen SED-Politbüroklüngels, der aus taktischen Gründen seit ein paar Jahren wieder preußische Tugenden lobte, von dem ich jedoch annahm, wir hätten
345
ihn soeben hinter uns gelassen, oder die einer prominenten Westphi-losophin wie Margherita von Brentano, die unter all dem nicht einmal litt? Wessen Verstand blieb fester verschlossen, um nur ja keinen anderen Anfang Deutschlands denken zu müssen?
Aber vielleicht mussten die ideologischen Verstrickungen der Bestochenen ja erst noch gelöst werden? So leicht wollte ich nicht aufgeben. In rascher Folge veröffentlichte ich nach Weimar ein halbes Dutzend Essays. Vom Goethe-Institut angeheuert tourte ich durch Holland, um in Amsterdam und an drei Universitäten über die deutsche Frage zu referieren. Auch da hatte ich ein Aufwacherlebnis. Als ich vor Germanisten über das zukünftige Deutschland sprach, kritisierte mich ein Professor aus Hamburg heftig, weil ich für seinen Geschmack allzu oft Goethe zitiert hatte. Er kenne viele Landsleute, belehrte er mich, die sich »eher als Europäer« sähen denn als Deutsche. Also warum Goethe? Auf meine Frage, welche literarische Größe man denn seiner Meinung nach anführen könne, wenn man über unser gemeinsames Deutschsein spreche, verwies er mich auf Charles Dickens. Darauf war ich nicht gekommen. Ich referierte auf dem Richtertag in Köln und nahm an einer Reihe von Podiumsdiskussionen teil. Im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz arbeitete ich mit an der Konzeption einer Ausstellung über die Justiz der DDR.
Erst langsam dämmerte mir bei all meinen Aktivitäten, wie gekonnt der politische Westen jedes Fragen nach der deutschen Identität ausbremste. Die Motive der DDR-Demonstranten für die Einheit seien sehr zweifelhaft, hörte ich nun immer öfter. Die Leute seien doch nur vom Westen verführt, sozusagen geködert von der D-Mark. Wer diese These favorisierte, galt auf einmal als Realist. Was mich bei dieser das nationale Aufbegehren der Ostdeutschen herabwürdigenden Aussage beleidigte, war die Arroganz, die dahinter steckte. Mir schwante früh: Die Ostdeutschen würden vermutlich vieles verzeihen, aber diese Arroganz der historisch besser Davongekommenen wahrscheinlich eher nicht.
1991 stritt ich, um nur an diesen einen Vorgang noch zu erinnern, mit Kurt Sontheimer in der Evangelischen Akademie Nordelbiens.Mir missfiel an Sontheimer, dass er in seinem Vortrag Deutschland wie einen auf Bewährung entlassenen Knastologen behandelte. »Deutschland. Eine
346
Zwischenbilanz« — unter diesem Tagungsmotto fand unsere Diskussion statt. Leider hatte der Mann auch wieder nichts anderes zu bieten, als die »feste Einbindung Deutschlands in die westlichen Bündnis- und Kooperationsstrukturen«. Einbindung, Einbindung, Einbindung -ich konnte es nicht mehr hören. Das Ganze erinnerte mich allzu sehr an den in der DDR propagierten Bruderbund mit den sozialistischen Staaten. Da war auch stets die Rede von einer quasi gesetzmäßigen, unverbrüchlichen und ewigen Freundschaft zur Sowjetunion.
Ein Herzensanliegen war dem Professor aus München natürlich »die Europäische Gemeinschaft, auf deren Weiterentwicklung zu einer supranationalen Gemeinschaft die Bundesrepublik drängen sollte, um den europäischen Nachbarn die Furcht vor einem überstarken Deutschland in der Mitte Europas zu nehmen«. Der Mann redete in einem arroganten Tonfall, weil er ganz offensichtlich glaubte, er befinde sich auf der geschichtlich sicheren Seite und damit näher an der politischen Realität als unsereiner. Das sah ich anders. Von meinem östlichen Beobachtungsposten aus erschien mir Deutschland nicht als schlafendes Ungeheuer, vor dessen Wachwerden man sich fürchten und dem man höchst vorsorglich Ketten anlegen musste. Das Land ähnelte mir viel eher einem Spätheimkehrer. Nur weil andere sich fürchteten, was ich stark bezweifelte, musste Deutschland sich nicht verzwergen. Englands Botschafter hatte ich schon so geantwortet, als dieser Jens Reich und mich in der kleinen Eisbar Unter den Linden/Ecke Friedrichstraße spitzbübisch fragte - er zerrührte dabei langsam auf sehr aristokratische Weise seinen Zuckerwürfel in einer kinnhoch gehaltenen Teetasse -, wie wohl Deutschlands Nachbarn auf die Einheit reagieren würden. Anders aber als der Gesandte Ihrer Majestät, der sich meine Sichtweise gelassen anhörte, fuhr Sontheimer nach meinem Vortrag aus der Haut. Mit Schweißperlen auf der Stirn regte er sich klassenprimusartig über meine Unbelehrtheit auf. Meine Replik, seine ganze Argumentation ziele auf eine planmäßige Selbstentmündigung und erinnere mich doch sehr an die neuerdings auch im Osten an den Häuserwänden zu lesende Antifa-Parole »Nie wieder Deutschland«, brachte ihn aus der Fassung.
Im Unterschied zu Sontheimer wollte ich aus meiner deutschen Haut nicht herausschlüpfen. Und Brüssel als eine Art Fluchtburg der Deutschen vor sich selbst schien mir wie jede andere postnationale Konstellation ganz und gar nicht erstrebenswert. Wir hatten im Herbst schließlich nicht gegen einen deutschen Nationalstaat revoltiert, sondern gegen ein diktatorisches Regime! Und wir wollten ein für allemal das an uns vollzogene volkspädagogische Experiment beenden, uns dem Sowjetarchipel zuzuschlagen. Deshalb sahen nicht wenige Menschen neben ihrem Einstehen für Freiheitsrechte und Demokratie - so wie ich - in der Einheit eine Heimkehr und die historische Chance für ein Wiedereinleben im lange verloren Geglaubten. Das neue Deutschland, das für mich und meinesgleichen »unser Land« sein sollte (nicht zu verwechseln mit dem, was Christa Wolf darunter verstehen wollte), sollte nicht nur ein beliebiger Siedlungsraum oder wirtschaftlicher Standort auf der Landkarte Europas sein.
347-348
#
Verspäteter Widerstand durch herabsetzendes Nachstellen
349-
Wären Heidelore oder gar unser Sohn aufgrund meines politischen Engagements schlimm schikaniert worden, wie ich dann empfunden hätte, kann ich ehrlichen Gewissens nicht sagen. Beide haben manche Bosheit ertragen müssen. Aber das Geschehene hat bei ihnen keine unheilbaren Wunden geschlagen. Ich brauchte nicht zu hassen! Mich trieb kein Gefühl des Geschädigtseins. Es dürstete mich auch nicht nach einem herabsetzenden Nachstellen gegenüber jenen, die mich und meine Familie im Operatiworgang Psyche bearbeitet hatten. Die darin enthaltenen Decknamen habe ich mir von der Gauck-Behörde nicht entschlüsseln lassen. In meinen besten Augenblicken fühlte ich mich stattdessen einem Geist verpflichtet, welcher frei von Rachsucht jedes Zurückschlagenwollen ablehnte. Die Generale der Staatssicherheit und deren Befehlsgeber im SED-Politbüro kamen mir dabei freilich nicht in den Sinn. Mitgefühl brachte ich jedoch für das Gros ihrer Gehilfen auf. Die zettelten Ende des Jahres 1989 selber ja nicht nur in fast allen Bezirksverwaltungen Auseinandersetzungen über ihre Treuepflicht als »Schild und Schwert« der SED an, was heute niemand mehr würdigen will, sondern lieferten uns - den Neuen Kräften - oftmals brisante Interna, von denen wir ohne sie nie erfahren hätten. Das halte ich immer noch für einen zwar späten, aber dennoch verdienstvollen Beitrag im Kampf gegen das alte Regime. Wenigstens an ein Beispiel sei hier erinnert.
Im Kulturhaus Adolf Frank in Leipzig fand am 6. Januar 1990 ein Landestreffen des Neuen Forums statt. Joachim Gauck nahm mich dort beiseite. Eine Delegierte aus Rostock wollte mich sprechen. Gauck führte mich in einen Nebenraum. Dort saß auf einem Stuhl unter dem Fenster eine Frau, die ihre Erregung kaum unter Kontrolle halten konnte. Rostocker Geheimdienstler hatten ihr ein Fernschreiben des Bezirksamtes in Gera an alle bewaffneten Organe (datiert auf den 9. Dezember 1989) zugespielt, welches ausdrücklich als »Aufruf zum
noch möglichen gemeinsamen Handeln« deklariert worden war. Unter Mithilfe der anderen bewaffneten Kräfte wollten die thüringischen Hüter der Diktatur des Proletariats die »Anstifter, Anschürer und Organisatoren« konterrevolutionärer Umtriebe »paralysieren«, wie sie unverblümt verlangten. Die im Neuen Forum engagierte Frau fürchtete sich vor diesen Unbelehrbaren, die nicht aufgeben wollten. Joachim und ich überzeugten sie, mir ausdrücklich zu erlauben, dieses Telex am Runden Tisch als Beweis dafür zu verwenden, dass weiterhin Ewiggestrige wühlten, welche das Rad der Geschichte zurückdrehen wollten. Solche Fanatiker gab es ja immer noch. Wir mussten sie öffentlich bloßstellen. Nur so konnte man die letzten Klassenkämpfer in den bewaffneten Organen zur Raison bringen.
Um aber auf meine sich wandelnde Einstellung zurückzukommen: Abgesehen von solchen Unbelehrbaren scheute ich mich nicht, mich mit ehemaligen Antipoden zu versöhnen. Bereits zum Jahreswechsel 1989/90 erschien von mir eine Stellungnahme - Kurt Masur hatte Walter Jens, Werner Heiduczek, Walter Janka und mich um einen Beitrag für sein Programmheft zum Neujahrskonzert gebeten -, in der ich ausführte, wie ich mir einen künftigen Umgang mit all denen vorstellte, die wir niedergerungen hatten. Die Wut und ein verbreitetes schlechtes Gewissen suchten ja längst nach Sündenböcken; und es bestimmten zunehmend diejenigen das öffentliche Geschrei, die von der Schuld der anderen profitieren wollten, die Rächer und Vergelter. Hatten deren Knie noch vor Kurzem zu zittern begonnen, wenn sie nur das Wort »Staatssicherheit« hörten, befleißigten sie sich nun, alle Unterstellten Mielkes pauschal als »Verbrecher« zu verteufeln. Ob diese persönlich mit der Spionageabwehr, dem Personenschutz, der Terrorbekämpfung, mit reiner Verwaltungsarbeit oder der Unterdrückung der inneren Opposition zu tun hatten - selbst so naheliegende Unterscheidungen sollten gar nicht erst getroffen werden.
Es überraschte mich zwar nicht, wenn ehemals Verfolgte jetzt darauf abzielten, die Rolle des gehetzten Wildes mit der des Jägers zu vertauschen. Höchst anrüchig schien mir jedoch die von Woche zu Woche anschwellende nachgeholte Empörung, die wie ein unwiderstehlicher Strudel zunehmend mehr Menschen erfasste. Ein unablässiges mea
350
culpa von den Tschekisten zu verlangen, hielt ich für unangebracht. Was konnte man dem entgegensetzen? Kurt Masur wollte in der Silvesternacht Beethovens Neunte Sinfonie und den Chor mit Schillers hymnischer Ode »An die Freude« im Gewandhaus dirigieren (ARD und DDR-Fernsehen sendeten aus Leipzig). So konnte ich dazu aufrufen, dass wir alle jetzt Verzeihensbereitschaft üben müssten, und Schillers Worte zitieren:
Groll und Rache sey vergessen,
Unserm Todfeind sey verziehn;
Keine Thräne soll ihn pressen,
Keine Reue nage ihn.
An allen fünf Fingern konnte ich mir natürlich abzählen, dass ich mit einem solchen Aufruf bestenfalls eine lauwarme Zustimmung ernten würde. Warum ich Schillers Verfolgungsverzicht preisende Zeilen trotzdem hervorhob und ausdrücklich Verzeihensbereitschaft anmahnte, haben nur wenige meiner Freunde verstanden.
Zum einen pochte ich damit darauf, dass man niemanden treten darf, der schon am Boden liegt. Es kam mir aber auch auf die Verstärkung des Tons an, dem Kurt Masur mit Beethovens Sinfonie in jener einmaligen Silvesternacht Gehör verschaffen wollte. Masur, der Erich Honecker in den elendigsten Stunden seiner Demütigung brieflich dafür dankte, dass er den Wiederaufbau der Oper in Dresden und den Bau des Gewandhauses in Leipzig durchgesetzt hatte, gab mir mit seinem künstlerischen Tun so etwas wie eine Entscheidungshilfe für die Betrachtung der Hinterlassenschaften unseres Lebens. Wie er unbeeindruckt von jeglicher Stasi-Hysterie seinen Weg der Versöhnung beschritt, dafür bewunderte ich ihn. Mit Schillers Ode »An die Freude« wollte Masur ja einem Geist dienen, der als Freiheit von der Rache jeder Friedensstiftung unbedingt vorangehen musste! Diesen Grundzug im Denken, Fühlen und Wollen unter dem Druck der einsetzenden Täter-Opfer-Polarisierung so weit wie möglich zu stärken, erschien mir nobel und mutig.
Mit Wolfgang Strübing hatten Heidelore, Falk und ich in der Weihnachtsnacht den Gottesdienst in der Christengemeinschaft gefeiert, mitsamt Fasten und allem drum und dran. Auch in der Schwedter Straße wurde ich darauf gestoßen, welche Heilkraft in dieser heiklen
351
Phase des gesellschaftlichen Umbruchs die im fünften Vers des Vaterunsers angemahnte Verzeihensbereitschaft beinhaltete: Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die einzige Bitte im Vaterunser, welche Jesus selbst erläutert hat mit den Worten: Wenn ihr den Menschen ihre Fehler verzeiht, so wird euch euer himmlischer Vater auch eure Fehler verzeihen.
In meinem anwaltlichen Berufsleben habe ich oft gesehen, was der Hass in den Seelen der Menschen anzurichten vermag. Es lag jetzt mit an uns, ob der ewige Zyklus von Rache und Widerrache durchbrochen werden konnte. Denn in diesem einen Punkt blieben wir als die von Tag zu Tag unwichtiger werdenden sogenannten Bürgerrechtler jahrelang ja noch weiterhin einflussreich!
Die Bonner Politik, die bald schon alles im Osten bestimmte, zeigte sich da eher unschlüssig, wie der Streit über den Umgang mit den Akten beweist. Wenn wir, und damit meine ich wieder in erster Linie die Sprecher der sogenannten Neuen Kräfte, in dieser historischen Situation auch nur einmal darüber beraten hätten, was jetzt eigentlich die letzte unerledigte Aufgabe der vor ihrem absehbaren Ende stehenden Bürgerrechtsbewegung hätte sein können, wäre todsicher eine Frage aufgetaucht: Wie können wir mit der uns im Widerstand gegen die sozialistische Diktatur erworbenen Achtung dabei helfen, einer über die kleinen Perspektiven von Gut und Böse hinausreichenden friedenstiftenden Gerechtigkeit zu dienen? Nicht als diplomierte Verfolgte. Nicht im Sinne Bärbel Bohleys, die schon bald mit ihrer vulgären Verachtung der Justiz die strafende Zurückhaltung der mit Aufarbeitungsfällen betrauten Richter verhöhnte. Auch nicht so, wie Jens Reich räsonierte, der die Staatssicherheit vollmundig als »unsere Krake« beanspruchte, die wir selbst erwürgt hätten und die wir nun sezieren und analysieren müssten. Wer sollte das leisten? Nein, seit der Einrichtung der Stasiunterlagenbehörde 1991 stand jeder, der über eine aktenkundige Operativbiografie verfügte, die was hergab, vor der moralisch höchst bedeutsamen Frage, ob er oder sie bewusst auf Rache verzichten wollte oder nicht. Was gewöhnlich daraufhinauslief, darüber zu entscheiden, wie man den eigenen Operatiworgang gegenüber den enthüllungsgierigen Journalisten handhabte. Ob man sich also still die Hände reibend an Denunziationen weidete oder Abstand wahrte.
352
Welche menschenverachtende Hatz angestiftet wurde, sobald man Klarnamen lieferte, wussten angesichts eines jähen Stimmungsumschwungs, der sich innerhalb einer instabilen, schwankenden und jeder Mäßigung abholden öffentlichen Meinung vollzogen hatte, alle Beteiligten ja sehr genau.
Aber was hieß Rache in den Neunzigern? Gab es dafür überhaupt Gründe? War der deutsche Herbst nicht ohne Blutvergießen über die Bühne gegangen? »Friedliche Revolution« lautete doch die landesweit akzeptierte Losung. Und absehbar war ja sehr früh, dass - von der einen oder anderen Seilschaft abgesehen - die meisten Profiteure der zerschlagenen Ordnung politisch rasch beiseitegedrängt würden. Dass sich wendige PDS-Kader mit parlamentarischen Pfründen versorgten, änderte daran wenig. Sie verhielten sich nicht anders als ihre westdeutschen Kumpane, welche in den siebziger Jahren in neuleninistische Kampfbünde eingetreten waren und in den Achtzigern wieder einen Rückzieher machten, um fortan im Betrieb der etablierten Parteien hoch dotiert mitzumischen, wie etwa Joschka Fischer, Jürgen Trittin oder Winfried Kretschmann. Wir durften zufrieden sein! Mehr konnten wir nicht erwarten.
Leider mochten viele Aktivisten der ersten Stunde sich damit nicht abfinden. Ihre Unzufriedenheit mit dem Ergebnis der Revolution erzeugte ein geradezu trotzkistisches Begehren nach permanenter Abrechnung. Sie wollten nicht einsehen, dass jetzt die Entradikalisierung ihrer ethischen Anmaßungen und allein ein menschenfreundlicher Weg heilsam sein würden. Und kaum jemand machte sich klar, obwohl genau dies doch der Kernpunkt einer kathartischen Volksaussprache hätte sein müssen, was wir alle durch unsere eigene Subalternität angerichtet hatten, womit ich auch die kümmerliche DDR-Opposition meine und manches Wegducken, oder was der Einzelne gegen seine Nachbarn und Arbeitskollegen schuldhafterweise angerichtet hatte. Das gestürzte Regime hatte mit sehr raffinierten Abstufungen unter tatkräftiger Beihilfe seiner Untertanen auf fast jeden Bürger deformierend eingewirkt, uns gegeneinander geschickt in Stellung gebracht.
Anstatt den geschichtlichen Augenblick als eine Gelegenheit einer möglichen Gesamtbesinnung zu ergreifen, uns also mit den willig oder
353
meinetwegen missmutig, manchmal vielleicht auch gezwungenermaßen hierbei in Kauf genommenen Gängelungen, Freiheitsbeschränkungen, den vielen Rechtsbeugungen, Indoktrinationen, Verführungen und Erpressungen auseinanderzusetzen und somit erst einmal über den eigenen alten Adam und sein korruptes Milieu nachzudenken, haben wir die forensische Prozedur selbst noch außerhalb der Gerichte favorisiert.
Verdächtige wie Manfred Stolpe oder Gregor Gysi - um nur sie zu nennen - wurden in einer endlosen Schleife hochnotpeinlich durchleuchtet und tausendfach moralisch verurteilt, meistens dann, wenn eine Bundestags- oder Landtagswahl bevorstand. Dabei wussten doch alle, dass fast ausnahmslos jede Berufstätigkeit von einiger Bedeutung ohne Stasi-Kontakte beinahe undenkbar war. Wer die Karriereleiter nach oben kletterte, begegnete automatisch irgendwann »seinem« Staatssicherheitsleutnant - auch wenn das freiwillig angesichts der Hexenjagd jetzt kein Aas mehr zugeben wollte. Vorbeugend wurden in dieser historischen Situation auch alle diejenigen unter Verdacht gestellt, die oft genug mit Herzrasen einen Weg zwischen aktivem Widerstand und totaler Staatshörigkeit für sich gesucht hatten. Sie alle, die weder Helden noch Fieslinge waren - in meinen Augen die überwältigende Mehrheit meiner Mitbürger -, standen jetzt unter Beweislast und mussten sich rechtfertigen.
Schleierhaft blieb für mich, woher all die schäumende Rachsucht bei denjenigen kam, die unter Ulbricht und Honecker weiß Gott auskömmlich gelebt und nur Angst gehabt haben, ohne dass ihnen jemals ein Haar gekrümmt worden war. Wo immer ich mein Befremden darüber auch nur andeutete, lief die Antwort stets auf dasselbe hinaus: »Gott bewahre, wer will denn Rache?« Oft hieß es gar: »Auge um Auge, Zahn um Zahn möchte doch niemand.«
Bis zuletzt blieb der Nährboden für die ganz alltägliche Rachsucht undurchsichtig; wodurch neben dem medialen Interesse das Verächtlichmachen und Verhöhnen, das vor sich Hertreiben und Herabsetzen der jeweils durch neueste Aktenfunde oder Durchstechereien an den Pranger Gestellten eigentlich getrieben wurde, das blieb unausgesprochen. Also jene Gesinnung, welche Nietzsche meinte, als er in seinem Stück »Von der Erlösung« feststellte: »Dies, ja dies allein ist Rache selber: des Willens Widerwille gegen die Zeit und ihr <Es war>.«
Eine Einstellung, welche die Zeit und ihr Vergehen nicht hinnehmen mochte, für die das »Es war« ein Stein des Anstoßes blieb.
354
Die in der nachrevolutionären Phase sich aufplusternden und von edlem Streben glühenden allzu Gerechten verstanden ihr stärkstes Ressentiment allerdings keineswegs als gegen ihre Zeit gerichtet. Sie konnten sich ja auch nicht eingestehen, dass sie nur deshalb so wüteten, weil sie unwiederbringlich den historischen Augenblick versäumt hatten, wo es politisch auf ihr beherztes Engagement angekommen wäre. Als sie so dringend gebraucht wurden. Mit ihrem vom Gefühl des Zuspätgekommen- und Geschädigtseins getriebenen rächenden Nachstellen wollten sie sich nun über die Herabgesetzten moralisch erheben und so die eigene, für einzig maßgebend gehaltene Geltung herausstreichen. Sie sahen darin ein gesundes Empfinden im Umgang mit unser aller Vergangenheit in aufklärerischer Absicht. Im Namen der Menschenrechte allen Tschekisten wie einem räudigen Hund einen Fußtritt zu verpassen, bedeutete ihnen, in Umkehrung ihres schlechten Gewissens gewissermaßen gratis eine Stubenreinigung zu vollbringen, mit der Ostdeutschland gesäubert und die eiternden Wunden der Gemeinschaft ausgetrocknet werden sollten.
Wolfgang Thierse, Friedrich Schorlemmer und Joachim Gauck hatten scheinbar ähnliche Bedenken. Sie wollten ein außergerichtliches Tribunal zur »gemeinschaftlichen Aufarbeitung unserer Vergangenheit durch uns selbst« mit dem erklärten Ziel einer »politisch-moralischen Selbsterziehung und Selbsterneuerung« einberufen. Gut gemeint war das sicherlich. Trotz Unterstützung durch die Presse und des im Aufbau Verlag herausgegebenen Sammelbandes »Ein Volk am Pranger«, worin zwei Dutzend um ihre Meinung gebetene Kopfarbeiter aus Ost und West ihre Auffassungen dazu begründeten, versandete das Unternehmen leider schnell wieder, nachdem die Debatte soeben erst begonnen hatte. Nachdenklichkeit war nicht gefragt. Untauglich schien mir von vornherein die konzipierte Form eines Tribunals. »Wer wollte und könnte da schon Platz nehmen? Ich bestimmt nicht«, schrieb ich Thierse. Wir durften nicht zu gleicher Zeit den Ankläger und Beschuldigten mimen und uns zudem noch auf der Richterbank spreizen.
355
Vor dem jede Diskussion seinerzeit prägenden Hintergrund aus Wut, Bitterkeit und weinerlichem Selbstmitleid stellte in meinen Augen die erhöhte Gerichtsbühne kein geeignetes Podium dar, um all der Klein-geisterei, deren Auslassungen die Öffentlichkeit zu ihrer Unterhaltung bedurfte, die Stirn zu bieten.
Entspannend schien mir angesichts der ordinären Rechthaberei und Beschimpfung nur die Lehre, welche William von Baskerville, der gescheiterte Verbrechensaufklärer in Umberto Ecos »Im Namen der Rose«, Adson mit den Worten erteilt:
»Fürchte die Wahrheitspropheten und fürchte vor allem jene, die bereit sind, für die Wahrheit zu sterben: Gewöhnlich lassen sie viele andere mit sich sterben, oft bereits vor sich, manchmal für sich ... Vielleicht gibt es am Ende nur eins zu tun, wenn man die Menschen liebt: sie über die Wahrheit zum Lachen bringen, denn die einzige Wahrheit heißt: lernen, sich von der krankhaften Leidenschaft für die Wahrheit zu befreien.«
Als ich dies Thierse schrieb, stand mir nicht nur ein Racheengel wie Heinz Eggert vor Augen, der als »Pfarrer Gnadenlos« in Sachsen gerade eine Karriere als Politiker startete. Hinter mir lag da auch eine ganze Reihe zeitraubender Rücksprachen mit Ehemaligen. Vordergründig suchten die ausgemusterten Tschekisten meistens wegen arbeitsrechtlicher Streitigkeiten meinen anwaltlichen Rat. Mindestens ebenso wichtig war ihnen aber auch die sich dabei bietende Gelegenheit, mit mir unter dem Schutz anwaltlicher Verschwiegenheit über ihr Tun und Lassen bei der Staatssicherheit zu sprechen. Ich bagatellisierte in solchen Fällen keinesfalls das schlechthin nicht zu Verteidigende, erinnerte aber gleichzeitig besonders die jüngeren Chargen an die historische Dimension der Ost-West-Systemauseinandersetzung. Letzteres schien mir angezeigt, weil sie oftmals ihr persönliches Tun völlig überbewerteten. Wie zwei Nachwuchskader es mir unvergesslich vorführten. Sie beichteten mir mit einem Kloß im Hals, wie sie - »nachdem die Sache mit Ihrem Buch herauskam« - meine Telefonate abgehört hatten. Darüber berichteten sie mit einer Miene, als hätten sie mir nach dem Leben getrachtet. Geschenkt, sagte ich kurz angebunden, und dass ich mit einer solchen Abhöraktion ja wohl habe rechnen dürfen.
Ulrich W, der sich damit nicht zufriedengeben wollte, legte größten
356
Wert darauf, mir zu versichern, er könne selbst nicht mehr verstehen, woran er damals geglaubt habe: »Ernsthaft. Sie mit ihrem Neuen Forum, das war für mich die Konterrevolution!« So habe er es doch sehen müssen. Und so gänzlich falsch sei eine solche Sicht der Ereignisse ja wohl nicht, sagte ich und beruhigte ihn. »Hätten Sie es nicht geglaubt, könnten Sie heute auch nicht das Recht eines irrenden Gewissens für sich reklamieren.« Ich sehe W, dem ich mehrfach danach begegnet bin, heute noch so vor mir. Wie er sich zurücklehnt und wie gebannt auf meine Schreibtischplatte starrt. Dass ein Irrender, der guten Gewissens gehandelt hat, moralisch nicht verurteilt werden sollte, selbst wenn er nach allgemeiner Überzeugung unmoralisch gehandelt hat, konnte er nur schlecht verkraften.
Nun ja, Thierses Unternehmen führte immerhin zu dem noch heute lesenswerten, von Albrecht Schönherr im Aufbau Verlag herausgegebenen Sammelband. Leider kam die Aufarbeitung der Hinterlassenschaft des Staatssicherheitsdienstes über ein infantiles Niveau in der breiten Öffentlichkeit nur selten hinaus. Daran haben selbst gediegene Sachbücher historischer und juristischer Fachforschung wenig geändert. Kinder schüchterte man früher mit der Frage ein: Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Jetzt sollten die Tschekisten und ihre Helfershelfer dessen Rolle übernehmen. Und all die Kinderlein entlasteten sich, indem sie bei jeder Enthüllung aufheulten und von all dem nichts gewusst haben wollten. Da musste die Frage gestattet sein: Habt ihr auf einem anderen Stern gelebt, völlig anders gedacht und euer Dasein geführt als unsereiner?
Gewiss, nach der Öffnung der Akten, von denen ohnehin keiner genau wusste, was an ihnen gelogen, übertrieben oder manipuliert war, und den Verlautbarungen der zentralen Behörde für Wahrheitsfindung sah vieles, wenn nicht gar alles, scheinbar völlig anders aus, realistischer, menschengerechter. Aber doch nur so, wie es für jeden ausgeschlafenen Zeitgenossen, der sein Leben im Ulbricht- und Honeckerstaat mit Verstand und etwas Geschichtskenntnis geführt hatte, auch schon früher aussah. Damit meine ich nicht, dass es keinen Klärungsbedarf gab. Natürlich wäre es jetzt an der Zeit gewesen, den persönlichen Umgang mit verzwickten Situationen lebensnah zu erörtern. Wie haben wir uns bei Konflikten zwischen den Anforderungen eines übertragenen Amtes und des eigenen Gewissens verhalten?
357
Leider kam manch einer, dem man gern ein dickeres Fell gewünscht hätte, mit der hysterischen Ausdeutung der DDR-Vergangenheit überhaupt nicht zurecht. Wie der Volkskammer- und Bundestagsabgeordnete Professor Gerhard Riege, bei dem ich ein Vierteljahrhundert zuvor in Jena Staatsrechtsvorlesungen gehört hatte. Mir war er als verständnisvoller Lehrer in Erinnerung geblieben, der uns ein Maß an akademischer Freiheit zugebilligt hatte, wie es in den Sechzigern nicht unbedingt üblich gewesen ist. Sein Scheitern zeigte mir drastisch, weshalb der 89er Aufbruch für viele der in der Höhle Gefangenen keine Befreiung von ihren Fesseln war, wodurch vielleicht ein Aufstieg ins Freie hätte angetreten werden können.
Wenn ich die Causa Riege richtig beurteile, dann erlebte der Mann in seiner Abgeordnetentätigkeit die erste frei gewählte Volkskammer offenbar als ernst zu nehmendes »Gesprächsparlament« und »Vorbote einer neuen politischen Kultur«, was mich ein bisschen wunderte, als ich das las. Hinterm Rednerpult im gesamtdeutschen Bundestag stehend, dürfte ihm sein historischer Optimismus bald abhandengekommen sein.
»Sie sollten das Wort <Recht> überhaupt nicht in den Mund nehmen«, rüpelte ihn dort der Abgeordnete Joseph-Theodor Blank an. Und das war nur einer von 32 protokollierten Zwischenrufen, welche ausnahmslos unter die Gürtellinie zielten. In der Person Rieges wollten sie, denen es überhaupt nichts ausmachte, mit alten DDR-CDU-Funktionären in einer Fraktion zu sitzen, nun guten Gewissens einen richtigen »Roten«, der schon wegen seiner geografischen Herkunft verdächtig war, zur Strecke bringen.
wikipe Joseph-Theodor_Blank *1947 in NRWNachdem ein paar Monate später eine bereits drei Jahrzehnte früher geschlossene MfS-Akte mit zwei vom Bundesbeauftragten für bedeutungslos erklärten Berichten auftauchte, wusste der 61-jährige Riege nur allzu gut, was das bedeutete. Wie Hiob klagte er in seinem Abschiedsbrief: »Mir fehlt die Kraft zum Kämpfen und zum Leben. Sie ist mir in der neuen Freiheit genommen worden. Ich habe Angst vor der Öffentlichkeit, wie sie von Medien geschaffen wird und gegen die ich mich nicht wehren kann. Ich habe Angst vor dem Hass, der mir im Bundestag entgegenschlägt.«
358
Zonen des Verdachts
Gerhard Rieges Tod - er hinterließ drei Kinder und seine Ehefrau - bewirkte leider keinen ehrlicheren und offeneren Blick auf die geheimdienstlichen Hinterlassenschaften, ebenso wenig wie die Verzweiflungstaten all der anderen, die meinten, sie müssten mit einer drastischen Selbstbestrafung ihre verletzte Ehre wieder herstellen und auf ihre Kritiker antworten. Trotz gegenteiliger Beteuerungen amtlicher Nekrologe änderte sich nichts. Nach wenigen Tagen wurde nicht mehr vom Freitod Rieges gesprochen. Die Zone der Denunziationen dehnte sich aus wie ein Flächenbrand.
Jens Reich, Jochen Tschiche und auch Joachim Gauck wurden als prominente Sprecher des Neuen Forums verdächtigt, sie seien für den Geheimdienst tätig gewesen.
Eigene Erfahrungen hatte ich diesbezüglich bereits im Frühsommer '89 anhand einer in den »Umweltblättern« erschienenen und bezeichnenderweise mit N.N. unterschriebenen »Buchbesprechung« meines »Vormundschaftlichen Staates« gesammelt. »Verwunderlich ist es«, hieß es da, »dass H. von den mit Verfassern <grundsätzlicher Kritik> nicht eben zimperlich umspringenden Sicherheitsorganen so gänzlich ungeschoren bleibt. Sollte da vielleicht die alte Volksweisheit anwendbar sein, der zufolge eine Krähe der anderen kein Auge aushackt?«
Abgesehen davon, dass ich so ungeschoren nicht davongekommen bin, wie mir unterstellt wurde, konnte ich nur ahnen, wer dem Schreiberling die Feder geführt hatte. Ich antwortete darauf mit keiner Silbe. <Geh deinen Weg, und lass die Leute reden> - das schien mir die richtige Maxime zu sein, um in einer Zone des Verdachts nicht nervös zu werden. Meine Freundin Erika Drees empörte der Beitrag allerdings sehr. Sie konnte es nicht lassen, eine Erwiderung an die Redaktion der »Umweltblätter« zu schicken.
(Später konnte ich in dem letzten, nach dem Mauerfall gegen mich ausgearbeiteten Zersetzungsplan lesen, dass die meine Personalie bearbeitenden Staatssicherheitsoffiziere ganz selbstverständlich auf von ihnen lancierte Beiträge in den »Umweltblättern« setzten.)
359
Ihren Höhepunkt erreichte die Kultur des Denunziatorischen (Bernhard Schlink) jedoch erst, als die Abwicklung des Ministeriums für Staatssicherheit fast abgeschlossen war. Erst da hörte ich immer öfter die Behauptung, der ganze 89er Aufbruch sei doch nichts weiter als ein letztes geheimdienstliches Meisterstück gewesen. Mancher, der daran glaubte, und dies waren nicht wenige, verkündete nun vielsagend - meistens unter Hinweis auf Ibrahim Böhme (SDP) und Wolfgang Schnur (DA) -, selbst wir als Gruppe der Erstunterzeichner des Gründungsaufrufs des Neuen Forums seien doch »total unterwandert« gewesen.
Solche Mutmaßungen entsprangen zwar nicht unbedingt einer Absicht auf Täuschung, aber sie waren typisch für ein Weitergesagtwerden, welches jedes Erschließen der Vergangenheit über weite Strecken in ein Verschließen verkehrte. Wer unter Kollaborationsverdacht gestellt wurde, musste sich rechtfertigen. Die klassische Beweisregel in dubio pro reo war in der heißen Zone des Verdachts keinen Pfifferling wert. Entlastete man sich mit aussagekräftigen Aktenfunden, war man aus dem Schneider.
Meine Akten hatten die Tschekisten in Frankfurt und Berlin beiseitegeschafft. Aber es fanden sich Gott sei dank bald in anderen ehemaligen Bezirksverwaltungen des MfS genügend Belege, aus denen die auf meine Spur angesetzten Historiker der Gauck-Behörde entnehmen konnten, wie und wofür ich mich eingesetzt hatte. Walter Süß hat jedenfalls meinen Werdegang in seinem Buch »Staatssicherheit am Ende: Warum es den Mächtigen nicht gelang, 1989 eine Revolution zu verhindern« so nachgezeichnet, dass ich mich darin wiedererkannt habe. Und das, obwohl mir die auftraggebende Gauck-Behörde weiß Gott nicht wohlgesonnen war. Nicht nur einmal berichteten mir Journalisten über ihre Hintergrundgespräche mit Marianne Birthler. Als Behördenchefin hatte sie größten Wert darauf gelegt, ihnen klar zu machen, dass »Rolf Henrich völlig überschätzt« werde. Worauf Birthlers Animositäten mir gegenüber zurückzuführen waren, konnte ich mir denken. Im Brandenburger Landtag hatte ich mich in einer Anhörung als Sachverständiger zugunsten von Schulen in freier Trägerschaft exponiert. Und das, obwohl sie mich als amtierende Bildungsministerin zuvor händeringend vor »den Katholen« gewarnt hatte, die in Fürstenwalde eine Privatschule gründen wollten. Jesuiten seien da am Ball. Offenkundig waren die Ordensleute für sie so etwas wie die Fünfte Kolonne des katholischen Klerus im protestantischen Brandenburg.
360
VII der »Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR und dem Komitee für Staatssicherheit beim Ministerrat der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken« vom 6. Dezember 1973 regelte, dass DDR-Bürger »zur geheimen Mitarbeit« herangezogen werden durften, »wenn es im Interesse der staatlichen Sicherheit der UdSSR und der DDR zu Aufklärungs- und Abwehrzwecken im Kampf gegen die Geheimdienste des Gegners erforderlich ist«.)
Es gehört zur Parallelgeschichte eines Komplotts, dass es eigentlich nur Spitzenagenten Moskaus gewesen sein konnten, welche in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre in Honeckers Reich alle Fäden in der Hand hielten und die rebellierenden Kräfte gelenkt haben, um Glasnost und Perestroika durchzudrücken.
Natürlich wusste jeder politisch Informierte hierzulande nicht nur über die knapp 340.000 zwischen Ostsee und Erzgebirge stationierten Rotarmisten Bescheid. Allgemein bekannt war ebenfalls, dass in den meisten Bezirksstädten von Karlshorst aus angeleitete Zweigstellen der Lubjanka konspirierten. Man sah die Schlapphüte ja ein- und ausgehen. Was deren konkrete Aufgabenstellung war, darüber konnte man jedoch nur spekulieren. Und in welcher Zahl ihnen DDR-Bürger zuarbeiteten, wusste niemand.
(Art.
1989/90 sich mit Sowjets einzulassen, war jedenfalls höchst problematisch. Allzu leicht konnte man dadurch den Verdacht der Kollaboration auf sich ziehen. Daran musste ich sofort denken, als mich Smirnow, der Erste Botschaftssekretär der UdSSR, kurz nach dem Jahreswechsel anrief, um mich zu einem Gedankenaustausch am 22. Februar in die Vertretung Unter den Linden einzuladen, weil an diesem Tage, wie er mir mitteilte, ein hochrangiges Mitglied des Politbüros der KPdSU in Berlin weilen würde. »Und der Genosse möchte sich durch Gespräche mit Oppositionellen ein eigenes Bild von der politischen Lage verschaffen.« Der Anruf erreichte mich eines frühen Morgens.
Smirnows in akzentfreiem Deutsch vorgetragene Bitte erschien mir angesichts meiner Rolle in der Umbruchszeit plausibel. Es gab ja im Osten kaum mehr als zwei
361
Dutzend Oppositionelle, denen man zutrauen durfte, ein einigermaßen realistisches Lagebild zu liefern. Ich sorgte mich aber gleich, dass mein Besuch in der sowjetischen Botschaft falsch verstanden werden könnte - nämlich als Mauschelei mit dem KGB. Ich würde nur kommen, darauf beharrte ich deshalb, wenn mich von mir ausgewählte Vertrauensleute begleiten dürften. Smirnow hatte nichts dagegen einzuwenden: »Bringen Sie mit, wen Sie wollen.«
Mit meinem Freund Reinhart Zarneckow und dem mich an diesem Tage rein zufällig besuchenden Schriftsteller und Publizisten Dieter Borkowski im Schlepptau, Letzteren vergatterte ich ausdrücklich, sich bitte keinesfalls als Westdeutscher erkennen zu geben, drückte ich also am 22. Februar nachmittags auf den kupfernen Klingelknopf neben der Pforte der sowjetischen Botschaft. Ein jüngerer Angestellter öffnete uns die Tür und führte uns in die erste Etage des Botschaftsgebäudes. Was mir augenblicklich auffiel, als wir die breite Treppe im Mittelbau emporstiegen, war die Schäbigkeit der ganzen Ausstattung. Abgewetzte Teppiche, schwere samtene Fenstervorhänge, die mich an staubige DDR-Kinos erinnerten, rissige Stuckverzierungen, pompöse Kronleuchter und Wandlampen aus der Nachkriegszeit. Alles, aber auch wirklich jeder Winkel atmete hier den morbiden Charme einer untergehenden Epoche aus. »O nein«, schnaufte Dieter Borkowski leise in meine Richtung. Sein Entsetzen munterte mich auf. »Den Freunden fehlt das Geld für eine malermäßige Instandsetzung«, raunte ich ihm zu. Im ersten Stockwerk huschte flüchtig grüßend Ibrahim Böhme an uns vorbei. Böhme hatte augenscheinlich solo mit den Sowjets konferiert. Ohne seinen Außenminister Markus Meckel, der ihn sonst überallhin begleitete. Ein bisschen wunderte mich das schon.
Wir betraten einen großen Empfangssaal, in dessen Mitte eine lange Tafel aufgestellt war. Nach einer steifen Begrüßung durch die bereits wartenden, ausschließlich männlichen Gastgeber setzten Reinhart, Dieter und ich uns auf die für uns vorgesehenen Plätze. Der Sitzordnung auf der gegenüberliegenden Seite der Tafel nach zu urteilen, musste mein Visavis der mir telefonisch angekündigte hohe Gast aus Moskau sein. Nicht weiter erstaunlich fand ich, dass der aus Moskau angereiste Emissär erst einmal über die »deutsche Frage« mit mir sprechen wollte.
362
Wie solle es nun weitergehen? Für mein Gegenüber war die Überwindung der deutschen Teilung, wie ich unserem Gespräch entnehmen musste, offenbar die natürlichste Sache der Welt. Ob aber in den kommenden Monaten eine schnelle oder doch langsame Vereinigung beider deutscher Staaten in Gang gesetzt werden sollte - genau das war für ihn entscheidend. »Die Menschen bei uns verstehen nicht, was hier passiert. Es geht alles viel zu schnell.«
Als ich das hörte, wurde mir klar, dass man mich nicht nur eingeladen hatte, um bei einer Tasse Tee von mir zu erfahren, wie ich die sich entwickelnde politische Lage einschätzte. Offenbar suchten die Moskowiter auch nach Verbündeten unter den Neuen Kräften im Vorfeld der beschlossenen Volkskammerwahlen (wen sie da so alles eingeladen haben, wüsste ich gern; Friedrich Schorlemmer erzählte mir Jahre später, er sei ebenfalls in der Botschaft gewesen). Ich konnte das Anliegen der Sowjets zwar durchaus nachvollziehen, machte aber meine Gesprächspartner unmissverständlich darauf aufmerksam, dass angesichts der anhaltenden Flüchtlingsströme und der zusammenbrechenden DDR-Wirtschaft der Zug zur deutschen Einheit nicht nur abgefahren sei, sondern sich in den kommenden Monaten wohl noch deutlich beschleunigen werde. Niemand, weder ein Ministerpräsident Modrow noch eine neu gewählte Regierung und schon gar nicht wir Bürgerrechtler könnten daran irgendetwas ändern. Und selbst »mit Panzern« könne man den Lauf der Geschichte nicht mehr bremsen, fügte ich noch hinzu.
363
Wie sieht nun die Bilanz aus?
Wenn ich mein Leben, so wie ich es von den frühen sechziger Jahren bis in die Neunziger geführt habe, noch ein letztes Mal Revue passieren lasse, erscheint es mir als eine Abfolge unterschiedlichster Bindungen und Loslösungen und zugleich nicht weniger deutlich als eine mich desillusionierende Suche. Heilfroh bin ich, dass immer wieder ein anderer Anfang mich halbwegs auf der Höhe und bei Verstand gehalten hat. Mit einem Kundigen an meiner Seite in jungen Jahren wäre mir vermutlich mancher Umweg erspart geblieben. Was die Habenseite meiner Bilanz betrifft, rechne ich mir aber trotz all meiner Schlenker einen Punkt hoch an. Das muss ich näher erklären.
Während des Schreibens habe ich öfters darüber nachgedacht, wie es mir wohl ergangen wäre, wenn ich mich im Zusammenhang mit der Austrocknung des Sumpfes meiner millenarischen Illusionen auf die sichere Bank eines Beobachters zurückgezogen hätte. Mit der Anwaltskanzlei im Rücken hätte mir das in den späten Siebzigern und Achtzigern eine bequeme Lebensführung garantiert. Als eingefleischter Sinnsucher und Weltverbesserer war ich da längst gescheitert. Mein alltägliches Dasein bestimmten immer stichelnder das
»Bewusstwerden der langen Vergeudung von Kraft, die Qual des <Umsonst>, die Unsicherheit, der Mangel an Gelegenheit, sich irgendwie zu erholen, irgendworüber noch zu beruhigen - die Scham vor sich selbst, als habe man sich allzulange betrogen ...«.
Nietzsches Befund jenes seelischen Zustands, der unweigerlich eintritt, wenn wir immer wieder nach einem Sinn gesucht haben, welcher nirgendwo zu finden ist, trifft, bezogen auf mein damaliges Innenleben, ins Schwarze, mittenhinein. Mit dem <Alles umsonst> vor Augen hätte es deshalb nahegelegen, im Sich-Absetzen mein persönliches Heil zu suchen.
Warum habe ich dieser Versuchung widerstanden und mir, nachdem man Rudolf Bahro verurteilt hat, noch einmal solche Wallungen für das Gemeinwohl erlaubt?
364
Man kann die daraus entsprungene Kritik des vormundschaftlichen Staates und meinen persönlichen Einsatz bei der Gründung und Vertretung des Neuen Forums sicher leicht als »Toben des verrückten Eigendünkels« (Hegel) eines SED-Abweichlers diskreditieren. Ja, es ist ein Batzen Hochmut dabei gewesen. Eine andere Triebfeder war jedoch mächtiger. Ich fühlte mich mitschuldig am verkommenen Zustand unseres politischen Lebens, sprich: des vormundschaftlichen Staates mit all seinen von mir beschriebenen menschenverachtenden Auswüchsen. Und ich wollte durch tätige Reue - also durch eigenes Tun - zu einer Änderung der Verhältnisse im Osten beitragen. Selbst auf die Gefahr hin, damit wieder einer nächsten Illusionierung aufzusitzen. Nur entschuldigend auf meine juvenilen Gefühle zu verweisen nach dem Motto vieler Langzeitbetrüger, wonach man in jüngeren Jahren nun mal Sozialist oder nie richtig jung gewesen ist, reichte mir nicht.
Seitdem das Blatt sich gewendet hat, bedrückt mich der innere Drang nach wiedergutmachenden Taten nicht mehr. Wenngleich mit den veränderten Existenzbedingungen, wie sie durch die Herbstrevolution und die deutsch-deutsche Vereinigung herbeigeführt wurden, natürlich auch wieder eine Aufstockung meines Schatzes an Desillusionen verbunden gewesen ist: nämlich die Erfahrung des Unterschiedes zwischen der glitzernden Fassade und der hässlichen Rückansicht der neubundesrepublikanischen Wirklichkeit - hier nun jedoch schon begleitet durch die abgeklärte Einsicht, dass man das Eine nicht haben kann ohne das Andere.
So gewappnet hat mir die Erkenntnis, dass auch die Berliner Republik nicht dem entsprach, was ich mir gewünscht hatte (mündiges Bürgersein, kein Gouvernantenstaat mit dauernder Belehrung und Betreuung), nicht die Freude über die deutsche Einheit und die damit verbundene Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit verhagelt. Der Rechtsstaat stellte für mich das A und O dar; alles andere erschien mir im Verhältnis dazu zweitrangig.
Wahrscheinlich klingt ein derart bescheidenes Bekenntnis kleinmütig. Und es bezeugt in den Augen mancher meiner Mitstreiter gegen die sozialistische Diktatur gewiss nicht jenes Engagement, welches sie sich von mir als Hoffnungsträger gewünscht haben. An kämpferischer Hingabe an die Sache einer besten Herrschafts- und Verwaltungsform,
365
hundertprozentig basisdemokratisch engagiert, entschieden für etwas, ohne Abstriche und Bedenken.
Aber da musste ich diejenigen, die auf mich gesetzt haben, leider enttäuschen. Nicht nur deshalb, weil mein Interesse an aktiver Politik erlahmte. Die an mich herangetragene Erwartung, hauptberuflich als Politiker zu arbeiten, behagte mir überhaupt nicht. In meinen Ohren klang ein solches Ansinnen nach dem Volksmärchen <Die Sieben Schwaben>: "Hannemann! geh du voran! / Du hast die größten Stiefel an ..."
Ein auf die Probleme der Transformation zugeschnittenes Handbuch, welches einem die Stolpersteine der sich in den Neunzigern entfaltenden bundesrepublikanischen Gesellschaft anzeigte, stand auch mir nicht zur Verfügung. Klar war nur eins: Der eingeübte Widerstands-Modus, der Existenz und existenzielle Wahrheit mit gruppenhafter Gegenwehr und Freiheit im Untergrund gleichsetzte, hatte ausgedient. Eine Zeit lang versuchte ich noch, als Mann der Feder eine Lanze für die Mündigkeit zu brechen. Einen erkennbaren Nutzeffekt hatte das nicht. Es führte lediglich dazu, dass mich der Professor an der Freien Universität Klaus Adomeit in seiner Rechts- und Staatsphilosophie in einem mir gewidmeten Kapitel unter die »Rechtsdenker der Neuzeit« einordnete.
Als die sozialistische Diktatur kapitulierte, war ich mir zwar klar darüber, dass es mit dem revolutionären Eifer der Massen bald vorbei sein würde. Den Ausnahmezustand konnte man ja nicht verstetigen oder gar organisatorisch konservieren. Wie der Krebsgang aber dann vonstattenging, darüber war ich doch arg enttäuscht. Tatsächlich ersetzte ja innerhalb weniger Monate der Rückfall in die gewohnte Mündelrolle jeden aufrechten Gang und erstickte beinahe vollständig den eben erst landesweit ausgebrochenen Unternehmungsgeist an der Basis. Trotz meiner Skepsis hatte ich im Stillen immer noch gehofft, in der Phase des Untergangs der DDR und des Interims könne die von mir im »Vormundschaftlichen Staat« favorisierte Staatsidee befördert werden, die auf ein positives, der Mündigkeit verpflichtetes Menschenbild baute.
366
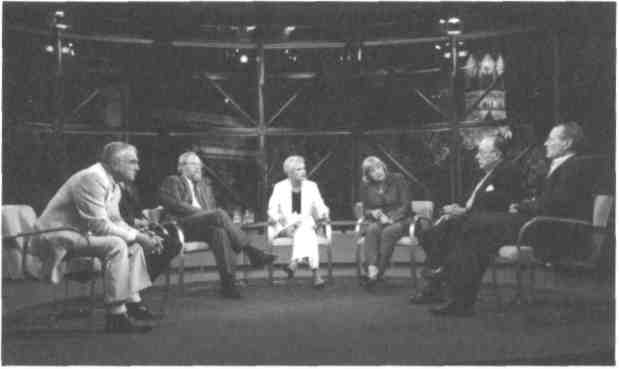
Michael Degen, Wolfgang Thierse, Sabine Christiansen, Angela Merkel, Hans-Dietrich Genscher, Rolf Henrich
in der Talkshow zum 40. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer, August 2001Überall im Land zerbrachen sich ja Menschen in den vom Neuen Forum und anderen Kräften eingerichteten Arbeitskreisen spätabends ihre Köpfe über eine Reform des Rechts, die Zukunft des Volkseigentums, ein erneuertes Schulwesen, die Beseitigung der gravierendsten Umweltschäden oder andere Fragen des Gemeinwohls. Wer da mitmachte, der wollte für die gemeinsamen Angelegenheiten Verantwortung übernehmen - und zwar ohne gleich auf ein honoriertes Amt zu schielen. Hier sammelten mündige Bürger unterschiedlichster Berufe ihre je eigenen Erfahrungen des Anfangens.
Nach der im März abgehaltenen Volkskammerwahl zeigte sich jedoch schnell, dass den neu gewählten Volksvertretern wie den Funktionären ihrer Parteien jede basisdemokratische Teilhabe lästig erschien. Im nun aufflammenden Streit über den einzuschlagenden Weg hin zu einer gesamtdeutschen rechtlichen Grundordnung fielen schließlich die letzten Hemmungen.
Neue Vormünder aus beiden Teilen Deutschlands bemächtigten sich der Rede über die Einheit Deutschlands.
Art. 23 GG aF, wonach der Beitritt der DDR vollzogen wurde, und Art. 146 regelten bekanntlich keine sich wechselseitig ausschließenden Wege in die Einheit, wie es seinerzeit fälschlicherweise der Öffentlichkeit eingeredet wurde, sondern lediglich die Modalitäten für ein vereinigtes Deutschland, wie es eine gemeinsame Verfassungsordnung herstellen sollte.
367
Ein vereinigtes Deutschland hätte demnach schon um seiner Selbstachtung willen den Art. 146 GG beachten und eine Verfassung in Kraft setzen müssen, die, wie das Grundgesetz es forderte, »von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist«. Ob vorsätzlich oder fahrlässig, jedenfalls verspielte die politische Klasse die historische Gelegenheit, das Datum der Herbstrevolution 1989 mit einem zweiten Datum zu verknüpfen, das an die republikanische Gründung einer neuen Ordnung mittels eines Referendums erinnerte.
Nicht genug, dass mit dem Verzicht auf eine der Form nach würdige Ersetzung des Grundgesetzes durch eine gesamtdeutsche Verfassung jede geschichtliche Verwurzelung der wiedergewonnenen staatlichen Einheit verweigert und der Eindruck einer Kolonialisierung des Ostens durch die scheinbar unverändert fortbestehende BRD provoziert wurde; man hatte auch das Gefühl eines grundsätzlichen Misstrauens gegenüber dem politisierten Volk, dem man die angeblich unbestrittene verfassungsgebende Gewalt offenbar nur unter der Voraussetzung zubilligte, dass es keinen Gebrauch davon machte. Angesichts eines solchen Umgangs mit dem Subjekt des pouvoir constituant hörte sich die spätere Empfehlung an diejenigen, die in Plauen, Dresden, Leipzig und anderswo »Deutschland einig Vaterland« skandiert hatten, sie mögen doch endlich von ihrer übertriebenen Deutschlandliebe ablassen und sich zukünftig mit einem politisch korrekten Verfassungspatriotismus begnügen, ziemlich heuchlerisch an.
Das Unbehagen an der als verlogen wahrgenommenen Verfassungsdebatte blieb, aber die mit der anschwellenden Arbeitslosigkeit verbundenen Verlusterfahrungen und Abstiegsängste drängten schnell das ganze Thema wieder von der Tagesordnung. Sorge um die Arbeitsplätze lähmte alles. Gefragt waren jetzt Retter und Wundermänner - Verkäufer von Schlangenöl. Frei werdende Verwaltungsposten waren plötzlich begehrt wie nie zuvor. Beamter zu werden oder wenigstens eine Sicherheit versprechende Stelle im öffentlichen Dienst, bei Gewerkschaften, Verbänden oder der Gauck-Behörde zu ergattern, schien für viele, die vorher über jede Art von Bürokratie gelästert hatten, auf einmal höchst erstrebenswert.
Ein Jahr nach dem Ende des sozialistischen Experiments klang die Forderung nach möglichst großer Eigenverantwortung und Freiheit für den Einzelnen schon wieder wie aus der Zeit gefallen. Ich musste also der unangenehmen Erkenntnis ins Gesicht blicken, dass meine zentrale Überzeugung, es müsse in einem wie auch immer begründeten Eigeninteresse meiner Mitmenschen sein, die Fesseln des vormundschaftlichen Staates abzustreifen, bis auf weiteres auch nichts weiter als ein schillerndes Vokabular sein würde, welches nicht näher an den Lauf der Dinge heranreichte als jedes andere Gerede.
Da blieb kein Platz mehr für Begeisterung, für Überzeugung oder Glauben; es blieb allenfalls noch ein kleiner Funken Hoffnung auf eine Politik und eine Staatsmacht, die es ihren Schutzbefohlenen nicht verübelte, eigensinnig einen Zustand der geistigen Sezession zu kultivieren und im Nichtdazugehören auszuharren. Abstand haltend zu dem Spektakel des Politbetriebs und der lärmenden Stimmungsmache, fern von jeder mitläuferischen Gefolgschaft.
Von den Wegen, die sich nach der Einheit öffneten, schien mir jedenfalls keiner sonst der rechte zu sein. Bedeutete das nun aber, dass der Geist des Aufbruchs sich - bei mir oder den anderen ehemals Aktiven der großen demokratischen Koalition - in Luft aufgelöst hatte? Verpufft und erloschen.
Da zögerte ich doch sehr, denn das letzte Wort über einen anderen Anfang in Deutschland war ja trotz der scheinbar totalen Angleichung der neuen Bundesländer an den Westen noch nicht gesprochen. Und das Leitbild eines mündigen und verantwortlichen Staatsbürgers bleibt allemal unabdingbare Voraussetzung der Möglichkeit eines vernünftigen Verhältnisses zu sich und den anderen, ganz gleich wie dieses Verhältnis konkret ausgestaltet wird. Jedenfalls stellt die Abwehr jeder Vormundschaft auch dort, wo wir zunehmend in Arbeits- und Systemabläufe eingefügt werden, weiterhin die formale Bedingung eines rationalen Entwurfs vom eigenen und gesellschaftlichen Leben dar.
368-369
#
Ende
Henrich-2019