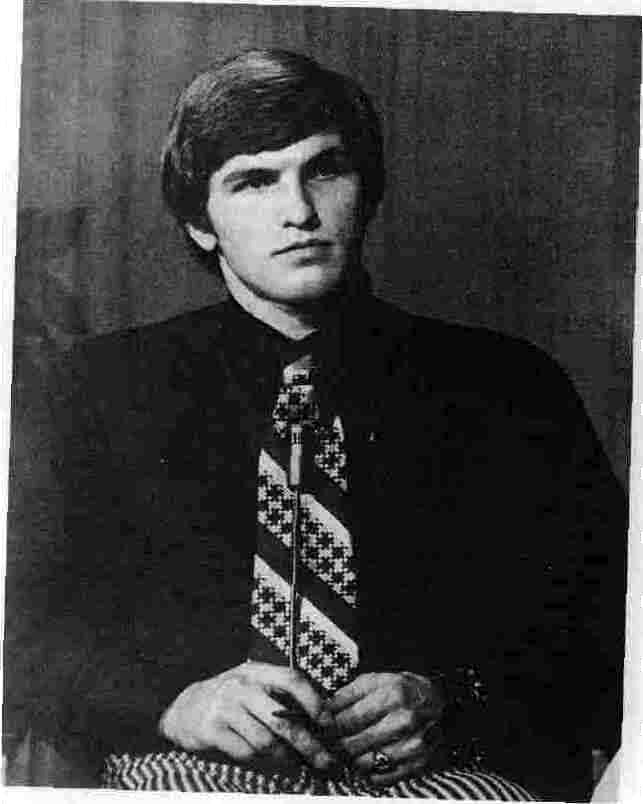Start
20.
Suche nach einem neuen Leben
Nachwort
224-240
Wir
fuhren nordwärts bis zur Höhe des Luftflottenstützpunktes Vandenberg an der
kalifornischen Küste. Kurz darauf erhielt ich eine Mitteilung, daß ich als
Funkoffizier auf die Koliwan versetzt werden sollte, einem anderen
russischen Trawler der großen sowjetischen Flotte außerhalb der Gewässer
von Nordamerika.
Während
die Tage verstrichen und aus Juli August wurde, dachte ich mehrmals an Simas
Kudirka und welcher Zukunft er entgegensah: Im günstigsten Falle 10 Jahre
Gefängnis. Die Sowjets wußten, daß, wenn erst einmal der Prozeß vorüber
war, die Welt Kudirka vergessen würde, und dann konnte er für immer im
Gefängnis bleiben — er könnte auch dort einen "Unfall" haben.
wikipedia
Simas_Kudirka *1930

Wenn
das das Schicksal eines gewöhnlichen Fischers war, was würde erst mir, einem
Marineoffizier und kommunistischen Jugendführer, bevorstehen? Ich wußte, was
passieren würde. Ich würde tot sein, bevor ich noch
Rußland erreichte, wenn man mich erwischte oder auslieferte.
Während
wir uns mit jedem Tag mehr der Küste Kanadas näherten, rückte auch der
Zeitpunkt heran, der für mich über Leben und Tod entscheiden würde. Ein
Zurück gab es für mich nicht mehr. Während wir für kurze Zeit außerhalb
der Zwölf-Meilen-Zone vor Vancouver lagen, erhielten wir den Befehl, mit
einem weiteren russischen Trawler, der Schturman Elagin,
zusammenzutreffen, der mich als nächsten Funkoffizier übernehmen sollte. Die
Versetzung wurde auf der Höhe von Vancouver vollzogen, und die Elagin
nahm darauf umgehend Kurs auf die Amchitka-Insel vor der Küste Alaskas, die
als Versuchsgegend für unterirdische Atomwaffenversuche diente.
Wenn
ich "Trawler" sage, dann benutze ich den Ausdruck, den auch die
sowjetische Marine benutzt. Wenn die Schiffe, auf denen ich war, sich
tatsächlich auf Fischfang befanden, dann mußten die Fische schon sehr
schnell schwimmen und dazu noch von selbst an Deck springen. Wir fuhren
ziemlich schnell und ignorierten die Fische samt und sonders.
Während
dieser Tage auf See hörte ich mit Vorliebe die "Stimme Amerikas",
um zu wissen, was wirklich in der Welt passierte.
Schon
in Rußland hatte ich es oft gehört, und ich wußte, daß der größte Teil
der russischen Bevölkerung und auch viele der Marinekadetten das gleiche
taten. Natürlich war es gefährlich, und wenn man dabei geschnappt wurde,
konnte man mit schweren Strafen rechnen. Doch manchmal
ist der Hunger nach Neuigkeiten und Wahrheit größer als die Angst vor der
Entdeckung. "Die Stimme Amerikas" und religiöse Sendungen in
russischer Sprache von irgendwelchen Missionsstationen halfen mir, Kraft zu
sammeln für das, was mir bevorstand.
Ende
August 1971 erhielt die Elagin Befehl, wieder vor die Küste
Kanadas zurückzukehren. Die letzten Wochen hatte ich täglich
mehrere Stunden mit Gewichtheben und anderer Körperertüchtigung
verbracht, um zu gegebener Zeit richtig in Form zu sein, der Zeit, in der ich
enorme Kraftreserven und Ausdauer brauchen würde. Verschiedene meiner
Bordkameraden machten ihre Witze darüber und ulkten: "Hee, versuchst
du Mr. Universum zu werden?" Doch ich blieb
dabei, denn nur ich wußte, warum.
Die
Elagin hatte eine Besatzung von 110 Mann und für
je zehn Mann einen Offizier. Der Kapitän war ein fairer, aufrichtiger
Seemann, den ich sehr bewunderte. Wir verbrachten viele Stunden gemeinsam oder
spielten Schach.
Eines
Tages, als ich Informationen nach Rußland durchgab, erhielt ich wieder
Nachricht von einer in Kürze zu erwartenden Meldung. Ich machte mich bereit,
sie wie immer sorgfältig mitzuschreiben. Es war eine Mitteilung, die mich
betrat. In fünf Tagen sollte das Versorgungsschiff, Maria Uljanowa,
benannt nach Lenins Schwester, mit uns zusammentreffen und uns mit
Lebensmitteln eindecken. Ich sollte dabei auf dieses Schiff umsteigen, das
dann anschließend direkt wieder Kurs auf Rußland nehmen würde.
Nachdem
ich die Durchsage bestätigt hatte, grübelte ich darüber nach und zwar
höchst alarmiert. Ich war jetzt seit sechs Monaten auf See. Noch fünf Tage
auf der Elagin und dann zurück nach Rußland, um wahrscheinlich nie
wieder der Freiheit so nahe zu sein. Meine
größte Chance, in Freiheit zu kommen, war bis jetzt vor der Küste von Los
Angeles gewesen, doch ich konnte nicht das Risiko eingehen, zurückgeschickt
zu werden.
Es
folgte eine weitere Mitteilung über Funk, daß meine Beförderungspapiere
fertig wären und mich in Petropawlowsk erwarteten. Doch das war das
letzte, was mich jetzt interessierte. Eine
Welle der Verzweiflung überkam mich. Während die Gedanken sich in meinem
Kopf überstürzten, stießen wir auf unerwartete Schwierigkeiten in Form von
Gegenwind und schwerer See.
225
Es
dauerte nicht lange, bis wir mitten in einem Wirbelsturm steckten. Mühsam
kämpften wir uns unseren Weg voran, wobei jeder Mann und jede Maschine bis
zum letzten eingespannt waren. Verschiedene unserer Schiffe waren bei diesem
Sturm in irgendwelche Schwierigkeiten geraten, und ich verbrachte zusätzliche
Stunden im Funkraum, um Nachrichten aufzufangen und weiterzugeben, über mir
hing ein Wandkalender, den ich häufig mit meinem Blick streifte. Die Zeit
schien nur so dahinzufliegen. Die wenigen verbleibenden Tage waren Körner in
einer Sanduhr, die unaufhaltsam verrannen und damit die Stunde meiner
Entscheidung in atemberaubende Nähe brachten.
"Sergei",
befahl plötzlich der Kapitän. "Setz dich mit den kanadischen Behörden
in Verbindung. Bitte um Erlaubnis, bei diesem Sturm in ihrem Hoheitsgewässer
Schutz suchen zu dürfen."
"Jawohl",
erwiderte ich routinemäßig. Doch dann traf mich die Bedeutung dieses Befehls
wie ein Schlag. Innerhalb der kanadischen Hoheitsgewässer!
Das
war's! Wenn wir so dicht an die Küste kamen, was wir sonst nie tun würden, konnte
ich es vielleicht schaffen. Ich hatte ursprünglich beabsichtigt, außerhalb
der Zwölf-Meilen-Zone über Bord zu gehen und irgendetwas Hölzernes als
Schwimmhilfe zu benutzen. Doch ich kannte die Wassertemperatur und wußte nur
zu gut, daß ich höchstwahrscheinlich an Unterkühlung sterben würde, bevor
ich die zwölf Meilen geschafft hatte. Doch jetzt gingen wir in die
kanadischen Gewässer! Diese Aussicht füllte mich mit neuer Hoffnung und
Energie. Doch was immer auch geschehen mochte, ich hatte mich fest
entschlossen: Ich würde nicht auf der Uljanowa nach Rußland
zurückgehen, nicht zurück in dieses Leben.
Da
die endgültige Entscheidung jetzt gefallen war, nämlich zu fliehen, unter
allen Umständen und unter jeder Bedingung, konnte ich mich nun ganz auf
eine Sache konzentrieren — den Moment meiner Flucht. Und dieser Augenblick
sollte während der wildesten Sturmstärke kommen.
Am
3. September 1971 gegen zehn Uhr abends sprang ich in die schwarze,
aufgewühlte See. Nach fünf Stunden in dem eisigen Wasser erklomm ich die
etwa 70 m hohe Klippe, fiel auf der anderen Seite eine Art Schlucht hinunter,
wobei ich zerschnitten und zerschlagen unten ankam. Ich war der Kälte, dem
Wind und dem Regen ausgesetzt gewesen. Ich zitterte nur noch unkontrolliert
und blutete aus mehreren Wunden an den Beinen, den Füßen und Händen. Ich
schwamm den halben Weg durch die Bucht, die mich noch von dem Dorf trennte.
Dann begann sich alles in meinem Kopf zu drehen. Ich war zu kalt, zu
erschöpft. Ich hatte zu viel Blut verloren.
226
Ich
sah noch einmal hoch, bevor mich eine Welle von Schwindelgefühl überkam, und
das letzte, woran ich mich erinnerte, gesehen oder gedacht zu haben, waren die
Lichter der kleinen Ortschaft an der Küste. Ich muß es schaffen! Ich muß
es schaffen! Und dann gingen die Lichter der kleinen Ortschaft aus.
Ich
weiß nicht, was anschließend passierte. Es ist alles nur verschwommen in
meiner Erinnerung. Doch später erfuhr ich die ganze Geschichte von den guten
Leuten des Dorfes Tasu, die mich fanden und aufnahmen.
Dieser
Morgen des 4. September 1971 begann ungemütlich und stürmisch über der
kleinen Siedlung an der Küste der Insel Queen Charlotte. Die meisten der
Dorfbewohner arbeiteten im Bergwerk. Eine Frau allerdings, deren Haus etwa 20
m oberhalb des Strandes lag, ging um halb neun ans Telefon und sah dabei aus
dem Fenster. Es war sehr ungewöhnlich, daß sie sich überhaupt an diesem
Tage zu Hause aufhielt.
Ich
erfuhr später, daß sie normalerweise um diese Zeit an ihrer Arbeitsstelle
war, doch heute ausgerechnet zu Hause blieb. Beim Telefonieren sah sie hinaus
aufs Meer und glaubte ihren Augen nicht zu trauen.
Sie
sah mich den Strand herauftaumeln, halb nackt, erschöpft und blutend. Sofort
forderte sie telefonisch Hilfe an, und ich wurde ins Krankenhaus gebracht. Der
Arzt sagte später, daß ich vor Erschöpfung eine Herzunregelmäßigkeit
gehabt und mehrere Tage in einem schlafähnlichen Zustand verbracht hätte.
Dann
hörte ich plötzlich wie aus weiter Ferne Stimmen, die sich in einer fremden
Sprache im Flüsterton unterhielten. Ich konnte nichts verstehen. Ich fragte
mich, wo ich war. Zurück an Bord, dachte ich mit zunehmender Panik. Doch
nein, nein, das waren fremde Stimmen! Kanada! Ich mußte es geschafft
haben!
Meine
Augen begannen jetzt, Dinge zu erkennen, und ich sah in das Gesicht einer
Krankenschwester, die sich über mich beugte. Sie war die schönste Frau, die
ich je gesehen hatte. Ich lebte also! Ich war in Kanada! Ich hatte es
geschafft! Ich war der glücklichste Mensch auf der Welt!
Nach
einigen Stunden kam ein Mann ins Zimmer und sagte, daß er für mich
übersetzen würde. "Wer sind Sie?" fragte er. "Warum sind Sie
hierher gekommen? "
Vor
lauter Schmerzen konnte ich kaum sprechen, dennoch brachte ich mühsam hervor:
"Ich will nicht wieder auf das russische Schiff zurück!"
227
"Nun
gut," sagte er. "Wir werden jetzt mit den kanadischen Behörden in
Prince Rupert Kontakt aufnehmen, von wo man uns mitteilen wird, was in Ihrer
Sache zu tun ist."
Noch
am selben Nachmittag kam ein Hubschrauber und brachte mich in die Hauptstadt
von Queen Charlotte und von dort nach Prince Rupert in Britisch-Kolumbien.
Bevor ich das Krankenhaus verließ, bedankte ich mich noch bei der Schwester
und dem Arzt, die mich so gut in Tasu versorgt hatten. Außer meinem Dank
konnte ich ihnen nichts geben, zumal ich noch nicht einmal ihre Sprache
verstehen konnte.
In
Prince Rupert kam ich in die Gefangenenabteilung des Krankenhauses. Ich blieb
ein paar Tage dort und erhielt von allem das Beste — wundervolles Essen,
Ruhe und die beste medizinische Pflege. Alle waren sehr gut zu mir. Ich stand
im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses; obwohl ich ihre Sprache nicht
verstand, bekam ich doch so viel mit, daß nicht allzu viele russische
Seeleute nach Prince Rupert kamen. Ich hatte manchmal
das Gefühl, als würde man mich mit einem Wesen aus dem Weltenraum
verwechseln. Niemand sprach russisch, so versuchte ich es mit ein wenig
Deutsch, und sie fanden jemanden, der es übersetzen konnte. Diese Fremden
pflegten mich so ausgezeichnet, daß meine Kräfte bald wiederkehrten.
Mit
zunehmender Gesundheit interessierte ich mich mehr und mehr für meine
Umgebung. Eines Tages führten mich ein Beamter der Emigrationsbehörde und
ein Übersetzer aus dem Krankenhaus heraus und machten eine Rundfahrt mit mir
durch Prince Rupert. Meine Augen fielen mir fast aus dem Kopf, als ich die
vielen Autos und die hübschen Häuser sah. Ich nehme an, daß ich ziemlich
dumm aus der Wäsche guckte, denn er sagte darauf erklärend: "Hier
wohnen die Leute."
"Wer,
die Kapitalisten und Geschäftsleute?" fragte ich. Er lachte und sagte:
"Nein, die Arbeiter."
Nun,
ich glaubte das natürlich nicht. Ich dachte, das ist eine richtige
Propaganda-Tour, Sergei. Fall nicht darauf herein.
Später
brachte man mir eine Illustrierte zum Anschauen. Sie hieß so ähnlich wie
"Innendekoration leichtgemacht". Sie enthielt phantastische Bilder
von Spiegeln, Stühlen, Betten, Teppichen und wunderschönen Eigenheimen mit
teuren Möbeln. Aha! dachte ich. Das ist eine speziell von der
Regierung gedruckte Illustrierte, um mich hereinzulegen. Ich war so
aufgewachsen, in allem Positiven Propaganda zu sehen, und es war mir zur
Gewohnheit geworden, einer Regierung grundsätzlich keinen Glauben zu
schenken. Ich war zwar dem
Kommunismus entflohen, aber der Kommunismus mit all seinem Argwohn und
Mißtrauen steckte noch in mir.
228
Später,
als ich erkannte, daß normale Arbeiter tatsächlich in solchen Häusern
wohnten wie die in Kanada und daß die Zeitung nicht extra für Leute wie mich
gedruckt worden war, kam ich mir doch etwas dumm vor.
In
der russischen Propaganda heißt es, daß die Reichen nur durch die Ausbeutung
der ganz Armen so reich werden. Doch die Häuser der Arbeiter sahen,
verglichen mit Rußland, wie Paläste aus, und ich konnte nicht umhin
festzustellen, daß hier fast alle gleich gut gekleidet waren.
Ich
sah allerdings ein oder zwei Betrunkene, doch in Rußland kann man sie an
jeder Straßenecke liegen sehen, wenn man abends durch die Stadt geht. Ferner
hörten wir in unserer Propaganda immer wieder, daß in den kapitalistischen
Ländern Millionen von Menschen arbeitslos sind, die Demonstrationen
veranstalten müssen, um Brot zu verlangen und daß die Polizei sie dafür oft
brutal schlagen würde.
Obwohl
ich an der Richtigkeit dieser Behauptung gezweifelt hatte, zeigte mir meine
erste Ausfahrt in einem freien Land doch, welch große, tragische Lüge die
kommunistische Propaganda ist.
Mit
jedem Tag fühlte ich meine alte Kraft wiederkehren, und ich schaute voller
Zuversicht in die Zukunft. Doch plötzlich, ohne vorherige Warnung, gerade als
meine Hoffnungen am höchsten waren, erreichte mich eine Nachricht, die mich
in Angst und Entsetzen stürzte: Es
war durchaus möglich, daß ich doch noch den Sowjets ausgeliefert würde.
Am
nächsten Tag flog man mich nach Vancouver, wo ich im Zentral-Gefängnis
untergebracht wurde. Mein Traum von Freiheit und einem neuen Leben war in
Gefahr, in hunderttausend, hoffnungslose kleine Stücke zu zerplatzen. Warum?
Warum?
Ich
kann meine geistige Verfassung im Gefängnis von Vancouver nicht beschreiben.
Ich war allein in einem fremden Land, in das ich all meine Hoffnung und mein
Vertrauen gesetzt hatte und das sich jetzt gegen mich zu wenden schien. Ich
hatte den stürmischen, eiskalten Nordpazifik den warmen, einladenden Wassern
vor Kalifornien vorgezogen, weil ich diesem Land vertraut hatte. Ich hatte
mein Leben in seine Hände gegeben. Ich hatte hier die wunderbarste Sorgfalt,
Pflege und Hilfe von allen erfahren, denen ich begegnet war. Und jetzt wollte
mich dieses Land möglicherweise wieder ausliefern! Dem sicheren Tod! Das war
das letzte, was ich erwartet hatte! Allein der Gedanke daran verfolgte mich.
229
Ich
war allein in meiner Zelle. Mit niemandem konnte ich sprechen. Ich fühlte
mich grausam verraten und verletzt. Zeitweise gelang es mir, meine Probleme zu
vergessen, aber nur für Momente. So war es mir eine willkommene Abwechslung,
wenn mein Wächter, mit dem ich mich, so gut es eben ging, befreundet hatte,
hin und wieder aus der Zelle in den Hof ließ, wo wir zur Entspannung ein paar
Bälle hin-
und herwarfen.
Ich
hatte noch immer ein paar physische Beschwerden, doch sie waren nichts im
Vergleich zu den Schmerzen, die meine Seele quälten. Ich mußte einfach mit
jemandem sprechen. In meiner Verzweiflung wollte ich zu Gott beten. Ich kniete
nieder, wie ich es bei den Gläubigen gesehen hatte. Vielleicht würde es mir
helfen. Doch ich kannte keine Gebete. Ich war verlegen, unbeholfen und
irgendwie beschämt. Aber mein Herz war so voll, daß ich einfach mit Gott zu
sprechen begann und zwar so, wie es mir gerade einfiel. Ich wußte nicht, ob
Er mich hörte, aber für eine Weile fühlte ich mich besser.
Mein
vom Gericht ernannter Anwalt war ein freundlicher und fähiger Mann, der sein
Bestes tat, um mir zu helfen. Er bearbeitete meinen Fall mit großem Interesse
und persönlichem Einsatz, wofür ich ihm stets dankbar sein werde. Ich fragte
ihn, aus welchem Grunde ich ausgeliefert werden könnte. Er erklärte mir
daraufhin, daß Kanada und Rußland in sehr regen Handelsbeziehungen ständen
und Kanada Millionenwerte von Weizen nach Rußland exportierte. Man war daher
bemüht, die freundschaftlichen Gefühle nicht zu trüben, zumal die
russischen Behörden es unmißverständlich klargemacht hatten, daß sie mich
unbedingt zurückhaben wollten und außerdem Kossygin im nächsten Monat hier
erwartet wurde.
Wieder
allein in meiner Zelle, dachte ich: Wenn ich denen ausgeliefert werde, bin
ich erledigt.
Ich
hatte versucht, unter unglaublich großen Schwierigkeiten eine neue Heimat zu
finden, nur um Gefahr zu laufen, wieder zurückgeschickt zu werden. In meiner
Verzweiflung versuchte ich in dieser Nacht wieder, mit Gott zu sprechen und
fiel schließlich in einen unruhigen Schlaf.
Die
nächsten Tage waren voller Angst und Ungewißheit. Jeder sich
nähernde Schritt auf dem Gefängniskorridor konnte das Ende bedeuten.
Russische Schiffe lagen im Hafen von Vancouver. Es würde eine Sache von
Minuten sein, mich auszuliefern. Ich erlitt wahre Folterqualen.
War
ich erst einmal in russischer Gewalt, würde das Schicksal Kudirkas,
den man geschlagen und getreten hatte, gnädig gegenüber dem
sein, was mir bevorstand. Während dieser einsamen, angsterfüllten Tage und
Nächte lag ich oft auf meinen Knien und betete zu Gott.
230
Eines
Abends konnte ich vor innerer Spannung wieder einmal nicht schlafen. Um zwei
Uhr schaltete ich das Licht aus und lag noch wach in der dunklen Zelle. Gegen
halb drei hörte ich plötzlich Männerstimmen auf dem Korridor und näher
kommende Schritte. Vor meiner Zellentür machten sie halt. Jetzt ist es
soweit, dachte ich.
Schlüssel
rasselten, und die Tür wurde geöffnet. Jemand knipste das Licht an, und ich
sah mehrere Männer in Zivilkleidung im Eingang stehen. "Komm mit",
sagte einer von ihnen. "Nimm all deine Sachen. Wir werden eine kleine
Stadtbesichtigung unternehmen."
Eine
Stadtbesichtigung um halb drei Uhr morgens? Da mußte etwas anderes
dahinterstecken! Sie brachten mich hastig durch den Hinterausgang des
Gefängnisses in einen dort wartenden Wagen, in dem drei Beamte in
Zivilkleidung saßen. Der Fahrer fuhr los in die Dunkelheit. Selbst um halb
drei Uhr morgens war die Straßenbeleuchtung noch an, und ich konnte sehen,
wie groß und wundervoll Vancouver wirklich war. Es war die erste große Stadt
in der freien Welt, die ich gesehen hatte. Wir fuhren durch die Hauptstraßen,
dann mit voller Geschwindigkeit durch kleine Seitenstraßen. Der Fahrer schlug
immer wieder entgegengesetzte Richtungen ein, fuhr in unbeleuchtete Gassen,
bog wieder scharf nach rechts oder links und das alles in einem Höllentempo.
Diese
"Tour durch die Stadt" dauerte ungefähr zwei Stunden. Endlich,
gegen halb fünf, parkte er irgendwo, ging in eine durchgehend geöffnete
Imbißstube, führte ein Telefongespräch und kam wieder heraus. "Alles
in Ordnung", sagte er. "Es kann losgehen." Wir fuhren wieder
los und zwar diesmal zum Flughafen — nicht auf einen Parkplatz sondern
gleich zur Rollbahn, wo er vor einem großen Flugzeug hielt. Wir gingen an
Bord. Es waren nur wenige Passagiere da, einschließlich der Polizeibeamten,
die mich begleitet hatten.
Wir
flogen quer über Kanada, in den bereits dämmernden neuen Tag und landeten
schließlich in Montreal. Ich wurde schnell wieder in einen nicht
gekennzeichneten Polizeiwagen verfrachtet, rechts und links von Polizisten
umgeben. Dann brachte man mich nach Quebec City in ein Gefängnis, das auf
einer Insel im St. Lawrence River lag und zwar in eine verschlossene Zelle.
Zu
dieser Zeit wußte ich noch nicht, daß nur wenige Tage später der
sowjetische Dampfer Alexander Puschkin den St. Lawrence River
heraufkommen und in unmittelbarer Nähe vor Anker gehen sollte.
wikipedia
Marco_Polo_Schiff,_1965
Nach
meiner Überlegung konnte mein heimliches Fortbringen aus Vancouver nur eines
bedeuten: eine Übergabe an die sowjetischen Behörden.
231
Mein
Fall hatte in Britisch-Kolumbien bei der Bevölkerung viel Staub aufgewirbelt,
und viele Leute hatten mir ihr Interesse und ihre Sympathie bezeigt. Aus
diesem Grunde dachte ich auch, sollte die Auslieferung am entgegengesetzten
Ende von Kanada vollzogen werden, wo mich niemand kannte. Für mich gab es nur
zwei Erklärungen für das heimliche Verlassen des Zentral-Gefängnisses in
Vancouver, die mitternächtliche "Stadtbesichtigung" und den Flug
quer über Kanada: entweder, um mich vor unbekannten Feinden zu schützen
oder, was wahrscheinlicher war, mich ohne großes Aufsehen den Russen zu
übergeben. Zu dieser Zeit allerdings hatte ich wenige Zweifel, daß es das
letztere war.
Doch
im Westen Kanadas bemühten sich einige meiner neuen Freunde, mir zu helfen. Ein
Unbekannter — jedenfalls weiß ich bis heute nicht, wer es war —
rief Pat Burns an, einen Mann, der beliebte RadioInterviews durchführte und
informierte ihn von meinem Verschwinden. Herr Burns hatte meine Geschichte im
Radio erzählt und sich besonders für meinen Fall interessiert.
Da
er fürchtete, daß ich jeden Augenblick ausgeliefert werden könnte, handelte
er sofort. Während einer Direktübertragung telefonierte er mit Ottawa, um
den zuständigen Parlamentsabgeordneten für Vancouver zu sprechen. Pat Burns
teilte ihm mit, was passiert war. Dieser Parlamentsabgeordnete wandte sich
daraufhin, ohne Zeit zu verlieren, an Premierminister Pierre
Trudeau und verlangte eine direkte Antwort auf die Frage, ob die
kanadische Regierung geplant habe, mich an die Russen auszuliefern. Er
verlangte außerdem eine umgehende öffentliche Stellungnahme vor der Presse,
die über diesen Fall berichtete.
Mit
meiner Notlage jetzt so an die Öffentlichkeit gebracht, wo es großes
Interesse erregte und zu meinen Gunsten viel Staub aufwirbelte, war es jetzt
den Behörden nicht mehr möglich, mich auszuliefern, und die Gefahr war
vorüber. Ich habe nie erfahren, wie groß sie wirklich
war und ob ich tatsächlich ausgeliefert worden wäre. Für mich
jedenfalls war es so, als hätte ich die letzten Tage unter dem berühmten
"Damoklesschwert" gesessen.
Inzwischen
lief ich nervös, betend und wartend in meiner Zelle auf und ab. Ich wußte
nicht, daß meine flehentlichen Gebete erhört worden waren.
Als
man mir dann auf einmal mitteilte: "Sie können in Kanada bleiben",
war ich beinahe wie vom Schlag gerührt. Ich fühlte die Ketten von mir
abfallen, obwohl ich immer noch hinter Gefängnismauern saß. Es war, als wenn
mir mein Leben neu geschenkt worden wäre. Ich war ein freier Mensch in einem
freien Land. Obwohl ich so darauf gewartet hatte, konnte ich es jetzt kaum
fassen. Doch es war endlich Wahrheit!
232
Ich
dankte Gott von Herzen, daß Er meine Gebete erhört
hatte, so schlecht ich mich Ihm und Seinen Kindern gegenüber auch benommen
hatte.
Ich
blieb noch ein paar Wochen in verschiedenen Gefängnissen Kanadas, während
meine Papiere bearbeitet und meine Geschichte nachgeprüft wurde. Doch da ich
jetzt wußte, daß ich nicht mehr ausgeliefert würde, war es eine wundervolle
Zeit. Ich spielte Gitarre. Ich sang. Ich komponierte Lieder. Ich bekam Briefe
von verschiedenen Leuten aus Kanada, die meine Geschichte gelesen hatten. Ich
hatte Freunde, die mich besuchen kamen. Und ich war der kanadischen Regierung
für diesen Entschluß unendlich dankbar. Nie werde ich ihr diese
Freundlichkeit vergessen.
Es
kamen auch andere, weniger willkommene Besucher. Eines Tages erschien der
zweite Sekretär der russischen Botschaft. Er sprach mit mir in Anwesenheit
von kanadischen Beamten und sagte: "Wir wissen, daß Sie noch sehr
jung sind und einen Fehler gemacht haben. Wenn Sie zurückkommen, werden wir
Ihnen alles vergeben, und alles vergessen. Sie werden Ihre frühere Position
wiedererhalten, und alles wird wie früher sein."
Ich
antwortete ihm darauf, daß ich niemals wieder zurückkehren könnte.
Dann
überreichte er mir einen Brief von meiner früheren Freundin, Olga, die mich
mit dringenden Worten bat, zu ihr zurückzukehren und mir ebenfalls versprach,
daß alles vergeben und vergessen sei — fast die gleichen Worte, die auch
der Botschaftsangestellte benutzt hatte. Als ich jedoch bei meiner ablehnenden
Haltung blieb, sagte der russische Beamte abschließend: "Kourdakov,
eines Tages werden Sie zu uns kommen und darum betteln, zurückkehren zu
dürfen!"
Kurz
darauf waren meine Einwanderungspapiere fertig, und es wurde mir gesagt, ich
sei jetzt ein freier Mann, frei, das Gefängnis zu verlassen und ein neues
Leben in Kanada zu beginnen.
Während
meiner Wochen im Gefängnis war ein Regierungsbeamter zu mir gekommen und
sagte etwa in dem Sinne: "Herr Kourdakov, wir haben Ihre Geschichte
sorgfältig von Anfang bis Ende nachgeprüft. Wir haben all Ihre Angaben in
einen Computer gegeben, der besonders darauf programmiert ist, Analysen zu
stellen. Wir haben dabei die Wassertemperatur berücksichtigt, die Richtung
und Stärke des Windes, die enorme Sturmstärke, die Entfernung vom Schiff bis
zur Küste, die Höhe der Wellen — selbst Ihre physische Kraft.
233
Unsere
Wissenschaftler haben all dieses mit Hilfe des Computers getestet, doch die
fertige Analyse hat ergeben, daß Sie unmöglich diese Strecke unter diesen
Bedingungen zurücklegen und überleben konnten. Ist da vielleicht doch noch
irgend etwas, irgend etwas, das Sie vergessen haben,
uns zu erzählen?"
Ich
dachte einen Augenblick nach und sagte dann: "Das einzige, was ich nicht
angegeben habe, ist, daß ich sehr viel zu Gott gebetet habe."
Er
ging, kam dann aber ein paar Tage später wieder. "Herr Kourdakov",
sagte er, es wird Sie interessieren, daß wir nochmals all Ihre Angaben,
einschließlich Ihrer Gebete, in den Computer gefüttert haben, mit dem
Ergebnis, daß Ihr überleben möglich war. Wir sind jetzt von der Wahrheit
Ihrer Geschichte überzeugt."
Ich
war überrascht. Was wußte ein Computer von Gott? Später erklärte
man mir, daß meine Gebete zu Gott als "psychologische Kraft"
gewertet wurden. Und das war der motivierende Faktor, der selbst auf Grund der
Computerberechnung mein Überleben möglich gemacht
hatte.
Ich
verließ das Gefängnis von Quebec als freier Mann und mietete mir
ein Zimmer in einem kleinen Hotel. Dort und auch schon vorher traten
verschiedene Leute mit mir in Verbindung und boten mir ihre Hilfe an, einen
Arbeitsplatz oder eine Möglichkeit zu wohnen. Ein Stellenangebot war dabei,
das entgegen all meinen Erwartungen war: Ein
Veranstalter von Schwimmwettbewerben in Ontario schrieb mir, daß er für
nächstes Jahr einen großen Sommerschwimmwettbewerb plane. Da ich in ganz
Kanada eine Art Berühmtheit als Schwimmer geworden war, wollte er mir 150,-
Dollar zahlen, wenn ich im Rahmen seiner Veranstaltung 25 Meilen schwimmen
würde. "Jedermann kennt Sie als großartigen Schwimmer", schrieb
er. "Die Leute werden von überall herkommen, um Sie schwimmen zu sehen.
Wir können zusammen ein gutes Geschäft machen."
Nun,
ich bin zwar ein guter Schwimmer, aber ich schrieb ihm, daß es Gott war, der
mir die Kraft gegeben hatte, so lange im Ozean schwimmen zu können und daß
ich daher sein Angebot nicht annehmen könne.
Für
mich gab es jetzt zwei Dinge von größter Wichtigkeit: Das erste
war, mein Versprechen Gott gegenüber einzulösen. Ihm zu dienen. Das zweite
war, eine Arbeit zu finden, mich in Kanada niederzulassen und als freier
Mensch zu leben. Ich war mir im klaren darüber, daß mein zweites Vorhaben
leichter durchzuführen war als das erste.
234
Die
Priorität hatte allerdings der Wunsch, Gott zu finden. Doch wie? Wo? Ich
wußte so gut wie nichts über Gott und kannte auch keinen Pastor, mit dem ich
hätte darüber sprechen können. Doch im Zentrum von Quebec hatte ich eine
große Kirche gesehen, die Kirche der Heiligen Anna. Dorthin beschloß ich zu
gehen, denn ich dachte, wenn das ein Gotteshaus ist, dann ist es hier, wo
ich Gott finden kann. Ich ging hinein und wußte nicht so recht, wie ich
mich verhalten sollte. Es waren noch ein paar andere Leute da, und ich
beschloß, ihnen alles nachzutun.
Sie
gingen nach vorn und knieten nieder. Ich tat das gleiche. Sie begannen zu
beten, und ich versuchte es auch, wußte aber nicht, was ich sagen sollte,
denn ich fühlte mich unbeholfen und nicht wert, im Hause Gottes zu sein.
Ich
hatte die Gläubigen in Rußland geschlagen und getötet. Ich hatte mehr als
150 geheime Zusammenkünfte der Untergrundkirche überfallen. Ich hatte
Bibeln verbrannt. Ich hatte alte Frauen und viele Gläubige verletzt. Ich war
es nicht wert. Und doch fühlte ich eine innere Ruhe über mich kommen, und
ich begann mit Gott zu reden, wie ich es im Ozean und in den Gefängnissen
getan hatte.
Nachdem
ich so eine Weile gebetet hatte, fühlte ich, wie meine Last leichter wurde.
Er war eine ungeahnte Ruhe und ein nie gekannter Friede, der mein Herz
erfüllte. Wenn es das war, was Gott den Seinen gab, dann wollte auch ich es
haben, mehr als alles auf der Welt. Drei Stunden hatte ich so vor Gott
gekniet, und ich hatte wirklich das Gefühl, als wäre mir geholfen worden,
doch ich suchte noch nach mehr, nach etwas, was die Gläubigen in den
Untergrundkirchen hatten. Ich wollte haben, was Natascha hatte ...
Ich
verließ die Kirche und ging zurück auf mein kleines Zimmer. Dort erwartete
mich eine Nachricht, daß sich jemand mit mir über eine Arbeitsstelle
unterhalten wolle. Dazu sollte ich zu einem Interview zu einer bestimmten
Adresse kommen. Zwei junge Bulgaren, die einige Monate früher nach Kanada
geflohen waren, halfen mir als Übersetzer und auch sonst in meinem neuen
Leben. Ich hinterließ ihnen eine Nachricht, wo ich zu finden war, dann machte
ich mich auf den Weg zu der angegebenen Adresse. Verschiedene Leute warteten
dort bereits auf mich. Sie hatten nicht die geringste Absicht, mit mir über
Arbeitsmöglichkeiten zu reden. Nichts schien ihnen ferner zu liegen als das,
denn sie waren, wie sich bald herausstellte, Mitglieder der FLO, der
französischen Separatisten- und Terror-Organisation in Quebec, die
Bombenanschläge verübten und in ihren Bemühungen, sich von Kanada zu
lösen, selbst Diplomaten umgebracht hatten.
235
Sie
besaßen starke kommunistische Verbindungen und Unterstützung. Ich sah mich
um und bemerkte sofort, ich war in eine Falle gegangen.
"Kourdakov,"
warnten sie mich, "solltest du deinen Mund zu weit aufmachen und Dinge
sagen, die besser ungesagt bleiben, werden wir dich zum Schweigen
bringen!"
Ich
versuchte mit ihnen zu sprechen, um Zeit zu gewinnen und einen Weg zu finden,
heil hier wieder herauszukommen. Glücklicherweise kamen sehr bald meine
beiden bulgarischen Freunde, die meine Nachricht gefunden hatten und mir auf
schnellstem Wege gefolgt waren. Ich verschwand sofort mit ihnen, während mir
die Warnungen noch in den Ohren klangen. Ich wußte jetzt, daß ich selbst
hier, als freier Mann, nicht in Ruhe gelassen würde. Moskau streckte noch
immer die Hand nach mir aus.
In
Quebec folgte mir ein Mann von der russischen Botschaft auf Schritt und Tritt.
Die. Polizei warnte mich, daß ein sowjetisches Schiff im Hafen von Montreal
läge und bat mich, vorsichtig zu sein.
"Rufen
Sie uns an, wenn Sie sich bedroht fühlen", sagten sie. Mit der Drohung
der FLO im Rücken und den ziemlich starken Kommunisten in Quebec
beschloß ich, diese Stadt zu verlassen und nach Toronto zu gehen. Es gab ein
russisches Konsulat in Montreal und eine russische Botschaft in Ottawa, und
von all dem wollte ich so weit weg wie möglich sein.
So
kam ich denn nach Toronto und wohnte dort bei einer russischen Familie, die
meine Geschichte gelesen und mir ihre Hilfe angeboten hatte.
Die
kanadische Regierung bezahlte mein Englischstudium an der Universität, und
ich machte mich mit Feuereifer daran, die neue Sprache
zu meistern.
Doch
erstrangig in meinem Geist war die Suche nach Gott. Ich fühlte einen
geistlichen Hunger, den ich nur schwer beschreiben kann, und ich wußte, ich
würde erst dann ein vollkommener Mensch sein, wenn dieser Hunger gestillt
war. Es war nicht nur ein Gefühl der Reue, weil ich die Gläubigen in
Rußland geschlagen und getötet hatte. Ich wußte, daß Gott mir das vergeben
hatte, denn es war aus Unwissenheit geschehen. Was ich fühlte, war eine
aufrichtige, tiefe geistliche Not in meinem Leben. Ich wußte, ich würde
nicht eher ein wirklich freier Mann sein, als bis auch mein Geist genauso frei
war wie mein Körper. Ich erinnerte mich daran, daß einer der Gläubigen bei
einem Verhör gesagt hatte, daß sie oft fasteten, wenn sie mit besonderer
Dringlichkeit um etwas beteten. Und ich dachte, vielleicht ist es das, was
ich tun sollte. Bald darauf ging ich in eine Kirche in Toronto, die
ich einmal mit einer befreundeten Familie aufgesucht hatte. Diese Kirche war
immer geöffnet.
236
Es
war niemand da, so ging ich nach vorn und begann zu beten. Ich blieb zwei
ganze Tage dort und nahm in dieser Zeit nur Wasser zu mir. Ich wußte nicht,
welche Worte ich wählen sollte, doch mein Herz betete für mich. Es konnte
all das ausdrücken, was ich fühlte. Nach zwei Tagen, in denen ich nachts nur
etwa drei Stunden schlief, verließ ich die Kirche und ging wieder zur Schule
zurück.
Ich
fühlte mich geistig gestärkt, aber trotzdem schien noch etwas zu fehlen.
Etwa
um diese Zeit erhielt ich eine Karte von Valentine Bubowitsch, einem
russischen Mädchen, das als Bibliothekarin an einer Universität in der Nähe
von Toronto arbeitete. Sie schrieb mir, daß sie Christin sei und lud mich
ein, in ihre Gemeinde zu kommen. Ich willigte gern ein.
Als
ich dann am nächsten Sonntag die Kirche betrat, gewahrte ich etwas
Vertrautes. "Das ist ja hier wie in Rußland!" rief ich überrascht
aus. Ich dachte an die Lieder, den Geist und die Gemeinschaft, die ich in der
russischen Untergrundkirche bemerkt hatte. Valentines Vater gab mir ein
Psalmbuch, das mir eine große Hilfe war.
Ich
begann jetzt, in ukrainische Kirchen zu gehen und fand dort eine wundervolle
geistige Lebendigkeit - besonders unter den jungen Leuten. Eines Tages wurde
ich mit einem Pastor bekannt, der von mir gehört hatte, und wir unterhielten
uns. Ich sagte ihm, daß mein Herz immer noch in einer gewissen Weise leer war
und, obwohl physisch befreit, ich mich doch nicht vollkommen fühlte, und ich
erklärte ihm, wie es mein größter Wunsch war, Gott zu gehören und Ihm zu
dienen. Er verstand mich und beantwortete mir manche Frage, erklärte mir
Bibelstellen und zeigte mir den Weg zu Gott. Ich werde ihm immer dafür
dankbar sein.
Eines
Tages während des Gottesdienstes sagte er: "Sergei, bist du bereit, dein
Leben ganz und gar Gott zu übergeben?"
"Ja", erwiderte ich.
"Dann laß uns zusammen beten", sagte er.
Und
während wir beteten, geschah etwas in meinem Leben — etwas Endgültiges,
Konkretes und Wunderbares. Ich fühlte plötzlich den Frieden Gottes in mir,
und ich wußte, daß meine Suche nach dem neuen Leben vorüber war.
Ich
übergab es Jesus Christus, und Er trat in mein Leben. An diesem wundervollen
Tag wurde ich neu geboren, und die innere Leere wurde von Ihm gefüllt. Der
Gedanke war wunderbar, daß ich jetzt auch dazugehörte, neben Natascha,
Pastor Litowtschenko und den anderen Gläubigen, die ich verfolgt hatte.
237
Jetzt
war ich einer von ihnen! Der Pastor unterwies mich noch oft, damit ich im
Glauben wachsen sollte. Eines Tages sagte er zu mir: "Sergei, du bist
jetzt ein Christ, und
du brauchst eine Bibel in deiner Muttersprache."
Und
damit reichte er mir eine kleine, schwarze, russische Bibel. Ich stand da —
wie vom Donnerschlag gerührt. Ich traute meinen Augen
nicht!
Der
Pastor sah meinen Schock und fragte erstaunt: "Was ist los? Was
hast du?"
"Diese
Bibel!" rief ich aus. "Ich habe genau die gleiche schon einmal
gesehen!"
"Wo?"
"In den Untergrundkirchen von Rußland!"
Ich
schlug sie auf und blätterte darin. Ja, das war sie. Es war die gleiche
Bibel.
"Das
ist schon sehr gut möglich", erwiderte der Pastor. "Es ist eine von
den Bibeln, die von einer Organisation mit Namen "Underground
Evangelism" gedruckt und nach Rußland gebracht werden."
"Wo
kann ich sie finden?" fragte ich. "Ich möchte ihnen danken und
ihnen sagen, daß ihre Bibeln ankommen."
Er
gab mir daraufhin die Anschritt dieser Organisation, und ich bat
einen Freund, für mich dort anzurufen. Ich sprach mit dem Vorsitzenden, L.
Joe Bass, der sich sehr für mich interessierte und mich auch
gern persönlich kennenlernen wollte.
Wir
hatten auch bald Gelegenheit dazu, als er auf seinem Weg nach Europa
den Umweg über Toronto machte. Wir unterhielten uns mehrere Stunden lang, und
ich erfuhr von der Arbeit, die diese .Organisation leistet, um den verfolgten
Christen in Rußland und anderen kommunistischen Ländern zu helfen, und ich
dankte ihm im Namen
der russischen Menschen.
Mein
Englischkurs ging dem Ende zu, und ich war bald so weit, eine
Arbeit annehmen zu können. Ich erhielt auch ein gutes Angebot von einer
Elektronikfirma als Radioingenieur, und ich sah voller Erwartung in mein neues
Leben. Ich würde ein gutes Gehalt bekommen, könnte mir einen Wagen leisten,
später eine Familie gründen und ein eigenes Heim haben. Das war natürlich
alles sehr verlockend für mich. Doch während ich über all diese angenehmen
Dinge nachdachte, konnte ich die Erinnerungen an Rußland nicht loswerden. Ich
konnte nicht die vielen Gläubigen vergessen, die immer noch um ihres Glaubens
willen geschlagen wurden. Ich mußte an den jungen Mann denken, der meinen
Platz in Nikiforows Sonderteam eingenommen hatte.
238
Ich
konnte die Bibeln nicht vergessen, die immer noch verbrannt wurden und die
Gläubigen, die sich noch immer heimlich trafen. Ich
dachte an die Millionen von russischen Jugendlichen, die, wie ich,
irregeführt, illusionslos und enttäuscht nach der Wahrheit suchten. Ich
konnte nicht anders, ich mußte alles tun, was in meinen Kräften stand, um
ihnen zu helfen.
So
begann ich denn, öffentlich zu sprechen, in Kirchen, vor der Presse, im
Fernsehen und bei anderen Gelegenheiten. Ich sprach von den Verfolgungen und
Schwierigkeiten in Rußland und auch darüber, was es für mich bedeutete,
Christ geworden zu sein. Schließlich bat ich die Menschen, für mein Volk zu
beten und ihnen zu helfen, soweit es im Bereiche des Möglichen lag.
Eines
Tages kam ich vom Dundas Westbahnhof in Toronto und war auf meinem
Nachhauseweg. Als ich merkte, daß ich verfolgt wurde, blieb ich plötzlich
stehen und wandte mich abrupt um. Hinter mir standen drei bärenstarke Kerle. Einer
von ihnen sagte in einwandfreiem Russisch: "Wenn du weißt, was
für dich gut ist, dann hältst du den Mund! Wenn du noch einmal den Mund
aufmachst, wirst du einen tödlichen Unfall haben. Denke daran, du bist
gewarnt worden!"
Dann
wandten sie sich um und waren in wenigen Augenblicken in der Dunkelheit
verschwunden.
Ich
kannte die sowjetische Polizei gut genug, um zu wissen, daß dies keine leere
Drohung war. Ich wußte aber auch, daß ich eine große Verantwortung meinem
Volk gegenüber hatte, besonders gegenüber denen, die so schwer für ihren
Glauben verfolgt wurden. Wenn ich schwieg, wer sollte dann für sie sprechen?
Wer würde von ihren Qualen erfahren?
Und
so entschloß ich mich, trotz dieser Drohung zu tun, was ich glaubte, tun zu
müssen.
Natürlich
wünschte ich mir ein Zuhause, eine Familie und ein normales, geregeltes
Leben, Dinge, die ich nie selbst kennengelernt hatte. Doch bevor ich daran
denken konnte, mußte ich etwas für die tun, die ich zurückgelassen hatte.
Ich mußte ihre Geschichte erzählen und ihnen helfen. Und ich mußte den
Menschen zeigen, besonders den jungen, an meinem eigenen Leben, daß es einen
Gott gibt und daß er selbst das verpfuschteste Leben verändern kann, wie Er
es an mir bewiesen hatte.
239
Die
Seele des großen russischen Volkes ist nicht tot. Sie ist nicht erstickt
unter einer fremden, gottlosen, sterilen Ideologie. Und sie wird auch nicht
ersticken, solange es Männer gibt wie Alexander Solschenizyn, Frauen
wie Natascha Sdanowa und Millionen von anderen, in denen der Funke des
Glaubens und der Liebe nicht erloschen ist.
Es
ist vielmehr so, daß in Tausenden von Untergrundkirchen die Flamme des
Glaubens heller leuchtet denn je und die Bindungen an göttliche Prinzipien
wahrscheinlich gerade durch die brutalen Verfolgungen mehr wachsen als je
zuvor. Eines
Tages vielleicht werden jene einzelnen, brennenden Lichter von Glaube und
Liebe in einer einzigen großen Flamme aufleuchten.
Ich
habe eine stille Botschaft an alle die Gläubigen in Rußland, die so viel
dazu beigetragen haben, daß mein Leben anders wurde. Diese Botschaft habe ich
in diesem Buch niedergeschrieben, in der Hoffnung, daß es eines Tages
irgendwie zu ihnen gelangt und daß sie verstehen werden.
An
Frau Litowtschenko, der gelähmten Frau des Pastors, den wir bei Elisowo
getötet hatten: "Ich möchte Ihnen sagen, daß es mir unendlich leidtut,
mehr, als Sie es sich jemals vorstellen können."
An
Nina Rudenko, das hübsche junge Mädchen, dessen Leben durch meine
Attackiergruppe ruiniert wurde: "Bitte, vergib uns!"
Und
schließlich an Natascha, die ich fürchterlich geschlagen hatte und die
willens war, sich für ihren Glauben noch ein drittes Mal schlagen zu lassen,
ihr möchte ich sagen:
"Natascha,
hauptsächlich deinetwegen ist mein Leben verändert, und ich bin jetzt dein
Bruder in Jesus Christus. Ein neues Leben liegt vor mir. Gott hat mir
vergeben. Ich hoffe, du kannst es auch. Danke,
Natascha, wo immer du auch bist. Ich werde dich niemals, niemals
vergessen!"
Ende
240
|
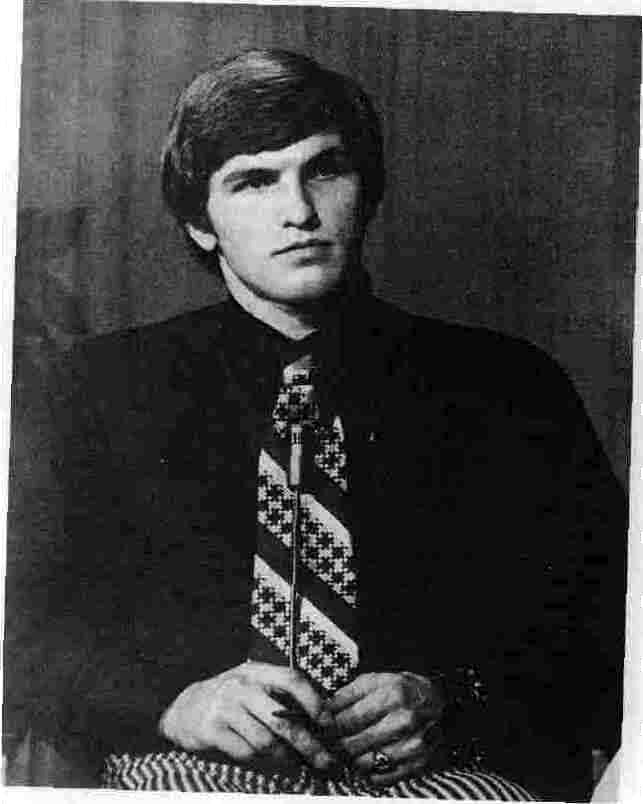
|
Für
Sergei Kourdakov gilt das Wort von 2. Korinther 5,17
Darum,
ist jemand in Christus,
so ist er eine neue Schöpfung;
das Alte ist vergangen, siehe,
es ist etwas Neues geworden!
|
241
Nachwort
des Herausgebers
Kurz
nach der Fertigstellung des Entwurfes für dieses Buch starb Sergei. Er
widmete sein "neues Leben" der Aufgabe, die Christen Nordamerikas
auf die Notlage der russischen Christen hinzuweisen und bat um Bibeln und
Hilfe jeder Art für sie.
Von
Januar bis April 1972 erzählte er seine Geschichte in vielen Kirchen in
Kanada. Am 1. Mai des Jahres trat er der Organisation Underground
Evangelism bei (in Deutschland und der Schweiz ist es die Christliche
Ostmission). Diese Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, den
Gläubigen in den kommunistischen Ländern Bibeln und jede erdenkliche Hilfe
zukommen zu lassen.
Er
sprach in Gemeinden, im Fernsehen, gab Zeitungsinterviews und sprach vor
Regierungsvertretern. Er erzählte von den Christenverfolgungen und sprach
über die Methoden der Geheimpolizei. Außerdem arbeitete er an seinem Buch
und sagte, daß er voller Freude auf den Augenblick warte, wo
er über Radio zu der Jugend in Rußland sprechen könne. Die
Vorbereitungen hierzu liefen, als die Nachricht von seinem Tod kam.
Verschiedentlich
hatte er erwähnt, daß er sich bedroht fühlte, und schließlich lieh er sich
eine Pistole zum Selbstschutz. Am
1. Januar 1973 starb er durch eine Kugel aus dieser Pistole. Obwohl die
Nachricht von seinem Tod erst als Selbstmord durch die Weltpresse ging, wurde
diese Möglichkeit dann doch bald ausgeschlossen. Ein Verfahren wurde
eingeleitet, und am 1. März 1973 wurde sein Tod als Unfall erklärt.
Genau
an diesem Tag wäre Sergei zweiundzwanzig Jahre alt geworden.
242
#
^^^^
www.detopia.de