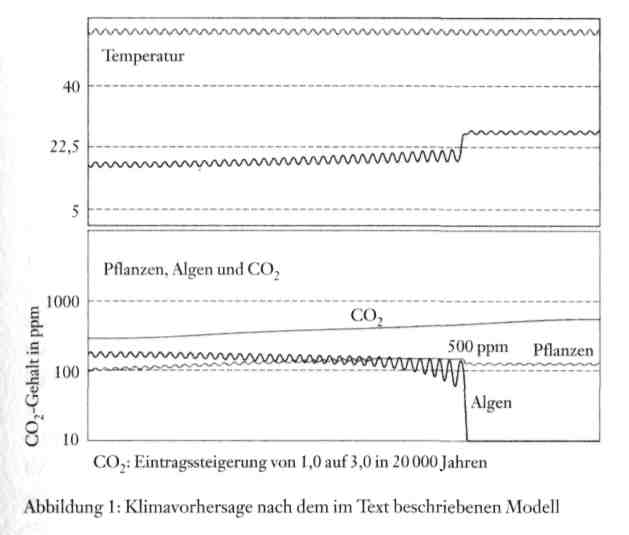Kaum
jemand scheint zu wissen, was Gaia eigentlich ist; ich selbst wusste es die
ersten zehn Jahre nach Einführung des Begriffs nicht. Die meisten
Wissenschaftler benutzen den Ausdruck »Biosphäre«*, wenn sie über den
lebendigen Teil der Erde sprechen oder nachdenken, auch wenn genau genommen
die Biosphäre nichts weiter ist als diejenige geografische Region, in der es
Leben gibt: die dünne sphärische Blase um die Erdoberfläche herum.
Unbewusst haben sie die Definition von Biosphäre zu etwas Größerem als
einer geografischen Region ausgeweitet, aber es bleibt unklar, wo diese
beginnt oder endet und was sie tut.
*
im Glossar
Vom
Mittelpunkt aus betrachtet besteht die Erde fast völlig aus heißen oder
geschmolzenen Gesteinen und Metallen. Gaia ist eine
dünne, kugelförmige Materieschale, die das glühende Innere umgibt.
Sie beginnt dort, wo die Erdkruste an das heiße Magma des Inneren
anschließt, rund 150 Kilometer unterhalb der Oberfläche, und erstreckt sich
weitere 150 Kilometer durch den Ozean und die Luft hinaus bis zur heißen
Thermosphäre am Rand des Weltalls. Sie schließt die Biosphäre ein und ist
ein dynamisches physiologisches System, das auf unserem Planeten seit über
drei Milliarden Jahren Leben ermöglicht.
Ich
bezeichne Gaia als physiologisches System, weil sie das unbewusste Ziel
zu haben scheint, das Klima und die Chemie so zu regulieren, dass sie dem
Leben zuträglich sind. Gaia strebt keine festen Werte an, sondern solche, die
jeweils an die momentanen Umweltverhältnisse und die Gaia bewohnenden
Lebensformen angepasst sind.
Wir
müssen uns Gaia als ein Gesamtsystem aus belebten und unbelebten Teilen
vorstellen. Dass das Sonnenlicht ein vielfältiges Wachstum von Lebewesen
ermöglicht, verleiht Gaia ihre Fähigkeiten, aber diese wilde, chaotische
Macht wird von Grenzen gezügelt, welche die zielgerichtete Entität formen,
die sich zugunsten des Lebens selbst reguliert. Diese Grenzen des Wachstums zu
erkennen ist meiner Meinung nach für das intuitive Begreifen von Gaia
entscheidend. Wichtig dabei ist zu verstehen, dass die Grenzen nicht nur die
Organismen oder die Biosphäre betreffen, sondern auch die physische und
chemische Umwelt.
Es
liegt auf der Hand, dass es für den größten Teil des Lebens zu heiß oder
zu kalt sein kann, weniger bekannt ist jedoch die Tatsache, dass der Ozean zu
einer Wüste wird, wenn seine Oberflächentemperatur über rund 12°C steigt.
Passiert dies, bildet sich eine stabile Oberflächenschicht von warmem Wasser,
die sich nicht mit den kühleren nährstoffreichen Schichten darunter mischt.
Diese rein physikalische Eigenschaft des Meerwassers verweigert dem Leben in
der warmen Schicht die Nahrung, und bald wird das obere, vom Sonnenlicht
beschienene Wasser zu einer Wüste. Das mag einer der Gründe sein, warum Gaia
anscheinend die Erde kühl zu halten versucht.
Sie
werden bemerken, dass ich immer mal wieder die Metapher »lebendige Erde«
für Gaia verwende; gehen Sie aber nicht davon aus, dass ich die Erde als eine
empfindungsfähige Lebensform wie etwa ein Tier oder ein Bakterium betrachte.
Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir die in gewisser Weise dogmatische und
beschränkte Definition ausweiten, dass Leben etwas sei, das sich reproduziert
und die Fehler der Reproduktion durch natürliche Auslese der Nachkommenschaft
korrigiert.