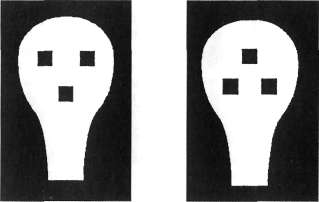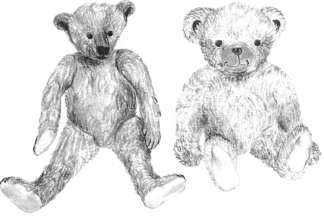Start
Weiter
3.
Vorprogrammierungen
52-63
Warum
verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten, und nicht anders? Diese
Grundfrage aller Verhaltensforschung (Ethologie) kann nach
Interessenlage des jeweiligen Fragestellers auf verschiedene Weise beantwortet
werden. Den Physiologen interessiert die Funktionsweise der den
Verhaltensleistungen zugrundeliegenden physiologischen »Maschinerie«. Auf
diesem Gebiet kann auch ein Fundamentalist, der das Evolutionsgeschehen
leugnet, ein guter Physiologe sein.
Biologen
sind jedoch darüber hinaus an Fragen der stammesgeschichtlichen Entwicklung
interessiert. Sie wollen verstehen, welche Selektionsdrucke die Entwicklung
eines Verhaltens oder einer bestimmten Art, wahrzunehmen, in Gang setzten, und
stellen damit die Frage, welche Aufgaben eine Verhaltensleistung im Dienste
der Überlebenstüchtigkeit erfüllt oder, anders ausgedrückt, worin ihre
spezifische Angepaßtheit besteht. Eine Frage übrigens, die sowohl für uns
angeborene als auch für individuell erlernte und kulturell tradierte
Verhaltensleistungen gestellt werden kann. Alles, was wir tun oder
unterlassen, geht ja letztlich in die Bilanz einer Kosten-Nutzen-Rechnung ein,
nach der sich Angepaßtheit bewerten läßt.
Von
grundsätzlichem Interesse ist ferner die Frage nach dem Anteil des
Angeborenen im menschlichen Verhalten. Alle Wahrnehmung und alles
Verhalten ist ja letzten Endes auf die Aktivität von neuronalen Netzwerken im
menschlichen (bzw. tierischen) Gehirn zurückzuführen, die miteinander und
mit den Sinnes- und Ausführungsorganen zu funktionellen Einheiten verbunden
und auf bestimmte Signale so abgestimmt sind, daß angepaßtes Verhalten
möglich wird.
Soweit
herrscht Übereinstimmung. Umstritten war lange Zeit die Frage, ob die
Integration der Nervenzellen zu höheren funktionellen Wirkungsgefügen und
damit die Programmierung zu verläßlich abrufbarem Verhalten ausschließlich
über assoziative Prozesse aufgrund von Erfahrungen während der Embryonal-
und Jugendentwicklung erfolgen oder ob sie auch in einem Wachstumsprozeß
aufgrund der im Erbgut vorgegebenen Entwicklungsanweisungen reifen können.
In
den Verhaltenswissenschaften vom Menschen galt es bis in die sechziger Jahre
als ausgemacht, daß uns Menschen außer einigen Reflexen des Neugeborenen
nichts angeboren sei. Es hieß, wir kämen quasi als unbeschriebenes Blatt zur
Welt und würden erst über Lernprozesse programmiert. Daß diese Ansicht sich
in unserem Jahrhundert entgegen den schon frühen Befunden der Biologen in den
pädagogisch ausgerichteten Humanwissenschaften wie der Soziologie und der
behavioristischen Psychologie so hartnäckig hielt, hat mehrere Gründe.
Zunächst
haben milieutheoretische Lehren, die einzig auf die gestaltende Kraft der
Umwelt setzen, einen starken positiven Anreiz. Menschen möchten frei
entscheiden und wählen können. Und sie möchten ihre
Kinder frei nach ihrem Ermessen erziehen können. Der Gedanke an
Vorgaben, die etwa als stammesgeschichtlich entwickelte
Verhaltensdispositionen die Modifikationsbreiten ihres Handelns einengen
können, stört sie. Außerdem erlebt jeder Mensch
subjektiv, aus sich heraus, etwas frei entscheiden zu können, dies zu tun und
jenes zu unterlassen, auch wenn Ärger oder etwa Verliebtheit uns gelegentlich
zu unvernünftigem Handeln verleiten.
Der
Wunsch, den heranwachsenden Mitmenschen nach eigenem Dafürhalten erzieherisch
gestalten zu können, hat aber auch seine bedenklichen Seiten,
manifestiert sich in ihm doch zugleich ein Machtanspruch, der den
heranzubildenden Menschen in der Vorstellung der Erzieher allzuleicht zu Wachs
in deren Händen degradiert.
53
Wenn
jemand behaupten kann, daß uns Menschen außer einigen elementaren Reflexen
des Neugeborenen nichts angeboren sei, dann kann man sich das auf Überzeugung
begründete Recht herausnehmen, zu bestimmen, was als gut und erstrebenswert
zu gelten habe, und danach die Normen zu setzen. Das verleiht politischen
Führungen ungeheure Macht, und diese korrumpiert nicht selten. So kommt es,
daß die Wirklichkeit oft gegen besseres Wissen schlichtweg ausgeblendet wird,
wenn sie Grenzen der Belastbarkeit aufzeigt, die der Verwirklichung
einer Utopie im Weg zu stehen scheinen.
In
diesem Zusammenhang hört man dann oft auch, daß der Hinweis auf das
Angeborene einem Fatalismus Vorschub leiste, denn gegen Angeborenes sei
bekanntlich nichts zu machen. Ich habe darauf so oft geantwortet, daß ich
mich hier nur ungern wiederhole. Grundsätzlich betrachten wir — ich muß es
noch einmal sagen — den Menschen als Kulturwesen von Natur. Der
Mensch kultiviert alle Lebensbereiche und legt sich damit Zügel an. Das
erlaubt es ihm, sich an die verschiedensten Lebensbedingungen anzupassen. Nun
engen Zügel sicher ein, aber dadurch, daß wir sie uns anlegen, erwerben wir
Selbstkontrolle und damit Freiheiten auf einer höheren Ebene. Zügellosigkeit
führt allzuleicht in die Irre und zu Zeit und Energie verbrauchenden
Reibereien.
Die
erzieherische Kultivierung unseres Verhaltens setzt ein Wissen um das voraus,
was es zu zivilisieren gilt. Außer unseren prosozialen Anlagen, auf die sich
viele unserer Hoffnungen begründen, steckt in unserem stammesgeschichtlichen
Erbe auch höchst Problematisches, das sich, wenn unerkannt, in bestimmten
Situationen als Stolperstrick erweisen kann.
54
Da
um den Begriff »angeboren« auch heute noch unklare Vorstellungen herrschen,
möchte ich dazu an dieser Stelle ein paar Worte sagen. Man hört immer
wieder, das Erbe spiele
zwar sicherlich auch bei der Ausdifferenzierung von Wahrnehmung und Verhalten
eine große Rolle, aber man könne die Anteile von Erbe und Umwelt nie
auseinanderhalten, da ja eine Umwelt in allen Phasen der Entwicklung auf einen
Organismus einwirke. Selbst wenn man ihn isoliert aufziehe, könne er
Erfahrungen sammeln, daher sei auch die Aufzucht unter Erfahrungsentzug, die
Ethologen bei Tieren zum Nachweis des »Angeborenen« führen, nicht
beweisend.
Darauf
ist zu antworten, daß ein Verhalten ebenso wie spezifische
Wahrnehmungsleistungen als Anpassungen eignungsrelevante Facetten der Umwelt
oder soziale Modelle kopieren. Ich kann daher im Versuch nach der Herkunft
spezifischer Angepaßtheit forschen. Ich kann zum Beispiel eine Ästchen
mimende Spannerraupe vom Ei an fern von Zweigen aufziehen. Mimt sie dennoch in
Körperbau und Verhalten Ästchen, indem sie Zweige, auf denen sie gut getarnt
erscheint, aufsucht und bei Gefahr sich wie ein Ästchen vom Zweig abspreizt,
dann ist erwiesen, daß auf dieser Ebene der Passung die entscheidende
Information stammesgeschichtlich über Mutation und Selektion erworben und
genetisch kodifiziert wurde.
Ähnliches
würde für den Fall gelten, daß ein vom Ei an isoliert aufgezogener Vogel
beim Eintreten der Geschlechtsreife wie seine gleichgeschlechtlichen
Artgenossen zu singen und zu balzen beginnt, denn auch in diesem Fall kann das
Tier die Information, das spezifische Gesangsmuster betreffend, nicht während
seiner Entwicklung erworben haben. Sollte sich etwa, was höchst
unwahrscheinlich ist, herausstellen, daß die Koordination der Atembewegungen
— eine Voraussetzung für das Singen — in der Jugendentwicklung gelernt
wird, dann würde das an der Aussage der stammesgeschichtlichen Angepaßtheit
auf der Ebene des Singens nichts ändern.
55
Mittlerweile
hat die biologische Forschung gezeigt, daß ein Nervensystem durchaus in der
Lage ist, sich selbst zu »verdrahten«. Wir wissen durch die Untersuchungen
von Roger
Sperry (1971) und seinen Nachfolgern (siehe dazu Eibl-Eibesfeldt 1987), daß
die auswachsenden Nerven auf ihre Endorgane chemisch abgestimmt sind und diese
gewissermaßen erschnüffeln. Die wegweisende Entdeckung gelang Sperry, als er
einem Froschembryo ein Stück Rückenhaut in die Bauchregion verpflanzte. Dort
blieb es auch nach der Verwandlung durch eine dunklere Pigmentierung gut
erkennbar. Kitzelte er den herangewachsenen Frosch später an diesem Stück in
die Bauchregion verpflanzter Rückenhaut, dann kratzte sich der Frosch am
Rücken. Die normalerweise die Rückenhaut innervierenden Nervenfasern hatten
also das ihnen zugeordnete Stück Rückenhaut in der Bauchregion
»erschnüffelt« und gefunden. Mittlerweile hat man herausgefunden, daß von
den auswachsenden Nervenkegeln fadenartige Moleküle ausgehen, die selektive
Affinitäten zeigen und den Nerv in eine bestimmte Richtung ziehen (Goodman
und Bastiani 1984).
Auch
an der Tatsache der partiellen Vorprogrammiertheit menschlichen Verhaltens
durch stammesgeschichtliche Anpassungen besteht heute kein grundsätzlicher
Zweifel mehr. Schon früh wiesen die Gestaltpsychologen auf elementare
Prozesse der Wahrnehmung hin, die deshalb interessant sind, weil sie erkennen
lassen, daß sie Hypothesen über die uns umgebende Welt beinhalten. Das
führt dazu, daß wir im Experiment eine Wahrnehmung oft fehlinterpretieren.
So vermeinen wir in einer mondhellen Nacht den Mond gegen die Wolken ziehen zu
sehen, weil unser Wahrnehmungsapparat von der Annahme ausgeht, daß es immer
Objekte sind, die sich in einer im übrigen feststehenden Umwelt bewegen. Man
kennt viele visuelle Illusionen dieser Art, und solche »Vorurteile« erweisen
sich gegen besseres Wissen als ziemlich resistent.
Wir
wissen ferner um die Existenz neuronaler Netzwerke, die eng auf ganz bestimmte
Wahrnehmungsleistungen spezialisiert sind, wie zum Beispiel auf das Erkennen
von Gesichtern. Die darauf spezialisierten Neuronenpopulationen
im temporalen Kortex sprechen beim Menschen und beim Rhesusaffen selektiv auf
einfache Gesichtsattrappen an, nicht aber auf die Abbildung einer Hand oder
eine unregelmäßige Anordnung von Gesichtselementen, die vordem als Gesicht
starke Reaktionen auslösten (Abb. 7).
56
Neugeborene
reagieren auf einfache Gesichtsattrappen aus zwei Augenflecken und einem in
der Mitte darunter befindlichen runden Fleck, die von einer Linie als Gesicht
abgegrenzt sind (Abb. 8), mit aufmerksamem, anhaltendem Betrachten. Der
Mundfleck muß sich jedoch unter den Augen befinden. Die gleiche Attrappe um
180° gedreht, daneben geboten, erfährt signifikant weniger Zuwendung.
Zu
diesen offenbar auf ein angeborenes elementares Gesichtserkennen
spezialisierten Neuronenpopulationen kommen beim Menschen noch solche, die
darauf spezialisiert sind, sich durch Lernen persönliche Merkmale eines
Gesichts einzuprägen. Wird diese Region zerstört, dann erkennen die
betroffenen Personen zwar noch Gesichter, sie können diese aber nicht mehr
einer bestimmten Person zuordnen und erkennen dann selbst nächste Angehörige
nicht. Sobald die Person spricht, wird sie erkannt. Das Phänomen ist als
Prosopagnosie bekannt.
In
beiden Fällen liegen Referenzmuster vor, in denen gewissermaßen als
Erwartung ein Wissen vorgegeben ist, gegen das einkommende Meldungen
verglichen werden. Im ersten Fall handelt es sich um ein ganz allgemeines
Gesichtsschema, das uns angeboren ist und das wohl auch älteres Erbe ist, da
wir es ja bereits bei nichtmenschlichen Primaten vorfinden. Die Referenzmuster
für das persönliche Erkennen von Gesichtern werden offensichtlich über
Lernen programmiert. Als stammesgeschichtliche Anpassungen liegen aber eigens
dafür abgestellte Hirnregionen bereit.
57

Abb.
7 Antworten
einzelner Nervenzellen aus dem temporalen Kortex eines Rhesusaffen. Unter
den visuellen Reizmustern sind die neuronalen Antworten angegeben. Jeder
Strich entspricht einem Nervenimpuls. Die Spezifität der Antworten auf
Gesichtsreize ist bemerkenswert. Affengesichter und Menschengesichter mit
Augen lösen die stärksten Antworten aus. Fehlen die Augen, dann sinken die
Antworten dramatisch ab. Ein durcheinandergemischtes Affengesicht erhält
kaum Antworten, ebensowenig eine Hand oder ein Arrangement unregelmäßiger
Striche, wohl dagegen ein stark schematisiertes Gesicht. - Nach G. G. Gross
et al. (1981).
58
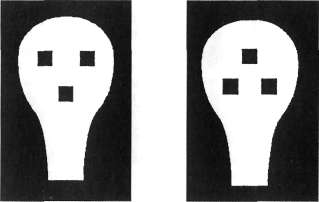
Abb.
8 Die den
Neugeborenen gebotenen Gesichtsattrappen. Die um 180° gedrehte
Gesichtsattrappe, bei der der Mundfleck über den Augen lag, fand bei den
Neugeborenen, gemessen an der Fixierzeit, viel weniger Beachtung. - Aus E.
Valenza et al. (1996).
Wir
haben also uns angeborene von erworbenen Referenzmustern zu unterscheiden.
Erstere nannte Konrad Lorenz (1935) angeborene Schemata. Man spricht auch von Leitbildern
und Sollmustern. Im Englischen hat sich der Begriff template eingebürgert,
der dem Lorenzschen Schema entspricht. Referenzmuster dieser Art sind oft so
beschaffen, daß sie beim Eintreffen der Reize oder Reizkonfigurationen, auf
die sie abgestimmt sind, ganz bestimmte Verhaltensweisen als Antworten
freigeben. In diesen Fällen spricht man von angeborenen auslösenden
Mechanismen.
Solche
angeborenen Auslösemechanismen gibt es nicht nur für die visuelle
Wahrnehmung, sondern auch für die geruchliche und akustische. Spielt man
Säuglingen Tonbänder mit Lautäußerungen gleicher Lautstärke, aber
verschiedener Qualität vor, unter anderem auch Weinen, löst nur das Weinen
Mitweinen aus.
59
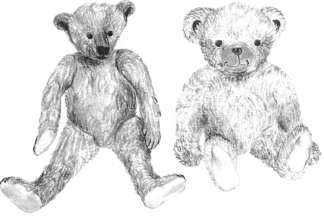
Abb.
9 Teddybären: links aus den Anfangsjahren der Produktion (Firma Steiff
1905/06) und rechts in seiner weiteren Entwicklung zum Kuscheltier. Die
Gliedmaßen wurden verkürzt, Kopf und Rumpf runder, und auch das Gesicht
glich sich mehr dem Babyschema an. - Aus Chr. Sütterlin (1993).
Allgemein
bekannt dürfte mittlerweile das von Konrad Lorenz entdeckte Babyschema
(Kindchenschema) sein. Säuglinge zeichnen sich durch eine Reihe von Merkmalen
aus,
die wir »herzig« finden. So haben Säuglinge einen relativ großen Kopf im
Verhältnis zu einem kleinen Rumpf und kurzen Extremitäten. Fettpolsterung
bewirkt rundliche Formen. Das Gesicht ist durch eine vorgewölbte Stirn, einen
relativ zierlichen, kleinen Gesichtsschädel und durch Pausbacken
charakterisiert. Die Attrappenversuche der Puppen- und Werbeindustrie lehren,
daß man jedes dieser Merkmale einzeln bieten und dabei stark übertreiben
kann, um für die verschiedensten Zwecke niedlich und damit freundlich
stimmende Objekte zu schaffen. Die Entwicklung der Teddybären zeigt, daß der
Kopf im Laufe der Zeit immer größer, Rumpf und Extremitäten dagegen immer
kleiner wurden. Die Teddys wurden so immer niedlicher (Abb. 9). Der
Kulturenvergleich lehrt, daß es sich beim Kindchenschema um eine Universalie
handeln dürfte.
60
Auch
unsere ästhetische Bewertung der nichtmenschlichen Umwelt ist durch uns
angeborene Leitbilder mitbestimmt. So fällt auf, daß Parkanlagen in aller
Welt sich durch vereinzelte kleinere Baumgruppen und freie Wiesenflächen mit
Kleingewässern auszeichnen und damit an die Savanne erinnern, in der sich die
Menschwerdung vollzogen hat. Außerdem zeichnet uns eine ausgesprochene
Vorliebe für Pflanzen, eine Phytophilie, aus, die sich bei
naturfern lebenden Stadtbewohnern unter anderem darin ausdrückt, daß sie
Ersatznatur in Form von Topfpflanzen in ihr Heim tragen. Es handelt sich wohl
um archetypische Prägungen auf Merkmale eines Lebensraumes, der uns gute
Existenzbedingungen verspricht. Wo Pflanzen gedeihen, haben auch wir Menschen
Aussicht, genügend Nahrung zum Überleben zu finden. Mehrere Untersuchungen
zeigten, daß es zu unserem Wohlbefinden beiträgt, wenn unser ästhetisches
Bedürfnis nach Grün erfüllt ist. So fördert der »Ausblick auf Natur« den
Heilerfolg von Patienten.
In
einem von Roger Ulrich (1984) zitierten Beispiel waren sechs nebeneinander
liegende Zimmer mit Patienten belegt, die sich einer Gallenoperation
unterzogen hatten. Der Heilerfolg in drei Zimmern, die Ausblick auf belaubte
Bäume hatten, war deutlich besser als in den anderen, deren Ausblick durch
ein Gebäude verstellt war: Die Aufenthaltsdauer in den Zimmern mit
»Naturblick« war kürzer. Es gab außerdem weniger Komplikationen, und es
wurden weniger Medikamente verbraucht. Das ist ein klarer Nachweis für die
gesundheitsfördernde Auswirkung ästhetischer Umwelteindrücke.
Untersuchungen
mit Hilfe von computergenerierten Bildern zeigten, daß Kinder vor der
Pubertät Savannenhabitate vor anderen bevorzugen. Nach der Pubertät jedoch
ziehen sie Landschaftsbilder vor, die ihrer Heimat entsprechen (Synek 1997).
Wir kommen hierauf noch zu sprechen, wollen aber bereits an dieser Stelle
darauf hinweisen, daß auch das Lernen durch uns angeborene Lerndispositionen
so ausgerichtet
ist, daß wir im allgemeinen das lernen, was unserem Überleben nützt.
61
Das
gilt zunächst einmal für unsere Begabung, eine Sprache zu lernen, wofür wir
über eigene, darauf spezialisierte Hirnstrukturen verfügen. Wichtig für
unsere Betrachtungen ist ferner eine von Konrad Lorenz entdeckte und als Prägung
beschriebene Form des Lernens. Lorenz beobachtete, daß frischgeschlüpfte
Gänseküken offenbar über keine angeborene Kenntnis ihrer Eltern verfügen.
Sie laufen auf jedes Objekt zu, das rhythmische Locklaute äußert, und folgen
ihm, wenn es sich fortbewegt, gleich, ob es sich um eine Kiste, einen Ball
oder einen Menschen handelt. Sind sie einem solchen
Objekt oder einem Menschen einmal gefolgt, dann bleiben sie dabei.
Weitere
Untersuchungen zeigten, daß solche Prägungen sich durch eine sensible
Periode auszeichnen und daß sie, wenn einmal erfolgt, irreversibel sind.
Elisabeth Wallhäuser und Henning Scheich (1987) fanden dafür eine
Erklärung. Sie prägten die Folgereaktion von Hühnerküken auf reine Töne
und stellten als Folge an den die akustischen Signale verarbeitenden Neuronen
bemerkenswerte Veränderungen fest: Vor der Prägung hatten die zuführenden
Äste dieser Nervenzellen viele vorbereitete Kontaktstellen mit anderen
Nervenzellen. Nach der Prägung erwiesen sich die
meisten dieser Kontaktstellen als eingeschmolzen und die Nervenzellen damit
auf eine ganz bestimmte Reizqualität abgestimmt.
Stammesgeschichtliche
Anpassungen bestimmen aber nicht nur unsere Fähigkeit, wahrzunehmen, zu
erkennen und zu lernen, sondern auch — über besondere motivierende Systeme
— unsere Gestimmtheiten, Gefühlsregungen und Sinnesempfindungen. Ihnen sind
ferner oft ganz bestimmte uns angeborene Bewegungsfolgen zugeordnet, die
vielfach Signalcharakter haben. Bereits Neugeborene reagieren zum Beispiel auf
sauer, bitter und süß mit ganz typischen mimischen Ausdrucksbewegungen, die
erkennen lassen, wie ihnen etwas schmeckt. Selbst großhirnlos geborene Kinder
zeigen diese Ausdrücke (Steiner 1979).
62/63
Ärger,
Freude und Kummer drücken sich ferner in der Mimik der verschiedensten
Völker auf die gleiche Weise aus, und das Studium von taub und blind
geborenen Kindern lehrt, daß diese lachen, weinen und lächeln wie sehende
und hörende Kinder, obgleich sie in ewiger Nacht und Stille heranwuchsen und
daher keine Möglichkeiten hatten, von sozialen Vorbildern zu lernen.
Kulturenvergleichende Untersuchungen haben in den letzten drei Jahrzehnten
eine Fülle von Universalien im menschlichen Verhalten nachgewiesen. So
stimmen viele Gesichtsausdrücke bis in Einzelheiten des Bewegungsablaufes
über die Kulturen hinweg überein. Der »Augengruß«, ein schnelles Heben
der Augen für etwa 1/6 Sekunde und meist von einem Lächeln begleitet, ist
ein Beispiel dafür.
Es
gibt ferner Prinzipähnlichkeiten im Verhalten. Einander begrüßende
Personen kombinieren oft Verhaltensweisen imponierender Selbstdarstellung mit
befriedenden Appellen. Wie das allerdings geschieht, wechselt. Es kann sich um
feste Rituale handeln, so wenn ein Staatsgast durch das salutierende Militär
und ein Blumen überreichendes Mädchen begrüßt wird. Aber auch alltägliche
Grußformeln und ein fester Händedruck können das ausdrücken.
Wie
man imponiert und besänftigt, wechselt jeweils, aber die Antithese von
Selbstdarstellung und Besänftigung ist in bestimmten Grußsituationen über
die Kulturen hinweg zu beobachten. Es gibt vergleichbare elementare
Interaktionsstrategien der Aggressionsabblockung, des Bittens, Werbens und
anderes mehr, die ebenfalls bei oberflächlicher Betrachtung recht verschieden
aussehen können, die aber bei genauerer Betrachtung erkennen lassen, daß es
sich um nach gleichen universalen Regeln strukturierte Abläufe handelt. Das
weist auf ein universales Regelsystem hin, eine Grammatik sozialen Verhaltens,
die zu den menschlichen Universalien zählt. Darüber schreibe ich
ausführlich in meiner Biologie des menschlichen Verhaltens.
63
#
^^^^
www.detopia.de