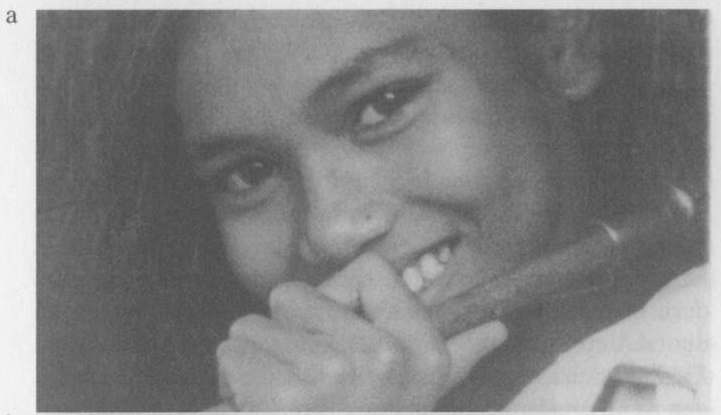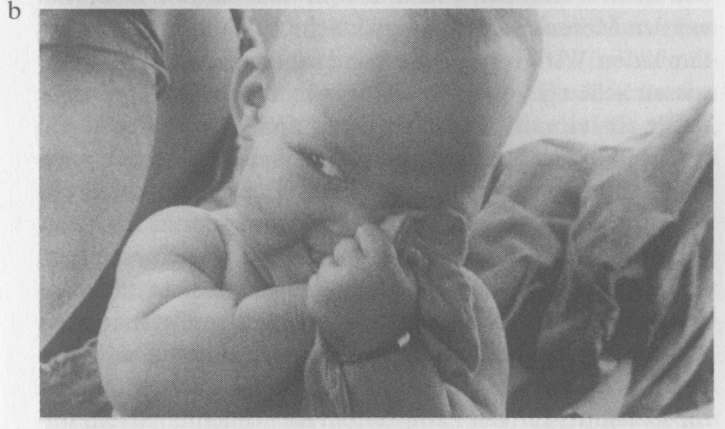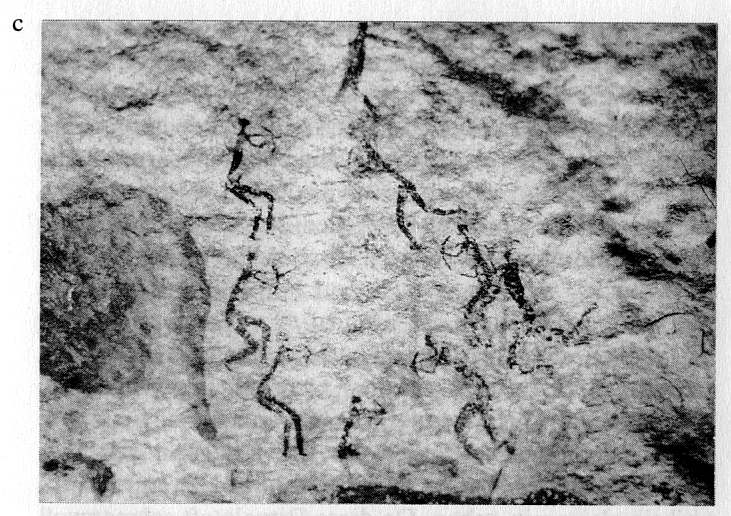Start
Weiter
4
Dominanz und Fürsorglichkeit — die
Eckpfeiler menschlicher Sozialität
Eibl-1998
4.1 Eine Sternstunde der Verhaltensevolution
64-90
In
allen Gebieten der Erde beobachten wir gegenwärtig ein Wiederaufleben von
Stammesdenken und ethnischen Konflikten. Wir sind mit weltweiten Äußerungen
des Ethnozentrismus und der Xenophobie (Fremdenfurcht) konfrontiert und stehen
dem Problem der zunehmenden Gewalttätigkeit gegen Ausländer ziemlich ratlos
gegenüber. Wie so oft in solchen Fällen macht man es sich dann zu bequem,
indem man das Phänomen in seiner Bedeutung herunterspielt, es als schlechte
Gewohnheit für eine Therapie empfiehlt oder schlichtweg seine Existenz
verleugnet.
»Nations
are an invention«, las ich kürzlich. Da ist was dran, denn Jäger- und
Sammlervölker bilden im allgemeinen keine Nationen. Menschen grenzen sich
allerdings auch auf einer vorstaatlichen Entwicklungsstufe von anderen als
Lokalgruppen, Dorfgemeinschaften, Tälergemeinschaften und dergleichen mehr
ab. Und ethnische Nationen entwickeln sich ziemlich häufig, und das Phänomen
der Ethnizität beschränkt sich nicht nur auf die avancierte
technisch-zivilisierte Welt. Es ist daher zu hinterfragen. Warum definieren
sich zum Beispiel Armenier als Armenier, Kurden als Kurden und Serben als
Serben? Und warum sind viele sogar bereit, ihr Leben im Kampf für die
Erhaltung ihrer Identität zu opfern?
Die
sind eben irregeführt, könnte man argumentieren
—
aber das lädt dann doch nur zu der Frage ein: Warum werden Menschen in der
ganzen Welt so leicht irregeführt?
Wir
gegen die anderen
—
dieser Gegensatz beinhaltet eines der größten Probleme der Menschen. Wie kam
diese Unterscheidung in die Welt? Sie ist interessanterweise das Ergebnis
einer höchst positiv zu bewertenden Entwicklung, die die Weichen der
Evolution in eine ganz neue Richtung stellte, so daß ich von einer Sternstunde
der Verhaltensevolution spreche. Es handelt sich um die Evolution der
fürsorglichen, mütterlichen Brutpflege bei den Vögeln und Säugetieren. Mit
ihr kam nämlich die Liebe, definiert als persönliche Bindung, in die Welt.
Diese starke, affektiv getönte Beziehung diente zunächst zur Absicherung der
Mutter-Kind-Bindung, was wiederum garantiert, daß Mütter nur ihre eigenen
Jungen umsorgen. Mit der Mutter-Kind-Bindung kam die persönliche Bindung und
damit das »Wir und die anderen« in die Welt - und auch, wie wir im folgenden
ausführen werden, das gerade aufgezeigte Problem.
Vor
der Entwicklung der individualisierten Brutfürsorge gab es unter den
Wirbeltieren keine persönlichen Beziehungen und daher auch keine Liebe. Das
Schlüsselerlebnis zu dieser Erkenntnis hatte ich, als ich im Januar 1954 bei
Punta Espinosa an der westlichen Galápagos-Insel Fernandina landete. Die
meerumbrandeten Felsen waren hier buchstäblich mit Hunderten dunkler
Meerechsen bedeckt. Sie lagen dicht gepackt nebeneinander, als wären sie
gesellig (Abb. 10). Aber bald kam ich darauf, daß ihre Art der Geselligkeit
von jener, die ich bis dahin von Vögeln und Säugetieren kannte, stark
abwich. Während diese im sozialen Verbund einander beistehen, als Pärchen
einander oft füttern und sich gegenseitig die Federn oder das Fell putzen,
kurz, Freundlichkeiten erweisen, fehlten den Meerechsen jegliche Bekundungen
von Verbundenheit. Wenn die Echsen aufeinander Bezug nahmen, dann taten sie
das mit Verhaltensweisen des Drohimponierens, auf die die angedrohten Partner
entweder mit Gegenimponieren, Ausweichreaktionen oder Verhaltensweisen der
Submission reagierten.
65

Abb.
10 Meerechsenansammlung an der Küste von Fernandina
(Narborough, Galápagos-Inseln). - Foto: I. Eibl-Eibesfeldt.
Es
war gerade der Beginn der Paarungszeit, und einzelne Meerechsen-Männchen
begannen auf den Uferfelsen kleinere Reviere für sich abzugrenzen, aus denen
sie andere Männchen vertrieben. Die Anwesenheit von Weibchen duldeten sie.
Drang ein Rivale in ein bereits besetztes Gebiet ein, dann bedrohte der
Revierinhaber den Eindringling, indem er ihm seine maximal vergrößerte
Breitseite zeigte und kopfnickend mit aufgerissenem Maul, als würde er
beißen wollen, vor diesem paradierte. Wich der Eindringling nicht zurück,
dann kam es zum Kampf. Nach weiterem Drohimponieren mit Kopfnicken und
Maulaufreißen stürzten die Rivalen aufeinander los. Aber anstatt sich
ineinander zu verbeißen, senkten sie kurz vor dem Zusammenstoß ihre Köpfe,
so daß sie, Schädeldach gegen Schädeldach, aufeinanderprallten. Es
entwickelte sich eine Art Schiebeduell, in dessen Verlauf jeder den anderen,
Schädel gegen Schädel, drückend vom Platz zu schieben trachtete.
66
Merkte
einer schließlich, daß er dem anderen nicht gewachsen war, dann setzte er
sich mit einem Ruck von ihm ab und legte sich in Demutsstellung ganz flach vor
seinem Gegner auf den Bauch. Der stellte dann in der Regel das Kämpfen ein
und wartete in Drohstellung darauf, daß der Besiegte das Feld räumte.
Im
weiteren Verlauf beobachtete ich auch das Paarungsverhalten. Die Männchen
warben mit Drohimponieren. Paarungsbereite Weibchen unterwarfen sich in
Demutsstellung. Das gesamte soziale Verhaltensrepertoire der Meerechsen
basierte auf den Verhaltensweisen der Dominanz und Unterwerfung. Und
das gilt, wie ich in den folgenden Jahren feststellen konnte, für alle heute
lebenden Reptilien und dürfte demnach einen für die Landwirbeltiere
ursprünglichen Zustand repräsentieren.
Damals
kam mir der Gedanke, der Ausgangspunkt der Fähigkeit, freundliche Beziehungen
herzustellen, könnte die individualisierte Brutfürsorge gewesen sein. Diese
Vermutung konnte ich seither durch vergleichende Beobachtungen bekräftigen.
Im Dienste der Brutpflege entwickelten sich bei den Elterntieren die
Motivation, Junge zu betreuen, das Repertoire betreuender Verhaltensweisen wie
das Füttern, Wärmen, Verteidigen und Säubern der Jungen und kindlicherseits
die Motivation, sich betreuen zu lassen, sowie ein Repertoire von Signalen,
über die Verhaltensweisen der Betreuung ausgelöst werden können. Ferner
entwickelten beide Seiten die Fähigkeit, persönliche Bindungen auszubilden.
Die
im Dienste der Mutter-Kind-Beziehung entwickelten Anpassungen konnten
sekundär in den Dienst der Erwachsenenbindung gestellt werden. Untersucht man
bei Vögeln und Säugetieren die Verhaltensweisen des Werbens, Beschwichtigens
und der Bindungsbekräftigung, dann stellt man schnell fest, daß es sich in
der Mehrzahl um aus dem Brutpflegerepertoire und dem kindlichen Repertoire
abgeleitete Symbolhandlungen handelt.
67

Abb.
11 Das symbolische
Anbieten von Nestmaterial, hier ein winziges Steinchen, im Paarungsvorspiel
des Maskentölpels der Galápagos-Inseln. - Foto: I.
Eibl-Eibesfeldt.
Viele
Vögel überreichen einander beim Werben und auch, wenn sie verpaart sind, zur
Begrüßung Nestmaterial. Das drückt
ursprünglich Nestbaustimmung aus und damit die Bereitschaft, sich mit einem
Partner zu verpaaren. Die funktionelle Handlung wurde dabei zu einer reinen
Symbolhandlung. Bei Maskentölpeln der Galápagos-Inseln ging das
Nestbauverhalten sekundär verloren, sieht man von einigen Steinchen ab, die
sie auf dem Nestplatz ablegen und die vielleicht das Abrollen der Eier vom
relativ glatten Fels verhindern. Bei der Balz überreichen sie einander
dennoch winzige Steinchen (Abb. 11). Als Symbolhandlung des Nestbauens spielt
das Steinchenüberreichen weiterhin eine wichtige, die Kontaktbereitschaft
fördernde Rolle. Beim flugunfähigen Kormoran der Galápagos-Inseln
überreichen die verpaarten Altvögel einander Nestmaterial zur
Brutablösung.
68
Wenn
einer vom Fischen zurückkommt, bringt er seinem brütenden oder die Jungen
beschattenden Partner einen Seestern, ein Ästchen oder ein Algenbüschel.
Versäumt er es, mit einer Gabe anzukommen, dann wird er mit Schnabelhieben
empfangen und vertrieben. Dies kann man leicht auslösen, indem man dem
Herankommenden seine Gabe wegnimmt3. Da das normalerweise nicht passiert, sind
sie an ein solches Ereignis nicht angepaßt, sie schreiten daher weiter zum
Partner. Erst wenn der droht und angreift, bemerkt der Ankommende, daß etwas
nicht stimmt, und sucht sich schnell ein Hölzchen, das er nun ordnungsgemäß
grüßend seinem Partner überreicht. Wenn Sperlinge umeinander werben, dann
verfallen sie abwechselnd in die Rolle des futterbettelnden Jungvogels: Einer
bettelt wie ein Junges mit den Flügeln zitternd um Futter, worauf ihn sein
Partner füttert. Dann wechseln sie meist die Rollen. Das zärtliche
Schnäbeln vieler verpaarter Vögel ist ein ritualisiertes Füttern. Manche
Vogelmännchen bauen in ihren Werbegesang kindliche Bettellaute ein.
Wie
diese Appelle in der ersten Phase der Paarbildung wirken, beschrieb Niko
Tinbergen sehr eindrucksvoll von den Lachmöwen. Bei dieser Art tragen beide
Geschlechter eine schwarze Gesichtsmaske als Drohsignal. Das erschwert das
Zueinanderfinden der Geschlechter. Hat ein Männchen durch Rufe ein Weibchen
in sein Revier gelockt, dann löst dessen Erscheinen über das schwarze
Gesicht häufig aggressive Abwehr aus. Ein Weibchen kann diese Aggressionen
allerdings abblocken, indem es sich in geduckter Haltung mit kindlichem
Futterbetteln dem Männchen nähert. Dann kann das Männchen gar nicht anders:
Es muß Futter hochwürgen und füttern.
Ein
weiteres beschwichtigendes Verhalten ist das Hinterkopfzudrehen, ein betontes
Wegwenden der schwarzen Gesichtsmaske, das beide in der ersten Phase der
Paarbildung demonstrativ immer wieder als Beschwichtigungsgebärde ausüben.
Auf diese Weise werden die Tiere miteinander bekannt, und sobald sie einander
persönlich kennen, bedarf es interessanterweise dieser beschwichtigenden
Verhaltensweisen nicht mehr. Persönliche Bekanntheit
blockiert oder mindert die Wirkung aggressionsauslösender Signale des
Partners.
69
Soziale
Gefieder- und Fellpflege stiftet und bekräftigt Verbundenheit bei vielen
Vögeln und Säugern. Mir gelang es, mich über soziale Fellpflege mit einem
scheuen Riesengalago anzufreunden. Das in meinem Zimmer frei lebende
Halbäffchen wich mir immer aus, wenn ich mich ihm näherte. Aber einmal saß
es günstig, und ich vermochte ihn mit meinem Zeigefinger zart an einer
Schulter zu kraulen. Das Äffchen zuckte kurz, gab sich aber dann mit
sichtlichem Wohlbehagen dieser Behandlung hin. Zu meiner
Überraschung hob es dann einen Arm und ließ mich auch seine Achselhöhle
kraulen. Von da ab war es zahm! Kam ich in seine Nähe, dann hob es oft
zum Kraulen auffordernd einen Arm.
Bei
in Gruppen lebenden Tieren werden Aggressionen oft durch infantile Appelle
abgeblockt. Rangniedere Wölfe, die von ranghohen angegriffen werden, werfen
sich häufig auf den Rücken wie Welpen, die sich ihrer Mutter zur Säuberung
darbieten. Sie harnen dabei häufig, was Trockenlecken auslöst. Wir können
diese Verhaltensweisen auch bei Haushunden beobachten. Was als aggressive
Auseinandersetzung begann, kann auf diese Weise in eine fürsorgliche
Beziehung umgestimmt werden.
Auch
bei uns Menschen ist der Ursprung der freundlichen Verhaltensmuster aus den
fürsorglichen Eltern-Kind-Verhaltensweisen klar erkennbar: in der Umarmung
und anderen Formen betreuender Berührung ebenso wie im Kuß, der sich vom
Kußfüttern ableitet, einer Verhaltensweise, mit der Mütter auch heute noch
in verschiedenen Kulturen in der Phase des Abstillens ihre Kleinen mit
vorgekauter Nahrung zusätzlich Mund-zu-Mund füttern (auch in unserer Kultur
war das früher üblich). Älteren Kindern wird die Nahrung übergeben. Dieses
in der mütterlichen Fürsorge verwurzelte Füttern steht an der Basis der
vielgestaltigen Rituale des Bewirtens, die Bindungen zwischen Erwachsenen
bekräftigen.
70
Viele
unserer Lebensbereiche sind durch Fürsorglichkeit gekennzeichnet,
aber, wie wir wissen, keineswegs alle. Das stammesgeschichtlich alte
Reptilhirn bildet noch einen faustgroßen Anteil unseres Hirns. Das
Dominanzstreben wurde bei uns Menschen zwar in manchen Bereichen durch
Fürsorglichkeit überlagert, doch keineswegs in allen. Selbst in der
Beziehung zwischen den Geschlechtern, die sicher in erster Linie durch
Fürsorglichkeit, gegenseitigen Beistand und Liebe charakterisiert ist,
spielen noch Dominanz und Unterwerfung eine Rolle. Das spiegelt sich sowohl im
Verhalten als auch in der Physiologie wider. So hat man festgestellt, daß
Tennisspieler, die ein Match gewinnen, einen deutlichen vorübergehenden
Anstieg des Bluttestosteronspiegels erleben. Verlieren sie, dann sinkt der
Spiegel des männlichen Hormons im Blut deutlich ab. Entsprechendes beobachtet
man bei Schachspielern, und wenn Medizinstudenten ihre Prüfung erfolgreich
bestehen, erleben sie ebenfalls einen Anstieg des männlichen Hormonspiegels
im Blut. Fallen sie durch, dann sinkt der Hormonspiegel vorübergehend ab
(Mazur und Lamb 1980).
Über
diesen hormonalen Reflex wird gewissermaßen Erfolg in einer Situation des
Wettstreits, also Dominanz, belohnt. Der Anstieg des Bluttestosteronspiegels
wirkt sich ja subjektiv in einem positiven Lebensgefühl aus. Auch im
Geschlechtlichen gibt es so etwas wie eine Dominanzlust. Sie wird
normalerweise durch Liebe und Fürsorglichkeit überlagert. In der
Sexualpathologie tritt sie bei Wegfall der affiliativen Komponente und oft
auch der persönlichen Bindung in Erscheinung, im Extremfall als Sadismus. Es
scheint ferner ein weibliches Gegenstück hierzu als Unterwerfungslust zu
geben, die sich allerdings nicht nur im weiblichen Geschlecht äußert. Aus
der Sexualpathologie weiß man, daß es Männer gibt, die sich gern quälen
und unterwerfen lassen. Kleptomanie gilt im wesentlichen als weibliche
Deviation. Robert Stoller (1979) befragte
Kleptomaninnen. Er fand heraus, daß viele von ihnen die Aufregung der Angst
suchten, weil diese sie sexuell erregte, häufig bis zum Orgasmus.
71
Nach
Sheila Kitzinger (1984) spielen in den sexuellen Phantasien der Frauen Akte
der Submission eine große Rolle, was allerdings nicht zur Annahme verleiten
sollte, daß Frauen mit solchen Phantasien das Phantasierte auch unbedingt
wünschen. Liebe und Zärtlichkeit gehören zum normalen Sexualverhalten des
Menschen. Ihr Wegfall bedeutet einen Rückfall in archaische Muster. Dominanz
und Unterwerfung sind demnach im menschlichen Sexualverhalten nachzuweisen,
bleiben aber normalerweise der fürsorglichen Liebe untergeordnet.
In
anderen Funktionszusammenhängen spielen Dominanzstreben,
Unterwerfungsbereitschaft, Kampf und Flucht allerdings eine große Rolle, vor
allem in der Konkurrenz um begrenzte Güter wie Land, wobei das
Dominanzstreben auch instrumental (S. 123) zur Bewältigung verschiedenster
Aufgaben eingesetzt wird. Wie viele andere Wirbeltiere leben auch wir Menschen
in Gruppen, die sich von anderen abgrenzen und die ein Gebiet als ihr
Territorium besetzen, oft symbolisch abgrenzen und bei Bedrohung verteidigen.
Menschen unterscheiden bei diesem Wettstreit sehr deutlich zwischen
Gruppenmitgliedern und Gruppenfremden, und dafür sind bereits im Kind
angelegte Verhaltensdispositionen verantwortlich.
2.
»Wir und die anderen«
Die
erste Manifestation des »Wir und die anderen« können wir schon sehr früh
in der Kindesentwicklung feststellen. Im Alter von sechs bis acht Monaten
beginnt ein gesundes Kind zwischen ihm bekannten und ihm fremden Personen zu
unterscheiden. Während die ihm vertrauten Personen Verhaltensweisen
freundlicher Zuwendung auslösen, zeigen die Kinder bei der Begegnung mit
Fremden eine Mischung von Verhaltensweisen der Zuwendung mit solchen deutlich
angstmotivierter Meidung.
72
Im
typischen Fall lächelt das Kind den Fremden an und birgt sich dann nach einer
Weile scheu an der Brust der Mutter, um danach wieder freundlichen
Blickkontakt mit der ihm unbekannten Person aufzunehmen. Es verhält sich
ambivalent, offenbar werden hier zwei Verhaltenssysteme gleichzeitig
aktiviert: eines der freundlichen Kontaktbereitschaft — man könnte von
einem affiliativen oder prosozialen Verhaltenssystem sprechen — und eines
der Meidung, das dem abweisend-feindlichen (agonistischen) System zuzuordnen
ist. Denn wenn sich der Fremde nähert, kann das starke Angstreaktionen
auslösen, auch wenn das Kind auf dem Schoß der Mutter sitzt. Und versucht er
(oder sie) gar, das Kind an sich zu nehmen, dann wehrt es sich.
Schlechte
Erfahrungen mit Fremden sind keineswegs die Voraussetzung für die Entwicklung
einer solchen kindlichen Fremdenscheu, und da wir sie überdies in allen
daraufhin untersuchten Kulturen antreffen, dürfte es sich um eine uns
angeborene universale Reaktionweise handeln. Sie kann kulturell gefördert
oder gemildert werden. Ich habe von den Tasaday (Philippinen), den Yanomami
(Südamerika), den Buschleuten (Südafrika) und von Menschen in vielen anderen
Kulturen sinngemäß des öfteren gehört, wie eine Mutter in meiner Gegenwart
ein unfolgsames Kind ermahnte, wenn es dies oder jenes nicht täte, würde der
Fremde hier (»der mit den stechenden Augen«, wie eine Tasaday einmal sagte)
es mitnehmen.
Nach
Mario Erdheim (1997) löst »bedrohliche Abwesenheit« der Mutter
»Fremdenfurcht« aus. »In seiner primitivsten Form ist das Fremde die
Nicht-Mutter. Und die bedrohliche Abwesenheit der Mutter läßt Angst
aufkommen. Angst wird auch später mehr oder weniger mit dem Fremden
assoziiert bleiben, und es bedarf immer einer Überwindung, um sich dem
Fremden zuzuwenden« (S. 103). An dieser Aussage ist richtig, daß die
kindliche Fremdenscheu funktionell die Mutter-Kind-Bindung absichern
hilft.
73
Ein
Kind zeigt bei Annäherung des Fremden jedoch auch dann Scheu, wenn es auf dem
Schoß der Mutter sitzt. Diese als »Trennungsfurcht« zu beschreiben, wie es
oft geschieht, ist insofern problematisch, als das dem Säugling unterstellt,
er würde die Situation so interpretieren. Aber darüber, was der Säugling
erlebt und denkt, können wir keine Aussage machen. Außerdem löst ein
Fremder nicht nur Meidereaktionen aus, sondern auch deutliche Anzeichen
sozialer Kontaktbereitschaft wie Lächeln und Blickkontakt. Alle solche
Reaktionen scheinen ganz unreflektiert spontan aufzutreten als Ausdruck einer
klaren Ambivalenz (Abb. 12a-b).
Offenbar
ist der Mensch Träger von Merkmalen, die sowohl Zuwendung wie Abkehr
auslösen. Das Verständnis der letzteren reift offenbar bereits während des
Säuglingsalters heran. Die Fremdenscheu sichert die Bindung des Kindes an die
Mutter ab, was ja überlebenswichtig ist. Ein Kleinkind, das sich leicht
Fremden anschlösse, brächte sich wohl in große Gefahr. Die kindliche
Xenophobie ist auch bei vielen nichtmenschlichen Primaten ausgeprägt. Beim
Menschen wird sie über persönliches Bekanntwerden abgebaut. Sie
neutralisiert bis zu einem gewissen Grad die Wirkung angstauslösender
Signale.
Bei
normalsichtigen Kindern ist es vor allem der Blickkontakt, der Angst auslöst.
Untersuchungen von W. Waters, L. Matas und W. A. Sroufe (1975) haben gezeigt,
daß die Herzschlagfrequenz bei Blickkontakt zunimmt. Die Kinder können aber
durch Wegschauen ihren Erregungsspiegel manipulieren. Blickkontakt
signalisiert Kontaktbereitschaft. Er wird als Zuwendung interpretiert, als
Mitteilung, daß die Kanäle für die Kommunikation offen sind. Allerdings
dürfen wir den Partner nie zu lange anschauen, denn sonst empfindet er dies
als Anstarren, und das wirkt als Ausdruck der Dominanz bedrohlich. Es sei in
diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß Augendarstellungen an Schiffen,
Gebäuden und anderen Artefakten angebracht werden, um diese vor bösen
Geistern und anderem Übel zu schützen.
74
Abb.
12 a) Die
Ambivalenz von Zuwendung und Abkehr im Flirt einer jungen Inderin. Sie hält
einen Sonnenschirm in der Hand, hinter dem sie sich wie schutzsuchend
verbirgt. b) Die Überlagerung von Verhaltensweisen der
Zuwendung (Blickkontakt, Lächeln) mit Verhaltensweisen der Abkehr
(Körperorientierung) bei einem weiblichen Säugling der G/wi-Buschleute
(Zentrale Kalahari) bei Kontakt mit einem Fremden, der sich links seitlich
von ihm befindet. Typisch ist auch das Verbergen des Lächelns durch die
vorgehaltenen Hände. - Fotos: I. Eibl-Eibesfeldt (aus einem
16-mm-Film).
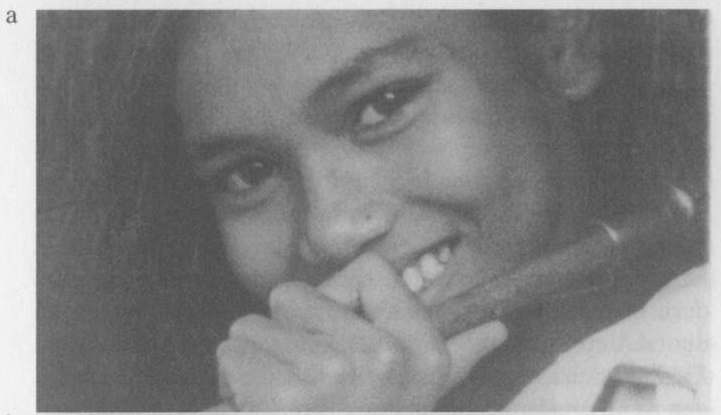
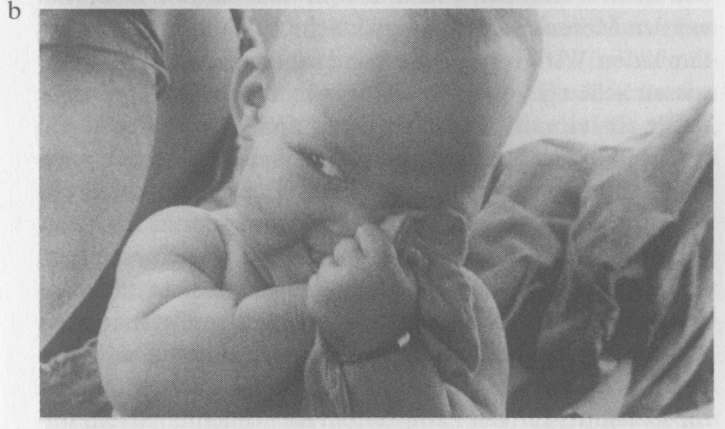
75
Wenn
zwei Menschen sich unterhalten, dann bricht der Sprechende immer wieder den
Blickkontakt ab. Nur der Zuhörende darf sein Gegenüber dauernd anschauen, er
muß ja an nichtverbalen Zeichen erkennen, wann ihm die Rede übergeben wird.
Auch taub und blind geborene Kinder zeigen Fremdenscheu, sie reagieren dabei
auf geruchliche Merkmale.
Die
Fremdenscheu ist gewissermaßen Ausdruck eines Urmißtrauens, das über
Bekanntwerden abgebaut wird. So lernt das Kind zunächst, zu den übrigen
Familienmitgliedern eine Vertrauensbeziehung herzustellen und dann zu den
weiteren Freunden und Bekannten der Familie. Die Engländer haben für diesen
Prozeß des Bekanntwerdens den sehr treffenden Ausdruck familiarisation. Über
ihn werden Menschen durch persönliche Bekanntheit zu quasi familialen
Wir-Gruppen verbunden, die sich mit einer gewissen Scheu gegen andere Gruppen
abgrenzen.
Die
altsteinzeitlichen Jäger- und Sammlervölker lebten in solchen kleinen
Lokalgruppen, die selten über 50 Personen zählten. Untersuchungen über das
Zusammenleben von Völkern, die noch heute oder bis vor kurzem in
Kleinverbänden lebten, zeigen, daß in derartigen Gemeinschaften Äußerungen
repressiver Dominanz unterdrückt und fürsorgliche Verhaltensmuster
gefördert werden. Personen von Ansehen, die es auch in solchen Gesellschaften
gibt, beziehen ihre hervorgehobene Stellung im wesentlichen dank ihrer
sozialintegrativen Fähigkeiten. Sie schlichten Streit, stehen Schwächeren
bei, teilen und tragen so und auf andere Weise zum sozialen Frieden bei. Sie
zeigen überdies meist noch besondere Begabungen als Sprecher für die Gruppe,
als Kriegsführer oder Heiler. Aber es ist vor allem das prosoziale Geschick,
das ihre Stellung bestimmt. An solche Personen wenden sich die übrigen
Gruppenmitglieder, wenn sie Rat oder Schutz suchen. Sie orientieren sich nach
ihnen, was das Wort Ansehen treffend beschreibt. Verlieren diese
Personen ihr soziales Geschick, dann verlieren sie auch ihr Ansehen.
76
Barbara
Hold (1976) hat in Kindergärten verschiedenen Erziehungsstils in Deutschland
und Japan sowie in Kindergruppen der Buschleute Selbstorganisationsprozesse
untersucht und festgestellt, daß auch hier die Kinder, die Spiele
organisieren können, Streit schlichten, Schwächere schützen und mit den
anderen teilen, Ansehen genießen. Ihnen zeigen die anderen Kinder Dinge, an
sie wenden sie sich, und zählt man aus, wer von den Kindern am häufigsten
von den anderen angeschaut wird, dann findet man auch schnell heraus, wer
»Ansehen« genießt.
Natürlich
gibt es auch in der individualisierten Kleingesellschaft einzelne, die sich
über Prahlerei und mit der Hilfe ihrer Ellenbogen über andere erheben
wollen. Wie wir ausführten, ist die Neigung zu repressivem Dominanzstreben
uns Menschen angeboren. Sie wird aber in den individualisierten
Kleingesellschaften nicht geduldet. Ein Buschmann der Zentralen Kalahari, der
mit seinem Jagderfolg prahlt, wird von den anderen zurechtgewiesen. Das meint
man wohl, wenn man diese Gesellschaften auch als egalitär bezeichnet. Der
Normierungsdruck ist sehr stark.
Repressive
Dominanz wird nur gegen Gruppenfremde geduldet, und in einigen traditionellen
Kulturen genießt der erfolgreiche und mutige Krieger Ansehen. Die Neigung,
repressive Dominanzbeziehungen zu Gruppenfremden herzustellen, schließt
Bündnisse zwischen Gruppen nicht aus. Im Gegenteil, es ist ein Merkmal des
Menschen, daß er dies kann. Aber Bündnisse zerbrechen leicht, wie die
Geschichte lehrt; Opportunismus geht über Bündnistreue, und daher geben sich
Menschen im Auftreten gegenüber Vertretern anderer Gruppen eher
förmlich-zurückhaltend. Vor allem meiden sie es, Zeichen von Schwäche zu
zeigen, da dies die anderen zu Dominanzverhalten verleiten könnte. Man gibt
sich daher im Umgang mit Fremden und weniger gut Bekannten gern selbstsicher
und stark, aber nicht provokant, es sei denn, man sucht Händel. Im
allgemeinen verbindet man die Verhaltensweisen oft aggressiver
Selbstdarstellung mit beschwichtigenden und bandstiftenden Appellen
(Eibl-Eibesfeldt 1970).
77
Die
Fähigkeit, auf der Grundlage persönlicher Bekanntheit größere Familien und
Sippenverbände zu bilden, führte zur Bildung individualisierter kleiner
Lokalgruppen, die sich von anderen, ähnlich organisierten abgrenzten.
Sippen-selektionistisch entwickelte Verhaltensweisen der Gruppenbindung
erweisen sich dabei so effektiv, daß schließlich auch Gruppenmitglieder, die
nicht unmittelbar als Blutsverwandte zu einer Familie gehörten, mit Hilfe
unterstützender kultureller Einrichtungen in der Lage waren, sich mit anderen
Mitgliedern zu solidarisieren, so daß die Gruppen in bestimmten Situationen,
etwa im Kriegsfall, als Einheiten auftreten und handeln konnten. Damit wurden
Gruppen, zusätzlich zu den Einzelpersonen und Sippen, übergeordnete
Einheiten der Selektion, denn schließlich entschieden Sieg und Niederlage oft
in dramatischer Weise über ihr Schicksal.
Bindungen
werden bei uns Menschen auf allen Ebenen durch Teilen, Geben und andere Formen
des reziproken Altruismus gefestigt. Das Schrifttum zur Evolution des
reziproken Altruismus in der ethologischen und anthropologischen Fachliteratur
ist umfangreich und kann hier nicht im einzelnen referiert werden.
Bemerkenswert sind soziale Netzwerke auf der Basis eines verzögerten
reziproken Gabentausches, der der sozialen Absicherung dient. Sie stellen
gewiß eine der wichtigsten kulturellen Erfindungen in der sozialen Evolution
unserer Spezies dar. Wir finden sie bereits in den kleinen auf Sippenbasis
begründeten Gemeinschaften. Eines der am besten analysierten Beispiele ist
das reziproke Austauschsystem Xharo der Kalahari-! Kung (Wiessner 1977, 1982).
Dort pflegt jeder erwachsene Mann und jede erwachsene Frau Beziehungen mit
durchschnittlich sechzehn Tauschpartnern, die sich über ein weites Areal, 20
bis 200 Kilometer vom Tauschpartner, verstreuen. Die Tauschpartner erhalten
Geschenke und erwidern diese mit einer gewissen Verzögerung.
78
Das
festigt einen ungeschriebenen Kontrakt, der es den Tauschpartnern erlaubt,
einander zu besuchen und in Zeiten der Not auch im Gebiet des Tauschpartners
zu jagen und zu sammeln. Gegenseitige Hilfe ist damit gesichert. Wiessner
konnte die Wirksamkeit dieser Art Sozialversicherung während der Hungersnot
im Jahre 1974 studieren. Als Geschenke werden Perlarmbänder, Pfeilspitzen und
in neuerer Zeit auch Objekte wie Decken ausgetauscht. Die Kosten, die jemand
aufwendet, um sie zu erwerben oder herzustellen, sind bemerkenswert; im
Durchschnitt beträgt der zeitliche Aufwand 15 Tage pro Jahr, um die
Tauschobjekte herzustellen oder zu erwerben. Die Tauschnetzwerke dienen sowohl
der sozialen Absicherung als auch dem Handel. Entwickeln sich größere
Gesellschaften, dann werden die Netzwerke weiter ausgebaut, um weiter
ausgedehnte Populationen zu Solidargemeinschaften zu vereinen.
Die
Fähigkeit, solche Netzwerke aufzubauen, gründet sich auf einige universale
Prädispositionen wie die fürsorgliche Motivation und die ihr zugehörigen
affiliativen Verhaltensweisen, ferner die Fähigkeit, zu symbolisieren. Für
die bindende Funktion des Gebens ist die universale Objektbesitznorm und die
Veranlagung zur verzögerten Reziprozität Voraussetzung. Dazu kommt noch die
Fähigkeit, auch nicht Verwandte oder nur entfernt Verwandte in das familiale
Verhalten einzubeziehen. Das geschieht insbesondere durch den Aufbau fiktiver
Verwandtschaftsbeziehungen über Heirat.
Eine
bemerkenswerte Eigenschaft der menschlichen Sozialorganisationen betrifft die
männliche Gruppensolidarität, eine Erscheinung, die Lionel Tiger (1969)
ausführlich erörterte. Eine Vorbedingung für ihre Evolution könnte die Virilokalität
gewesen sein. In der Mehrzahl der sippenbegründeten Gesellschaften
bleiben die Männer gewöhnlich in ihrer Lokalgruppe und innerhalb ihres
Territoriums, während Frauen oft abwandern.
79
Ein
ähnliches Muster finden wir übrigens bei unseren nächsten Tierverwandten,
den Schimpansen, bei denen die Männchen ebenfalls in dem Territorium bleiben,
in dem sie geboren wurden. Nur Weibchen können während ihrer ersten Brunst
zu anderen Gruppen abwandern und damit ihre Gemeinschaft wechseln. Die
Männchen einer Lokalgruppe der Schimpansen sind daher in der Regel nahe
Blutsverwandte, und die männliche Solidarität fördert die Gesamteignung.
Bei unseren frühen Vorfahren könnten ähnliche Verhältnisse vorgelegen
haben. Selbst heute noch neigen Männer dazu, bei der Gruppe ihrer Geburt zu
bleiben, während Frauen öfter mit der Heirat auch den Ortswechsel
vollziehen. Aber die Solidarität der Frauen zu ihrer Geburtsgruppe bleibt
erhalten, und das erlaubt es, über die Verwandten der Frau wechselseitige
Beziehungen zu Mitgliedern anderer Gruppen herzustellen. Solche Allianzen, die
vielfach dazu dienen, eine Vielfalt von Risiken aus der Natur und dem sozialen
Umfeld zu reduzieren, sind eine wichtige Voraussetzung für die Herstellung
von Zwischengruppenallianzen (Wiessner 1977, 1982; Winterhaider 1986; Smith
1988).
Mit
der Unterscheidung des »Wir und die anderen« kam eine neue Qualität
sozialen Verhaltens in die Welt und ein neues Potential für die weitere
Evolution. Mitglieder der gleichen Art wurden je nach Nähe oder Distanz als
Freund oder Gegner unterschieden. Agonistische Verhaltensweisen sind sehr alt,
wir erwähnten die Rivalenkämpfe der Meerechsen. Reptilien kennen jedoch nur
»andere«, und zwar sowohl als potentielle Fortpflanzungspartner wie auch als
Rivalen. Die Fähigkeit, eine Wir-Gruppe von den »anderen« zu unterscheiden,
finden wir erst bei den Vögeln und Säugern4. Diese neue Fähigkeit drückte
sich in einer Vielfalt von Erscheinungsformen aus: in der Paarbindung, der
Familie, den individualisierten Gruppen des Menschen, ja selbst in den
anonymen Großgesellschaften, den Nationen. Die fürsorglichen, affiliativen
Verhaltensweisen der Bindung und die Exklusivität, die mit ihr einherging,
brachten ein neues evolutionäres Potential in die Welt.
80
Beim
Menschen knüpfen Bande der Freundschaft und Zugehörigkeit die Mitglieder der
individualisierten Gruppe in einer Art Urvertrauen aneinander. Im Kontrast
dazu begegnet man Fremden mit einem gewissen Mißtrauen. Xenophobie ist
bekanntlich ein universales Phänomen (Reynolds et al. 1986; Eibl-Eibesfeldt
1989). Ich möchte jedoch betonen, daß man die Fremdenfurcht nicht
verwechseln darf mit Fremdenhaß, der ein Ergebnis spezieller Indoktrination
ist. Wir müssen allerdings zur Kenntnis nehmen, daß das Urmißtrauen Fremden
gegenüber unsere Wahrnehmung mit einem Vorurteil belastet, so daß eine
negative Erfahrung mit einem Fremden uns im allgemeinen mehr beeindruckt als
eine Vielzahl positiver Erfahrungen. Im Wettstreit mit Fremden neigen wir
dazu, repressive Dominanzbeziehungen herzustellen. Die primäre Gefühlsethik
gegenüber Fremden ist sicher sehr von der Gefühlsethik gegenüber eigenen
Gruppenmitgliedern unterschieden.
Das
menschliche Sozialverhalten ist in dieser Weise durch eine fundamentale
Ambivalenz dem Mitmenschen gegenüber gekennzeichnet. Verhaltenstendenzen der
Meidung und der Kontaktbereitschaft werden gleichzeitig aktiviert, wobei sich
die Stärke dieser Tendenzen auf einer gleitenden Skala von Fremd nach
Bekannt, vom Agonistischen zum Affiliativen verschiebt. Die agonistischen
Verhaltenstendenzen repressiven Dominanzstrebens sind, wie schon ausgeführt,
altes Landwirbeltiererbe. Am menschlichen Hirn hat das Reptilhirn immerhin
noch beträchtlichen Anteil (Bailey 1987). Ich möchte an dieser Stelle ein
weiteres Mal daran erinnern, daß die alten Dominanz- und
Unterwerfungsmechanismen auch beim Menschen noch wirksam sind, was sich unter
anderem darin bemerkbar macht, daß bei Erreichen einer Dominanzposition beim
Mann über Ausschüttung des männlichen Sexualhormons ins Blut eine Art
physiologischer Belohnung erfolgt, die, wie wir bereits ausführten,
Vitalität und Selbstgefühl bekräftigt. Sie können aber, wie wir schon
zeigten, durch die dem Mutter-Kind-Bereich entstammenden
fürsorglich-bindenden Verhaltensweisen und Motivationen gebändigt werden.
81
Für
den individualisierten Kleinverband, in dem jeder jeden kennt, gilt, daß sich
keiner über andere erheben darf (Wiessner 1995). Das heißt nicht, daß es in
diesen Gruppen keine Rangordnungen gibt, aber sie gründen sich nicht auf
repressive Dominanz, sondern auf prosoziale Eigenschaften und werden am besten
als »Ansehen« charakterisiert. Personen, die sich durch prosoziales Geschick
auszeichnen, sind es, nach denen man sich richtet, denen man Aufmerksamkeit
schenkt. Verlieren sie die soziale Kompetenz, dann verlieren sie auch ihr
Ansehen, und man orientiert sich nicht mehr an ihnen. Da Frauen besonderes
Geschick im sozialen Umgang mit anderen haben und viel zur freundlichen Pflege
sozialer Beziehungsnetze beitragen, genießen auch sie in dieser Hinsicht
besonderes Ansehen, hier wieder besonders ältere, erfahrene Frauen. Daß nach
außen hin Männer für den Beobachter mehr in Erscheinung treten, rührt
daher, daß Männer im Zusammenhang mit ihrer territorialen, abgrenzenden
Funktion die Gruppe nach außen vertreten. Als männlicher Besucher begegnet
man zuallererst ihnen.
Von
der repressiven, nach außen gerichteten Dominanz ist eine prosoziale Dominanz
zu unterscheiden. Bereits im Tierreich führen die Eltern, die Jungen folgen
ihnen. Für uns Menschen gilt das natürlich in besonderem Maß, denn das
Menschenkind ist besonders lange von der Fürsorge der Eltern abhängig. Die
Eltern, hier insbesondere die Mütter, sind Fluchtziel. Sie nähren und
unterweisen, und da viel Wissen an die nächste Generation weitergegeben
werden muß und jedes Kind sehr viel zu lernen hat, ist beim Kind eine
deutliche physiologische und körperliche Entwicklungsverzögerung
festzustellen. Der Mensch erreicht seine Geschlechtsreife im Vergleich zu
anderen Primaten ziemlich spät und verharrt bis dahin auf einem kindlichen
Entwicklungszustand, der es den Eltern physisch wie psychisch ermöglicht,
Kinder zu betreuen, zu führen, zu unterweisen und sie auch bei Fehlverhalten
in die Schranken zu weisen.
82
Erst
in der Pubertät kommt es zu einem dramatischen Entwicklungsschub mit einer
gewissen Emanzipation des Kindes, die in einer Loslösung von der
mütterlichen oder elterlichen Dominanz besteht.
Hier
treten allerdings in modernen Gesellschaften oft auch Störungen auf, wenn das
Bedürfnis, zu betreuen, das besonders bei Müttern stark ausgeprägt ist,
nicht durch das Betreuen noch vorhandener jüngerer Kinder oder der ersten
Enkel abgefangen wird. Das ist in der kinderarmen anonymen Großgesellschaft
unserer Tage, die außerdem durch ihre Mobilität Sippenverbände
auseinanderreißt, ziemlich oft zu beobachten. Auch in der ehelichen
Gemeinschaft kann sich die partnerschaftliche Fürsorglichkeit bisweilen zur
fürsorglichen Dominanz auswachsen. Freundlichkeiten und Aufmerksamkeiten
werden dann eventuell zur Bedrängnis (oder auch nur als solche empfunden).
3.
Territorialität, Krieg
Menschen
grenzen sich in der Regel in Gruppen unterschiedlicher Größe von anderen
Menschengruppen ab, und sie nehmen bereits auf der Stufe altsteinzeitlicher
Wildbeuter Jagd- und Sammelgebiete, Wasserstellen und ähnliche begrenzte
Ressourcen in Besitz, die sie notfalls auch gegen andere verteidigen. Im
allgemeinen entwickeln sich jedoch Konventionen, die zur Achtung von
Landrechten führen. Die Art und Weise, wie territoriale Rechte gesichert
werden, erfährt der speziellen ökologischen Situation entsprechende
kulturelle Abwandlungen. In den Trockengebieten Australiens, wo die einzelnen
Lokalgruppen über ein großes Gebiet verfügen müssen, kann eine Gruppe ihr
Gebiet nicht dauernd patrouillieren. Hier dienen heilige Stätten als
Platzhalter. Sie stammen dem Glauben der Zentralaustralier zufolge von
Totem-Ahnen ab, deren Geister auch heute noch über das betreffende Gebiet
wachen.
83
Diese
symbolischen Zentren der Territorien sind absolut tabu. Da alle fest an die
Totem-Ahnen glauben, werden territoriale Übergriffe tunlichst vermieden.
Außerdem sorgt jede Gruppe durch besondere Rituale für das Gedeihen der
Totemtiere einer Gruppe, die als Nahrung für alle wichtig sind. Würde man
eine Gruppe vertreiben, dann gäbe es dieses Jagdwild nicht mehr. Auch das
schützt die Territorien.
Bei
den afrikanischen Buschleuten (G/wi, !Ko, Nharo) gibt es unterschiedliche
Manifestationen der Territorialität, die E. A. Cashdan (1983) zu deren
spezieller Ökologie in Beziehung setzt. Auf welche Weise territoriale Rechte
gesichert werden, das wechselt — aber an der Tatsache, daß Menschen nicht
erst mit der Feldbestellung und Tierzucht Gebiete für sich beansprucht haben,
kann man nach den mittlerweile reichlich vorliegenden Erhebungen nicht mehr
zweifeln. Ich betone dies, weil in den sechziger Jahren die Hypothese
vertreten wurde, daß die Jäger- und Sammlerkulturen nichtterritorial und
friedlich gelebt hätten und jene, die noch existieren, das auch noch heute
täten (Lee und DeVore 1968). Diese Offenheit, wurde ferner behauptet, sei
auch für die uns nächsten Tierverwandten, die Schimpansen, typisch und sei
ein zusätzliches Indiz für die ursprüngliche Friedfertigkeit des Menschen
(Reynolds 1966). Mittlerweile hat man die Buschleute der Kalahari näher
kennengelernt, und selbst aus den neueren Beschreibungen von Richard B. Lee
(1979) kann man entnehmen, daß Buschleute über Landrechte und Rechte an
Ressourcen verfügen und auch darauf achten, daß diese von anderen
respektiert werden. Man weiß auch, daß sie ihre Reviere bis in die Gegenwart
verteidigt haben. Auf ihren alten Felsmalereien kann man sehen, wie sich
Buschmanngruppen schon früh mit Pfeil und Bogen bekämpften (Abb. 13). Auch
die Geschichte von den friedlichen Schimpansen hielt einer kritischen
Überprüfung nicht stand (Eibl-Eibesfeldt 1975, 1997).
84
Ich
weise darauf hin, weil immer wieder auch in der angesehenen Tagespresse
Artikel erscheinen, die die Territorialität als etwas rein Kulturelles
betrachten. Selbst Nomaden wandern nicht
uneingeschränkt, sondern entlang bestimmter Routen, etwa im Jahreszyklus
bestimmte Weiden besuchend oder bestimmte Fangplätze für Fische, deren
Zugänglichkeit wieder auf verschiedene Art geregelt sein kann.
Kollektive
Verteidigung der Reviere und Gruppenaggressionen finden wir bereits bei
einigen in Gruppen lebenden Affen. Sehr ausgeprägt ist sie bei Schimpansen,
bei denen Männchen in Gruppen die Reviergrenzen patrouillieren und dabei auch
Überfälle auf Mitglieder benachbarter Gruppen machen. Es gibt also
Vorläufer für die für uns Menschen charakteristische kollektive
Gruppenaggression.
Die
Konkurrenz zwischen Gruppen um begrenzte Ressourcen wie kultivierbares Land
oder Jagdgebiete wurde bei uns oft in kämpferischer Weise ausgetragen. Solche
Kämpfe endeten dann mit der Vertreibung, Unterjochung oder der physischen
Vernichtung des Gegners.
Der
Krieg, definiert als strategisch geplante, von besonders ausgewählten
Männern angeführte und unter dem Einsatz destruktiver Waffen durchgeführte
Gruppenaggression, ist jedoch ein Ergebnis der kulturellen Evolution, die zwar
angeborene Verhaltensdispositionen in ihre Dienste nimmt, sie aber kulturell
auf besondere Weise gewichtet und ausgestaltet. So wird zum Beispiel der
Einsatz der Krieger für die Gemeinschaft besonders hoch bewertet. Auch werden
Feinde durch Indoktrination zu minderwertigen oder bösen Menschen erklärt,
ja selbst zu Nichtmenschen, die es auszurotten gilt. Die Wirksamkeit
mitleidheischender Gebärden der Unterwerfung wird so verringert bis
ausgeschaltet. Dazu tragen noch wenig untersuchte physiologische Prozesse bei,
die bei den Kriegführenden geänderte Bewußtseinszustände verursachen.
85
Abb.
13 Der Krieg kam
nicht erst mit dem Ackerbau in die Welt. Auch Jäger- und Sammlervölker
praktizierten ihn, wie die Felsmalereien der Buschleute in den Drakensbergen
belegen, die aus der Periode vor dem Kontakt mit dem Europäer stammen. Die
hier gezeigten Felsmalereien befinden sich auf der Farm Godgegeven bei
Warden in Südafrika. Die Aufnahmen a) und c) zeigen jeweils zwei einander
bekämpfende Buschmanngruppen, die Aufnahme b) wohl eine innerethnische
Auseinandersetzung. Die Buschleute kämpfen gegen einen dunkleren,
gedrungeneren Menschentypus. Einer trägt in der Hand eine Waffe
(Faustkeil?). - Fotos: I. Eibl-Eibesfeldt.


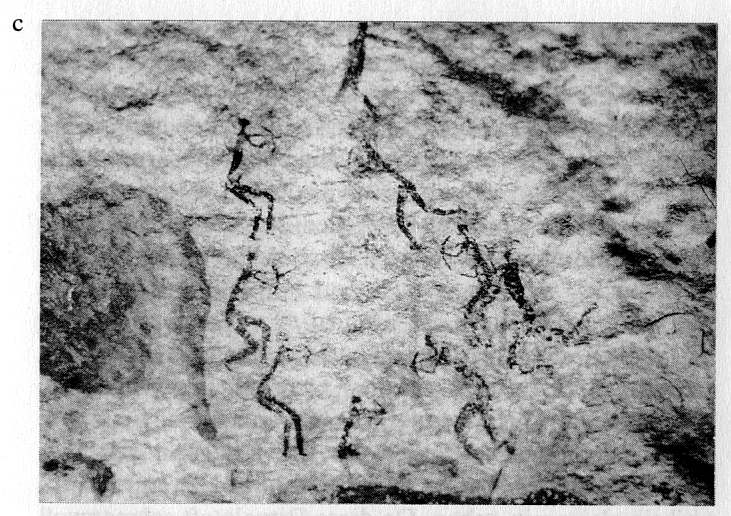
Die
Auseinandersetzungen zwischen zwei verfeindeten Gruppen der Enga auf Neuguinea
beginnen zum Beispiel wie ein Sportereignis5. Die Kontrahenten stehen einander
auf einer Lichtung gegenüber und verhöhnen einander, von ihren Schilden
gedeckt. Dann fliegen die ersten Pfeile, und eine große Erregung erfaßt die
beiden Gruppen. Sie rücken gegeneinander vor, und einzelne Personen scheinen
wie weggetreten.
Sie
scheinen in diesem veränderten Bewußtseinszustand weniger gehemmt, wie in
einer Art Rausch, der wahrscheinlich auf die Wirkung des in diesem Zustand
verstärkt ausgeschütteten Hirnopioids Endorphin zurückzuführen ist. Wird
einer von einem Pfeil getroffen, dann merkt er das wohl, und er zieht sich
zurück, aber er scheint keine starken Schmerzen zu empfinden — die kommen
erst später, wenn seine Verletzung von den anderen behandelt wird. Daher
assoziiert er den Schmerz nicht unmittelbar mit dem Kampfgeschehen,
was eine Abdressur kriegerischen Eifers verhindert.
86-87
Interessant
ist, daß die Krieger in der Phase des Endorphinrausches auch Massaker
begehen; später befragt, leugnen sie, daß sie sich so verhalten hätten (wie
Polly Wiessner mir mitteilte, die lange bei den Enga weilte). Ob
es sich hier um echte Amnesien oder um Verdrängungen handelt, kann man nicht
feststellen. Wahrscheinlich wirkt beides zusammen, wobei der Wunsch
nach Verdrängung interessant ist, weist er doch darauf hin, daß durchaus
Tötungshemmungen vorhanden sind.
Bereits
Freud macht darauf aufmerksam, daß im Verhalten gegenüber Feinden offenbar
nicht nur feindselige Gefühle wirksam seien, sondern auch freundliche. Er
schloß dies aus der Tatsache, daß erfolgreiche Krieger in verschiedensten
Kulturen Säuberungsrituale absolvieren müssen, weil sie als unrein gelten.
Da diese Rituale oft schmerzvoll sind und mit Entbehrungen verbunden, sind sie
Sühneritualen gleichzusetzen. Wir kennen sie in der Tat von vielen Kulturen.
Helena Valero beschrieb sie zum Beispiel von den Yanomami des Oberen Orinoko
(Biocca 1970), unter denen sie viele Jahre als weiße Gefangene lebte. Sie
erzählt auch, wie die Gruppe, bei der sie lebte, einmal eine andere überfiel
und dabei ein Massaker unter Frauen und Kindern anrichtete. Sie diskutierten
danach, ob es richtig gewesen sei, das zu tun, und zwar mit dem Ausdruck
deutlich schlechten Gewissens. Sie beruhigten sich damit, daß sie ja nicht
alle umgebracht hätten und die Frauen wieder Kinder kriegen würden.
Überdies sei es notwendig gewesen, da ja sonst die Buben zu waffentüchtigen
Kriegern herangewachsen wären, die Rache nehmen könnten.
Der
Krieg ist eine Hochrisiko-Strategie, und wir beobachten daher, daß sich im
Laufe der menschlichen Geschichte Konventionen entwickeln, die ähnlich wie
bei den Kommentkämpfen der Tiere das Risiko beim Kräftemessen mindern.
Allerdings hinken bei der rasanten Entwicklung der technischen Mittel die
Konventionen immer hinter der Waffentechnik her, wie wir das bis in die
Gegenwart beobachten können.
88
Der
Krieg steckt sicher nicht in unseren Genen, aber als kulturelle Anpassung
nützt er angeborene agonistische Dispositionen und unterdrückt die
prosozialen Dispositionen dem Feind gegenüber. Er hat insofern mit den Genen
zu tun, weil es die Gene der Siegreichen sind, die bevorzugt weitergegeben
werden. Als eine kulturell entwickelte Methode des Wettstreits gestattet er
Gruppenselektion, das haben kürzlich Untersuchungen über die Kriege in
Neuguinea durch J. Soltis, R. Boyd und P. J. Richerson (1995) bestätigt. Die
Gruppenausrottung, von der sie berichten, ist beachtlich, obgleich die Autoren
betonen, daß viele der Besiegten und ihres Landes verlustig Gegangenen als
Flüchtlinge absorbiert wurden. Wir können auch in solchen Fällen davon
ausgehen, daß der Verlust der Ressourcen die Überlebenstüchtigkeit der
Verlierer nicht gerade förderte.
Bis
vor kurzem wurde das Konzept der Gruppenselektion von den meisten Fachleuten
abgelehnt, aber sie wurde als Möglichkeit auch nicht ausgeschlossen. E. O.
Wilson (1975) wies darauf hin, daß durch Indoktrination geschaffene
Konformität Gruppen so eng zusammenschließen könne, daß sie zu Einheiten
der Selektion würden. Würde andererseits die Konformität geschwächt, dann
stürben Gruppen unter Umständen auch aus. »Gemeinschaften, die eine höhere
Frequenz von konformen Genen haben, würden solche, die verschwinden, ersetzen
und damit die durchschnittliche Frequenz in den Metapopulationen der
Gesellschaften ... Die Gene könnten von der Art sein, die die
In-doktrinierbarkeit des Menschen fördern, selbst auf Kosten der Individuen«
(Wilson 1975, S. 562).
Ich
stellte unabhängig davon die These auf, daß mit der
individualselektionistischen Entwicklung der individualisierten Bindung und
einiger anderer Anpassungen im Dienste der Brutfürsorge Verhaltensweisen
gewissermaßen als Voranpassungen zur Verfügung standen, die es erlauben,
auch nicht Blutsverwandte in Gruppen so zu binden, daß Gruppenselektion
wahrscheinlich wird — vorausgesetzt, daß die in geschlossenen Großgruppen
Vereinten genetisch näher miteinander verwandt sind als mit anderen.
Kulturenvergleichende
Untersuchungen belegen die Existenz von kulturellen Strategien, die es Gruppen
erlauben, als Einheit aufzutreten, selbst wenn dies gegen die Interessen
vieler Individuen geht. Die Kriegsethik, die Indoktrinierbarkeit des Menschen
mit Werten der Gruppe und die Ethik des Teilens scheinen schwer allein auf der
Basis der Individualselektion erklärbar zu sein (Eibl-Eibesfeldt 1982). Wir
werden auf das Phänomen der Indoktrination im folgenden noch genauer
eingehen.
Bis
zum heutigen Tag beobachten wir, daß Menschen im großen wie im kleinen auf
Gruppenbasis kriegerisch und wirtschaftlich scharf miteinander konkurrieren.
Der Krieg steckt, wie gesagt, nicht in unseren Genen, er fördert aber die
Verbreitung der Gene der Sieger, wir sind alle Nachfahren erfolgreicher
Krieger. Mit dieser Wirklichkeit müssen wir uns auseinandersetzen, wenn wir
eine friedlichere Weltgemeinschaft wollen.
Der
Krieg ist eben nicht, wie manche behaupten, nur eine pathologische Entgleisung
einer im Grunde friedlichen Menschennatur. Er ist ein kulturell
entwickelter Mechanismus im Dominanzwettstreit um Territorien und andere
Ressourcen. Wenn wir den Krieg aus der Welt schaffen wollen, müssen wir
darüber nachdenken, welche Konventionen wir dazu entwickeln müssen und wie
wir die Konkurrenz entschärfen können. Eine Voraussetzung für friedliche
Koexistenz wäre, daß alle Staaten sich verpflichten, ihre Bevölkerung nicht
über die Tragekapazität ihres Landes hinaus wachsen zu lassen.
89-90
#
www.detopia.de
^^^^