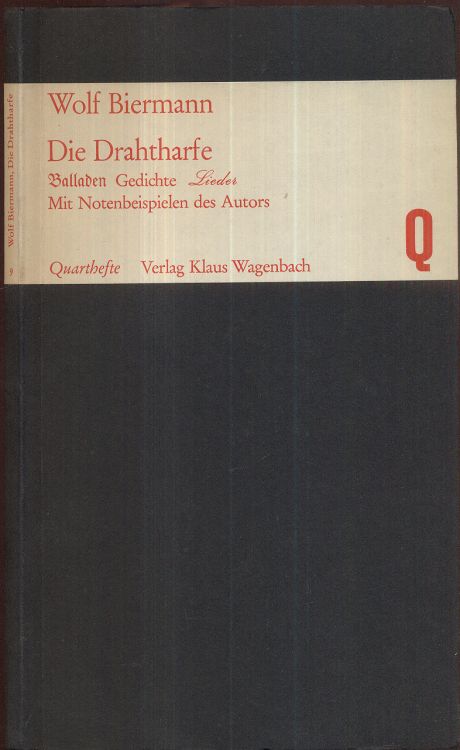Unterschwellig ging es meistens darum, der am Tisch lauschenden
Weiblichkeit zu imponieren. Über der ganzen Szenerie lag spürbar das Jämmerliche
eines bloßen Unbehagens, das nur räsonieren konnte, wodurch die ganze
Fragwürdigkeit und Belanglosigkeit unserer eigenen Existenz um kein Stück
durchsichtiger oder etwa gar behoben wurde.
Mir genügte das nicht! Ich wollte nicht nur die Rolle des durch die Stimmen
der revolutionären Ahnenwelt aufgescheuchten Erben spielen. Ernesto Che Guevara
kam mir da mit seiner Propaganda der Tat angesichts des amerikanischen Krieges
gegen das vietnamesische Volk viel mehr entgegen. Guevaras Predigt, den Krieg
nicht zu fürchten und zur Verteidigung Vietnams die US-Imperialisten und ihre
Helfer überall auf der Welt anzugreifen, fand ich hinreißend. Überhaupt Vietnam!
Schreckliche Bilder aus dem fernen Land geisterten mir im Kopf herum. Zitternde
kleine Mädchen - von Napalm gezeichnet - hörte ich um Hilfe rufen. Soli-Marken
kleben? Sollte das alles sein, was man gegen die Kriegsverbrechen der Yankees
tun durfte? Hatte Marx uns nicht gelehrt, die Waffe der Kritik könne die Kritik
der Waffen nicht ersetzen? Die Gefahr dieser Maxime, welche ich mir zu eigen
machte, bestand dummerweise darin, dass sie einerseits auf die provinziellen
DDR-Verhältnisse überhaupt nicht passte und sie mich andererseits zur
Überheblichkeit verleitete, da sie das Verlangen nach Außergewöhnlichkeit und
einer Rolle im internationalen Klassenkampf in mir entfachte.
Es mag heute wie ein schlechter Witz klingen, aber Che Guevara sorgte bei mir
nicht nur für ein schlechtes Gewissen, er stachelte auch meinen revolutionären
Eifer an. Unter scheinbar lauter konformistischen Genossen, die sich bestenfalls
Jeans und liberalere Verhältnisse wünschten, stolzierte ich bald schon wie ein
kleiner Savonarola umher und faselte von einer Wahrheit, die aus den
Gewehrläufen kommen würde. War das alles nur eine hohle Geste, betört von der
Schicksalsgöttin des Fanatismus? Linker Zeitgeist im Osten wie im Westen?
Grassierend unter all jenen, die ihre Hoffnung auf das letzte Gefecht um keinen
Preis aufgeben mochten?
Als SDS-Genossen aus München, die uns 1966 an der Jenaer Universität
besuchten, mir und den anderen für diese Begegnung ausgewählten
67
Kommilitonen in nächtelangen Gesprächen unter die Nase rieben, wir seien
»durch Unterlassen« mitschuldig am Leid der Vietnamesen, weil der Warschauer
Pakt den Vietcong im Stich lasse, fühlte ich mich beschämt. Ich konnte es nicht
ertragen, von den Münchnern als Schlappschwanz und Feigling hingestellt zu
werden. »Ihr habt die MiGs - und was tut ihr?« So lautete der Vorwurf der Brüder
und Schwestern aus dem Westen, den ich heute noch im Ohr habe. Sie hielten die
Mauer für okay, die antifaschistische DDR war selbstverständlich das bessere
Deutschland, wir lagen gemeinsam in den Betten, nur dass wir nicht am Himmel und
im Dschungel Vietnams gegen die Amis kämpften, das war unverzeihlich. Wie
konnten wir uns erdreisten, einfach so auf unser Examen hinzuarbeiten, anstatt
loszustürmen und die Bastionen des völkermordenden US-Imperialismus umzurennen?
In den Diskussionen kam ich mir manchmal vor wie jemand, der es sich in der
Etappe gutgehen ließ, während die ehrlichen Genossen wacker an der Front
kämpften. Unter dem Verdacht, ein Feigling zu sein, litt wahrscheinlich sonst
keiner. Was uns die bajuwarischen Klassenkämpfer an den Kopf warfen, vor allem
ihr Bejahen des Revolutionsterrors, frei nach dem Vulgärmotto »Wo gehobelt wird,
fallen Späne«, verschlug mir oft die Sprache. Aus politischen Gründen Leute
umzulegen hielten einige von ihnen für unumgänglich.
Revolutionäre Gewalt!
Lenin! So wie Jean-Paul Sartre, der ja noch Jahre später, 1973, in einem
Interview auf die Frage, ob er die Todesstrafe für die Gegner der Revolution
befürworte, frank und frei erwiderte: »Ja, ... eine Revolution muss eine gewisse
Anzahl von Menschen, die für sie eine Gefahr darstellen, loswerden, und ich sehe
dafür keine andere Lösung, als sie zu töten; aus einem Gefängnis kann man immer
herauskommen.«
Gewalt war für die sich zum antiimperialistischen Sturmtrupp aufplusternden
Töchter und Söhne des westdeutschen Bürgertums nicht nur das Losungswort im
Kampf um die Weltherrschaft. Sie mussten, wie sie uns haarklein belehrten -
schließlich hatten sie und nicht wir bittere Erfahrungen machen müssen -,
darüber hinaus auch noch der braunen Flut Paroli bieten, die bei ihnen zu Hause
hinter jeder Straßenecke lauerte. Was diesen Punkt anbelangt, staunte ich. So
richtig hatte ich dem alarmistischen Gerede eines Karl-Eduard von Schnitzler und denen, die seinen propagandistischen Müll nachbeteten, bis dahin nie getraut.
Aber nun hörte ich, die Lage sei viel dramatischer. Und stündlich spitze sie
sich weiter zu. Er stehe wieder vor der Tür!
Lese ich heute die Briefe, die ich später bekam, legten die westdeutschen
Genossen offenbar größten Wert darauf, mir über die faschistische Gefahr in
Westdeutschland die Augen zu öffnen. Anfang Juni 1967 erhielt ich einen Brief
aus München, in dem mir der stellvertretende AStA-Vorsitzende Hans-Peter M.
schrieb:
»Welch schönes westdeutsches Leben. Konsumiere, auf Teufel komm raus,
VWs, Kunststoffartikel, Polizistenblei und Hartgummi. Die Alternativen sind
heute auf eine reduziert - Faschismus ... Die Rollen sind verteilt, das System
der Werte und Repressionen funktioniert wie im Lehrbuch, stabil.«
Heute klingt
so etwas überzogen. Aus der abgeklärten Distanz eines halben Jahrhunderts mag
man vielleicht sogar annehmen, wer damals so dachte, sei nicht ganz bei Trost
gewesen. Aber auch 20 Jahre später machten dieselben Gespensterseher mir noch
einmal Vorwürfe.
Da besuchte mich eine Delegation westdeutscher Richter, Notare
und Rechtsanwaltskollegen, die sich 1989 für eine Aufhebung des mir nach der
Veröffentlichung des »Vormundschaftlichen Staates« auferlegten Berufsverbotes
engagierten. Ich hätte mich leider nicht mit den faschistoiden Tendenzen in der
BRD auseinandergesetzt, warfen die Kollegen mir da vor. Sie, die sich seit
Jahrzehnten für diejenigen hielten, auf deren Schultern die Last des Kampfes
gegen die braune Gefahr in Westdeutschland ruhte, sahen darin ein
unverzeihliches Manko meines Buches. Mit meiner Antwort, ich hätte für meine
Mitbürger in der DDR geschrieben, mochten sie sich nicht zufriedengeben.
Zum Einsatz an der unsichtbaren Front im Operationsgebiet West geeignet
Menschen, die sich einer kämpferischen Ethik verpflichtet fühlen, benötigen
eine Aufgabe, die sie aus ihrer gewöhnlichen Mitwelt hervorhebt. Mir ging es
nicht anders. Als vermeintlicher Held musste man schließlich wissen, welche
Grenzen man überschreiten wollte, um sich von den weniger bedeutenden,
vergänglichen Zufallswesen um einen herum abzusetzen. Nun wurde ich ausgerechnet
zu jener Zeit, als ich meinen Verstand auf dem Altar der Revolution opfern
wollte - ich möchte fast sagen: im passenden Augenblick -, von zwei
Staatssicherheitsoffizieren namens Götze und Eismann angesprochen. Sie duzten
mich, nannten mich Genosse, und ich fand, es konnte gar nicht anders sein.
Jedenfalls mussten Götze und Eismann keinerlei Überredungskünste bemühen, um
mich für ihren Geheimdienst zu rekrutieren. Es reichte aus, dass Oberleutnant
Götze mir mit hochgezogenen Augenbrauen sagte, seine Behörde würde mich gern im
»Operationsgebiet West« einsetzen. Mir, der ich im Kampf der Systeme ein Niemand
war, schmeichelte das. Ich war ja voller Ungeduld und begierig darauf, doch
endlich, endlich einmal im internationalen Klassenkampf mitzumischen.
Wie aus Eismanns dokumentierten Aktenvermerken zu entnehmen ist, hatten die
Herren der Bezirksverwaltung Gera/Abteilung II/2 bereits bei ihrem ersten
Treffen mit mir so ihre Absichten: »Es ist geplant, den Kandidaten in Richtung
äußere Abwehr einzusetzen. Dabei ist vorgesehen, ihn aufgrund seiner
Möglichkeiten als Ermittler auszubilden. In der Perspektive soll der Kandidat
nach entsprechender Vorbereitung und Bewährung zeitweilig im Operationsgebiet
eingesetzt werden.« Was Götze und Eismann mir offerierten, sah auf jeden Fall
spannender aus als bloßes Nichtstun.
Überlege ich es mir richtig, dann war das, was mich reizte, die Aussicht, an
der geheimnisumwitterten unsichtbaren Front, »feindwärts«, wie die Genossen
betonten, im Kampf der Systeme nach dem Vorbild Richard Sorges mitzumischen.