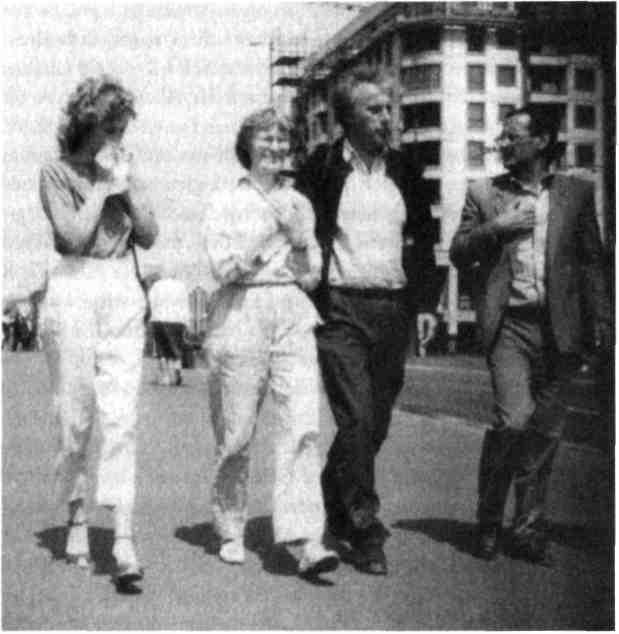
Undurchsichtigkeit und Verdacht
220-238
So mancher Frosch im Dissidententeich, der, eingeschüchtert durch die schmutzigen und schwindelerregenden Erfolge der Stasi, zitterte, konnte sich so wie die Tschekisten gar nicht mehr vorstellen, dass ein heikles Buchprojekt unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle der Geheimpolizei mit ein bisschen Glück durchführbar gewesen ist. Da musste einfach zwangsläufig die Firma ihre Finger mit im Spiel gehabt haben! Wie hätte das Ganze sonst gelingen können?
Mir kamen solche Gerüchte erstmalig im Januar '90 zu Ohren. Ich dachte anfänglich, so was traut mir kein Mensch zu. Erst als ich dann bei meiner Akteneinsicht den letzten - nach dem Fall der Mauer - von einem Major namens Hoffmann speziell auf meine Person zugeschnittenen Zersetzungsplan der Abteilung XX7 AGNF vom 14. November 1989 gelesen habe, wurde mir die Hinterhältigkeit des gegen mich gerichteten Maßnahme-Katalogs bewusst. Unter Ziffer 1 heißt es da: »Wir sehen in H. den Feind.«
Darüber konnte ich nicht verwundert sein. Als ich dann aber die wohldurchdachten »Ausgangspunkte«, »Folgerungen«, »Arbeitsschritte« und »Blickwinkel« gedanklich für mich nachgezeichnet habe, wie sie in dem Papier ausdrücklich bezogen auf das »Langzeitziel« hin formuliert sind, mich ein für allemal »zur Kapitulation zu zwingen«, da wurde mir doch klar, wie verheerend seinerzeit das Gift der Verdächtigungen gewirkt haben muss, welches die Operativniks gezielt versprüht haben. Einmal ausgebrütet, wurde der mich ins Zwielicht setzende Gerüchteteig um die Jahreswende 1989/90 ausgerechnet von altgedienten Bürgerrechtlern mit frischer Hefe zum Treiben gebracht - also von Leuten, mit denen ich mich freundschaftlich verbunden fühlte. Selbst Bärbel Bohley war sich nicht zu schade, Achim Maaz zu fragen, ob ich nicht vielleicht im Auftrag der Staatssicherheit geschrieben hätte. Auf die Idee, das Gespräch mit mir zu suchen, kam sie nicht. Eine Kränkung, die ich nie verwunden habe.
Es ist deshalb vielleicht nicht überflüssig, für alle Fälle einiges klarzustellen.
Wie ich dem mich einstufenden Einleitungsbericht für die operative Personenkontrolle (12. Februar 1988) entnehmen muss, verdächtigten mich die Geheimen nicht etwa wegen der von mir beabsichtigten Veröffentlichung des »Vormundschaftlichen Staates«. Aufklären wollten sie lediglich, wie es um meine »wirkliche politisch-ideologische Einstellung« stand und welchen »Charakter« die in Hammerfort und Oegeln »stattfindenden Zusammenkünfte« hatten. Unsere ständigen Treffen beunruhigten sie. Sie wollten herausfinden, wie sie in ihrem Bericht hervorheben, ob Achim Maaz und ich durch die veranstalteten Diskussionsrunden die Verbrechenstatbestände der staatsfeindlichen Hetze (§ 106 StGB) und des verfassungsfeindlichen Zusammenschlusses (§ 107 StGB) erfüllten.
Strafrechtliche Vorwürfe in dieser Preisklasse waren sicher maßlos übertrieben. Angesichts der Furcht vor jeder Art Gruppenbildung ist der Vorgang jedoch verständlich. Jedes Kaffeekränzchen, bei dem Menschen aus ihrem Herzen keine Mördergrube machten und über die Verhältnisse meckerten, wurde von den Herrschaften der Sicherheit ja erforderlichenfalls zu einem verfassungsfeindlichen Zusammenschluss hochgejubelt, was zunächst nicht allzu viel besagte. Aber diese Tatbestände reichten den Schnüfflern offenkundig nicht aus. Major König und Hauptmann Bautz wollten darüber hinaus noch ermitteln, ob Maaz und ich auch die Straftatbestände des Landesverrats mit unserem Tun verletzten. Spionage und landesverräterische Agententätigkeit - mehr ging nicht!
Man könnte annehmen, dass sich in einer solchen juristischen Würdigung die Paranoia unserer Schlapphüte zeigte. Es gehörte aber nun mal zu deren ehernen Arbeitsprinzipien, aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen, um auf diese Weise der dank ihrer Wachsamkeit aufgespürten Feindtätigkeit eine die Grundfesten der Staatsmacht erschütternde Gefährlichkeit zuzuschreiben. (Egon Krenz, ewig grinsendes Politbüromitglied und Sekretär für Sicherheitsfragen, wird in der finalen Phase der DDR mit Unschuldslämmermiene dem verehrten Publikum erklären, dass man - kleiner Irrtum der Greise im Politbüro - leider allzu lange dieser falschen »Sicherheitsdoktrin« aufgesessen sei).
Unsichere Kantonisten wie Maaz und mich zu durchleuchten, entsprach dem Kampfauftrag der Tschekisten. Zwar hätten die Geheimen gegen meine Person einen hinreichenden Tatverdacht juristisch gar
221
nicht begründen können. Beweise hatten sie ja nicht in der Hand. Aber kam es denn darauf an? Wer so denkt, wird den stinkenden Misthaufen, auf dem die Machenschaften der Geheimpolizei wucherten, vermutlich nie richtig riechen.
Entscheidender als jedes strafbare Handeln, dessen ich mich in Bremen vielleicht schuldig gemacht hatte, war in Wirklichkeit eine fundamentale Gesetzwidrigkeit! Nicht der vermeintliche verfassungsfeindliche Zusammenschluss mit Achim Maaz und auch nicht meine staatsfeindliche Hetze stellten für Major König und Hauptmann Bautz, die mir hinterherschnüffelten, das schrecklichste aller Verbrechen, die unverzeihliche Sünde wider den Geist der sozialistischen Menschengemeinschaft, dar. Es war meine Undurchsichtigkeit, die Opazität, die ihnen im Februar '88 aufgefallen ist. Eine kriminelle Eigenschaft, die ich lange Zeit durch das Amt des Parteisekretärs und mein Auftreten in der Öffentlichkeit überspielen konnte. Wie Cincinnatus in Vladimir Nabokovs Roman »Einladung zur Enthauptung« war ich undurchschaubar geworden - »für die Strahlen der anderen und wirkte darum ... wie ein einsames dunkles Hindernis in dieser Welt der füreinander durchsichtigen Seelen«. Damit erfüllte ich, um es mit Nabokov zu sagen, tatbestandsmäßig gesehen den »gnoseologischen Frevel«! Und etwas Teuflischeres kannten Mielkes dienstbare Geister nicht.
(Hartmut Königs viel gedudelte Bekenntnishymne »Sag mir, wo du stehst« lag ganz auf dieser Linie: »Wir haben ein Recht darauf/dich zu erkennen./Auch nickende Masken/nützen uns nicht./Ich will beim richtigen Namen dich nennen/und darum zeig mir dein wahres Gesicht.«)
222
Cottbuser Begegnungen
Zurückgekehrt aus Bremen, fuhr ich kurz darauf nach Cottbus. Vom 26. bis 28. Februar 1988 trafen sich dort Delegierte aller Oppositionsgruppen zur Tagung Frieden konkret. Erika Drees hatte mich gebeten, wenigstens auf einen Sprung vorbeizukommen. Sie wollte mich einigen ihrer Mitstreiter vorstellen und natürlich von mir hören, ob es gelungen sei, in Westdeutschland einen Verlag für mein Buchprojekt zu interessieren. In der Nähe einer Gaststätte am Altmarkt, welche Erika mir genannt hatte, parkte ich meinen Lada. Unübersehbar beehrte man hier die gerade ihr Mittagessen einnehmenden Friedensfreunde mit einer offenen Observation. Vermutlich sollte der Zauber abschreckend wirken. Mir taten die in Kompaniestärke aufgebotenen Einsatzkräfte leid. Am besten hatten es noch die in Hauseingängen postierten Operativniks getroffen. Sie standen wenigstens im Trocknen, pafften ihre Zigaretten und vertraten sich die Füße. Unterdessen stapften Doppelstreifen der Volkspolizei im Schneeregen, die Armen hatten tatsächlich Halbschuhe an, durch knöchelhohen Matsch um den Markt herum. Ein trauriger Gespensterreigen, wie ihn Kafka nicht besser hätte ins Bild setzen können.
Erika wartete schon auf mich. Ich merkte sofort, dass ihr eine Laus über die Leber gelaufen war. Hans-Jochen Tschiche hätte, wie sie mir griesgrämig berichtete, über »ein wunderbares Konsenspapier« mit dem Titel »Teilhabe statt Ausgrenzung - Wege zu einer solidarischen Lebens- und Weltgestaltung« abstimmen lassen und sei damit durchgefallen. Ihre Miene hellte sich erst auf, als ich ihr meine Reiseerlebnisse schilderte. Erika machte mich mit Jutta Seidel, Ulrike und Gerd Poppe bekannt. Ein erinnernswerter Meinungsaustausch zwischen uns fand nicht statt. Es blieb beim Abtasten.
Als ich von dem mir kurz darauf servierten Kotelett aufblickte, sah ich unter den herumwuselnden Fusselbärten plötzlich Wolfgang Schnur, der mich mit dem für ihn charakteristischen unterwürfigen Grinsen grüßte.
223
Dienstlich war mir Schnur ein paar Mal am Bezirksgericht in Frankfurt begegnet. In einem Fall hatte ich neben ihm auf der Verteidigerbank gesessen. Wie er da dem 1a-Vorsitzenden Peter Schmitt mit seinem Gefasel vom humanen Wesen des sozialistischen Strafrechts in den Hintern gekrochen ist, war mir peinlich gewesen. Schnur konnte sich natürlich denken, unter welchem Blickwinkel ich seine Anwesenheit bei einem Treffen oppositioneller Gruppen einschätzte. Sichtlich unangenehm war ihm, dass ich ihm mit der Bemerkung »Ach, Herr Kollege, was machen Sie denn hier?« die Hand hinhielt. Sein gequältes Grienen, die vorstehenden Glubschaugen, das ganze Gesicht, alles wirkte furchtbar verzerrt in diesem Moment. In mir tobte ein Wütender. Meine Verachtung Schnurs so offen zu zeigen, war völlig unnötig, unklug und gemein. Mir gegenüber hatte er schließlich nie den Widerständler gespielt.
Wer nur ein bisschen mit den Gepflogenheiten des Sicherheits- und Justizsystems der DDR vertraut war - leider steckten viele Dissidenten diesbezüglich ihren Kopf in den Sand -, kannte selbstverständlich Wolfgang Schnurs spezifischen Auftrag und wusste, dass der als Kirchenanwalt firmierende Advokat mit der Geheimpolizei wie geschmiert zusammenarbeitete. Darüber sprach man in Anwaltskreisen und an den Gerichten ganz offen. Schnur wurde deshalb von nicht wenigen Kollegen beneidet. Für die Mandate seiner Kanzlei sorgten die Konsistorialen und die ihn empfehlenden Vernehmer in den Haftanstalten. Auf sie konnte er sich verlassen. Und sie sich auf ihn. Und kein Ministerium der Justiz oder Kollegiumsvorstand durfte ihm bei seiner Berufsausübung ins Handwerk pfuschen.
Die Zulassung als Einzelanwalt erfolgte in der DDR, wie jeder wusste, der es wissen wollte, ja nur ausnahmsweise, wenn man Rechtsanwälten heikle Aufgaben übertragen wollte. Professor Friedrich Karl Kaul verteidigte Kommunisten in Westdeutschland, Günter Ullmann gründete Briefkastenfirmen in Luxemburg, Rechtsanwalt Wolfgang Vogel organisierte mit seinem Adlatus Dieter Starkulla den Ost-West-Menschenhandel, und Schnur verteidigte Wehrdienstverweigerer und kirchliche Widerständler.
Der Hintergrund der Einzelzulassungen dieser Kollegen bestand darin, Revisionen der von ihnen geführten Hand-
224
akten - wie sie bei Kollegiumsmitgliedern durch den Vorstand jederzeit möglich waren - grundsätzlich auszuschließen. Auch die Vorstände durften auf keinen Fall Einblick in die zwischen den genannten Anwälten und der Geheimpolizei arbeitsteilig abgewickelten sehr speziellen Aufträge bekommen. Ausnahmsweise kamen über die namentlich genannten Advokaten hinaus manchmal auch Kollegiumsanwälte wie Friedrich Wolff und Gregor Gysi zum Zuge, wenn besondere Umstände es erforderten.
(Obwohl ich Bärbel Bohley bei ihrem Aufenthalt in Hammerfort dies alles erklärt und sie vor Schnur gewarnt hatte, erteilte sie ihm ungeachtet dessen nach ihrer Verhaftung Ende Januar - wie schon 1983 - erneut Vollmacht. Vera Wollenberger und andere ebenfalls. In ihrem Tagebuch begründet Bohley unter dem auf den 5. Februar 1988 datierten Eintrag ihre Anhänglichkeit an Schnur damit, dass der ihr »etwas über die Freunde erzählt, einen Apfel mitbringt und eigentlich ein Seelsorger ist«. Mit ihrem Lobgesang auf »Schnürchens« Qualitäten als Seelsorger hatte sie mich bereits bei ihrem Besuch in Hammerfort genervt.)
Zu Hause erzählte ich, dass ich Wolfgang Schnur begegnet wäre. Dann sei es ja so sicher wie das Amen in der Kirche, meinte Heidi kühl, dass die Firma uns demnächst besuchen würde. Mein Auftauchen in Cottbus würden sie bestimmt aufklären wollen. Routinemäßig spielten wir also mal wieder die denkbaren Schritte der Operativniks durch: Sie konnten mich zwecks Aufklärung eines Sachverhalts einer Vernehmung zuführen, meine Post überprüfen, das Telefon anzapfen oder konspirative Haussuchungen bei uns veranstalten, wenn Heidi und ich zeitaufwendige Termine bei den Gerichten wahrnehmen mussten; das war wohl das, womit wir am ehesten rechnen mussten.
Wir trafen also Vorkehrungen. Klebten bei längerer Abwesenheit ein oder zwei lange Haare Heidis an die untere Leiste und die Schwelle unserer Haustür. Nachdem wir uns etliche Male auf diese Weise abgemüht hatten, ließen wir es wieder sein. Was konnten sie schon finden, wenn sie, mit ihren Kameras und Gummihandschuhen bewaffnet, durch unsere Wohnung pirschten, abgesehen von dem, was sie finden sollten? Da in unseren Schränken kein brenzliges Beweismaterial mehr lag, erschien uns der Aufwand überflüssig (bei den mir durch Akteneinsicht bekannt gewordenen zwei Hausdurchsuchungen verbuchten die Geheimen nur eine bescheidene Ausbeute: Sie kopierten eine bei mir hinterlegte Verteidigervollmacht von Erika Drees und, was ich bis heute nicht zu deuten vermag, einen 60-seitigen maschinengeschriebenen Text der Mystikerin Hildegard von Bingen).
Ohnehin bedurfte es keiner Beweise, wenn sie mir was am Zeug flicken wollten. Man musste die Nerven behalten, sich stoisch mit den Dingen abfinden, die nicht von einem abhingen, am besten sich sogar ganz gleichgültig verhalten, daraufkam es jetzt an! In dieser Haltung bestärkte mich die nicht weit von uns in Grünheide lebende Katja Havemann. Mit ihr hatte ich mich nach Bärbel Bohleys Ausreise angefreundet, so dass noch eine mich stützende Achse Hammerfort - Grünheide entstanden war. »Mit allzu viel Geheimnistuerei«, sagte Katja, »quälst du dich nur selbst.« Aber jenes einzigartige Vergnügen, die Herren von der Sicherheit bei ihren supergeheimen Observationen, wo immer es ging, zu foppen, sollte ich mir keinesfalls entgehen lassen: »Also nicht nur wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen.« Wenn man nicht rund um die Uhr damit beschäftigt sei, die Tschekisten zu hassen, oder anders gesagt, wenn man nicht hauptberuflich den Verfolgten spiele, dürfe man selbst in diesem Rahmen mit manch heiterer Stunde rechnen. Zwei Monate später hatte ich meinen Spaß.
225-226
Freimut Duve gibt sich die Ehre
Die Überwachung prominenter Westler gehörte zum Standardprogramm der geheimen Staatspolizei. Traf sich unsereiner mit jemandem, der diesem Kreis zugerechnet wurde, geriet er automatisch ins Fadenkreuz. Freimut Duve als SPD-Bundestagsabgeordneter und Herausgeber der Reihe »rororo aktuell« stand zweifellos auf der Liste jener, die, wenn sie Leute im Osten besuchten, auf die Wachsamkeit unserer Tschekisten vertrauen durften. Duve wünschte, mich in Ostberlin zu treffen. Ich hielt das für leichtsinnig. Unbedingt meinen Aufsehern auf die Nase zu binden, wen ich mir zum Verleger auserkoren hatte, war aus meiner Sicht kein glücklicher Einfall. Schließlich bedurfte es keines Spürsinns, aus einem Treffen zwischen Duve und mir zu schließen, dass ich ein Manuskript zu ihm nach Hamburg geschafft hatte und - weit unangenehmer - in wessen Besitz sich dieses Manuskript mittlerweile befand. Freimut Duve hatte ja 1975 Wolfgang Harichs »Kommunismus ohne Wachstum« herausgebracht. Und davor waren Havemanns Vorlesungen an der Humboldt-Universität »Dialektik ohne Dogma« in derselben Edition herausgekommen.
Trotz meiner Bauchschmerzen stimmte ich dem von Hans-Karl von Winterfeldt über Erika Drees eingefädelten Treffen am 14. Mai 1988 zu. Demnächst würden Mielkes Mannen sowieso zum Halali blasen! Ob früher oder später, darauf kam es jetzt nicht mehr an. Und Erika wollte Freimut Duve unbedingt kennenlernen. Hören, wie er dem soeben zusammengebrochenen Widerstand in der DDR politische Aufbauhilfe leisten wolle. Ihr Vertrauen in ihn als Sozialdemokraten war rührend. Um 9.15 Uhr holten wir Erika an jenem Sonntag in Schöneweide ab. Vor der Bahnhofshalle stehend, wo Heidi und ich in der prallen Sonne auf sie warteten, fielen mir sofort als die Reisenden in alle Richtungen davonströmten zwei ergraute Subalterne auf, die Aktentaschen trugen und sich einem sonnenbebrillten Jüngling in einem beigefarbenen Blouson zuwandten, welcher mit dem Rücken zu uns mit ihnen verhandelte.
227
Ich ordnete den Blousonträger der Bezirksverwaltung Berlin und die zwei angereisten Aktentaschen der Kreisdienststelle des Ministeriums in Stendal zu. Die ergrauten Taschenträger hatten nun Feierabend. Beschattungen in der Hauptstadt lagen im Zuständigkeitsbereich der Berliner.
Erika schäumte natürlich, als ich ihr mitteilte, was ich beobachtet hatte. Am liebsten wäre sie zu den dreien hingestürmt. Solche Einlagen waren ihre Spezialität. Ihr letzter Krach mit der Polizei lag gerade mal zwei Wochen zurück. Mit Harald Junge, Bernd Böttcher und Christina Schulz hatte sie am 26. April auf dem Stadtseebahnhof in Stendal mit dem Bild eines Atommeilers bedruckte Kärtchen an KKW-Arbeiter verteilt. Unter Hinweis auf die Katastrophe von Tschernobyl forderte sie mit ihrem Fähnlein Unerschrockener einen sofortigen Baustopp des Kernkraftwerks. Uniformierte Einsatzkräfte trugen Erika und ihre Mitstreiter zehn Minuten später vom Tatort weg. Und beförderten sie in Zellen des Kreisamtes. Wie nicht anders zu erwarten, verweigerte Erika jegliche Aussage. Sie abends wieder loszuwerden, war für die Ordnungshüter mindestens so anstrengend wie ihre Zuführung. Dass ausgerechnet sie als Erste freigelassen wurde, ohne ihre Freunde, empfand Erika als nicht hinnehmbare Schmach. Vier Männer schleppten sie vor die Tür des Volkspolizeikreisamtes. Sie versuchte noch, die Tür des Amtes einzutreten, aber irgendwann zog sie ab. Meine jederzeit vor Entschlossenheit strotzende, hochmögend geborene Maria Spes von Winterfeldt (wie sie gar nicht gern genannt wurde) war harthörig sondergleichen - von frühester Kindheit an war sie in einer preußischen Tradition erzogen worden: Schläge hinnehmen, standhaft bleiben! Diese Maxime lag ihr im Blut. Biedere Volkspolizisten waren dagegen machtlos.
An diesem sonnigen Maientag gelang es mir, Erikas hochfahrende Aufsässigkeit zu zügeln. Wenn wir unsere Verabredung mit Freimut Duve einhalten wollten, das konnte ich ihr klarmachen, musste sie ihren Tatendrang in Schach halten. Für Scharmützel mit Staatssicherheitsmännern reichte unsere Zeit nicht. Um 10 Uhr wollten wir uns ja mit Duve treffen. Wir stiegen ins Auto. »Ist doch egal, wer hinter dir her ist«, sagte Heidelore und reichte Erika eine geschälte Apfelsine.
228
»Was heißt das?« Erika wollte sich nicht beruhigen. Als Heidi sagte, sie bekämpfe doch wohl »die Firma« und nicht »diese armen Schweine«, drehte sie sich wortlos um. Wir fuhren die Schnellerstraße entlang, Neue Krugallee, über die Elsenbrücke, Stralauer Allee, Lichtenberger und bogen in die Karl-Marx-Allee ein. Während unserer ganzen Fahrt beobachtete Erika wie ein Schießhund den hinter und um uns herum fließenden Verkehr. Offenbar spürten die Operativniks ihren Kontrollblick. Im Einsatzbericht vermerkt die überwachende Diensteinheit jedenfalls: »Es ist einzuschätzen, dass die Dr. Drees, die hinten im Wagen saß, sich für den nachfolgenden Verkehr interessierte.« Sie fühlten sich ertappt. Als Beobachter beobachtet. In der Karl-Marx-Allee war sich Erika endgültig sicher: Den blauen Lada hinter uns in der Überholspur hatte sie schon in der Stralauer Allee gesichtet.
Mit Freimut Duve hatten wir das Foyer des Hotels Berolina als Treffpunkt verabredet. Halb zehn kamen wir in der Berolinastraße an. In Höhe der Hausnummer 3 parkte ich. Schlenderte zum Hotel, ohne jede Hast, wie ein Passant, der keine Geheimnisse zu verbergen hat. So weit ich sehen konnte, stand nirgendwo ein blauer Lada. Im Eingangsbereich des Hotels stürmten mir zwei Wachleute entgegen. Sie bauten sich wichtigtuerisch vor mir auf und verlangten, dass ich ihnen meine »Delegiertenkarte« zeige. Wie sie mir erklärten, sei der Hotelkomplex an diesem Wochenende gesperrt, da hier der alljährliche DSF-Kongress stattfinde. Jeder, der Zutritt verlange, müsse seine Delegiertenkarte vorzeigen. Ich schaute mich um. Ein Mann, den ich für Freimut Duve hätte halten können, war nirgendwo zu sehen. Auf der Suche nach ihm machte ich einen Erkundungsgang um den Hotelkomplex. Dabei sah ich auch den blauen Lada wieder - neben einer Telefonzelle stehend. Unziemliche Reaktionen verkniff ich mir. Nichtssagend schaute ich vor mich hin. Lief an ihrem Wagen vorbei, zählte bis 100 und drehte mich ruckartig um. Niemand folgte mir. Allmählich verlor ich die Geduld. Verfluchte Erika, die mich zu diesem Rendezvous überredet hatte. Die Straßen waren leergefegt. Wir standen eine Weile neben meinem Lada und starrten auf den Eingangsbereich des Berolina.
229
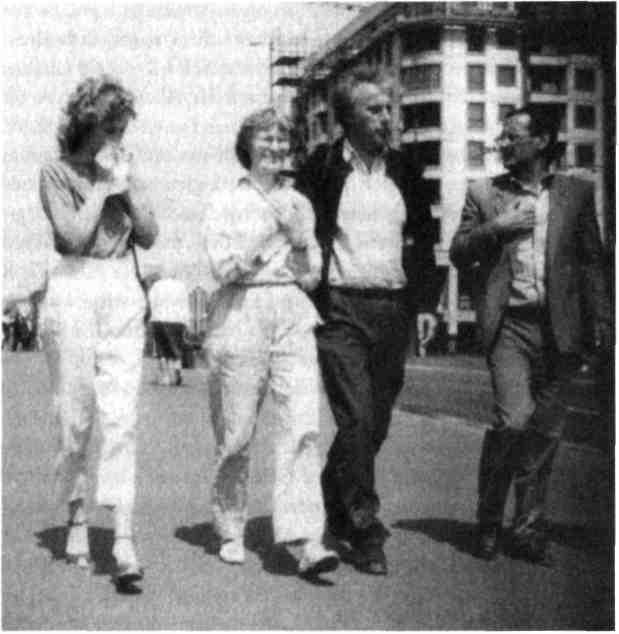
Heidelore Henrich, Erika Drees, Freimut Duve, Rolf Henrich im Mai 1988 (Observationsfoto der Stasi)
Nachdem wir etwa 20 Minuten gewartet hatten, kam ein stattlicher Mann auf uns zu. Hohe Stirn, Geheimratsecken, flusige Haare. Meine Vermutung, es handele sich um Freimut Duve, erwies sich als richtig. Mit ihm auf dem Beifahrersitz, Erika und Heidi saßen hinten, fuhr ich - so schnell es ging - auf die Karl-Marx-Allee. Schlug in Höhe Kaffee Moskau verkehrswidrig einen Haken, kreuzte die Sperrlinie, um meine vermuteten Verfolger abzuschütteln. Raste in Richtung Lichtenberger. Bog ab in die Holzmarktstraße. Weiter in Richtung Brückenstraße, Rungestraße. 10.33 Uhr erreichten wir den Köllnischen Park. »Die Drees und ihre 3 Begleiter nahmen auf hier befindlichen Campingstühlen Platz und unterhielten sich angeregt«, vermerkt dazu der Observationsbericht. Man konnte sie im Katz- und Mausspiel herausfordern, einfach abschütteln konnte man sie nicht.
230
Weshalb Duve mich sprechen wollte? Er sorgte sich, ob ich mir über die Konsequenzen einer Veröffentlichung des »Vormundschaftlichen Staates« im Klaren wäre. Genossen, die offen die Arbeiter-und-Bauern-Macht attackieren, entgegnete ich ihm, hätten noch nie ein leichtes Los gehabt. Und da ich nun mal auf etlichen Seiten auch Mielkes Verein auf die Hörner genommen hätte, müsse ich wohl mit einer gepfefferten Antwort rechnen. Duve fragte mich noch nach meinem früheren Leben und wie lange ich an dem Manuskript geschrieben hätte. Im Ermelerhaus, wo wir zu Mittag aßen, klagte er eine Stunde später noch einmal, mit kummervollem Blick auf Heidi: Ja, aber Sie haben doch Familie. Wieder sagte er das in einem Ton, als ob mir etwas nicht Bekanntes, Gefährliches bevorstehe, von dem er besser Bescheid wisse als ich. Ich bemühte mich geduldig, ihn davon zu überzeugen, wie wichtig es sei, den »Vormundschaftlichen Staat« rasch herauszubringen. Nach den Ereignissen im Umfeld der Luxemburg-Demonstration und den Abschiebungen dürfe es bis zum nächsten Eklat keine allzu lange Pause geben, erklärte ich ihm. Wir wollen die Sache mal nicht überstürzen, beschwichtigte Duve mich. Eilig hatte er es nicht.
Am späten Nachmittag begleiteten wir Freimut Duve zum Grenzübergang Friedrichstraße. Bevor wir uns verabschiedeten, schossen die Geheimen noch ein schönes Gruppenfoto von uns. Und sie notierten enttäuscht in ihrem Ermittlungsbericht: »Materialübergaben entsprechend der Ziel- und Aufgabenstellung konnten nicht festgestellt werden - lediglich die von Dr. Drees aus ihrem Aktenkoffer entnommenen, mit Zeitungsartikeln bedeckten DIN A4-Seiten, wurden durch den Fahrer des PKW und die weibliche Person in Augenschein genommen.« Viel war es nicht, was sie ausspioniert haben. Detailversessen vermerkten die Tschekisten zwar noch, dass meine »Ohrläppchen freihängend« seien und ich »stark gebräunt« war. Heidi erschien ihnen »dezent geschminkt« und zeichnete sich durch »bogenförmige, durch Rasur geformte Augenbrauen« aus. Angeblich trug sie einen »hell-beigen Rock« - was ausweislich des Fotos Quatsch ist, denn auf dem hat sie erkennbar eine knöchellange Hose an.
Nach Kenntnis der Akten muss ich sagen, die von mir ob ihrer Kriminalistik so hoch geschätzten Ermittler waren gar nicht so perfekt, wie ich immer gedacht habe. Jedenfalls kombinierten sie nicht, worum es bei unserem Treffen eigentlich ging. Freimut Duve und meine Person, Heidi sowieso, wir waren, völlig im Gegensatz zu meinem subjektiven Erleben, offenbar überhaupt nicht relevant für sie. Wir stellten lediglich eine Art Beifang der ganz auf Erika ausgerichteten Observation dar, mehr nicht. Rückblickend muss ich sagen, die Tschekisten gaben sich, seit ich selber aus meiner Deckung herausgetreten bin, zwar Mühe, mir auf die Schliche zu kommen. Vermutlich hätten sie aber noch das ganze Jahr 1988 im Dunkeln herumgestochert, wenn nicht Erika Drees im Sommer anlässlich eines Treffens der Initiative Frieden und Menschenrechte im Keller der Umweltbibliothek Berlin verkündet hätte, dass das Manuskript eines Anwalts mit dem Titel »Der vormundschaftliche Staat« bereits »in die BRD verbracht« worden sei. Und selbst diese Information konnten sie immer noch nicht mir zuordnen.
231-232
Im Wartesaal der Geschichte
Das Warten auf ein baldiges Erscheinen des »Vormundschaftlichen Staates« belastete mich das ganze Jahr 1988 viel mehr als die in meiner Anwaltstätigkeit zu bewältigenden Streitigkeiten. Aber ein Zurück gab es nicht mehr. Pflichtschuldigst nahm ich die für mich anberaumten Gerichtstermine wahr und baute meine Kontakte zu Gleichgesinnten aus, ohne allzu große Vorsicht walten zu lassen. Mit Ludwig Drees fuhr ich zum Sommerseminar der Solidarischen Kirche nach Samswegen, wo ich in Jochen Tschiches Pfarrhaus über Herrschaftsstrukturen in der DDR referierte. Ludwig beleuchtete aus psychoanalytischer Sicht die Dynamik der Beziehungen in den Untergrundgruppen. Das Interesse der angereisten oppositionellen Hoffnungsträger an unseren Ausführungen war eher gering.
Das Erscheinungsbild der in Samswegen Versammelten irritierte mich. Ob Friedhofsgärtner, Telegrammbote oder Hausmeister einer Kirchengemeinde, sie alle hielten sich für Persönlichkeiten der Geschichte, weil ihre Namen manchmal in der Westpresse erwähnt wurden. Sie sahen sich in einer reinen, von Fehlschritten noch nicht verunstalteten demokratischen Bewegung, gewissermaßen am unbefleckten Ursprung eines demokratischen Seins. Ludwigs und meine Analysen des eher kümmerlichen Ist-Zustandes der Opposition waren nicht erwünscht. Tag und Nacht fühlten sich alle von den Tschekisten auf Trab gehalten, sie merkten aber nicht, dass, vom feindlichen Außen her betrachtet, in ihren subversiven Zusammenhängen nicht das Geringste voranging und die militanten Energien in den Kreisläufen symbolischer Praktiken völlig aufgezehrt wurden. »Es würde euch so, ohne die Staatssicherheit, gar nicht geben«, behauptete Ludwig provokativ.
Damals waren allerdings die schon schwelenden Widersprüche innerhalb der Szene kaum sichtbar. Ibrahim Böhme, der ein Jahr später die SDP gründete, bevor er schließlich als Stasiagent enttarnt wurde, schöpfte wie ein guter Pater familias jovial aus einem Eimer Bier für die sich um ihn herum drängelnden Seminaristen.
233
Als wir nach unserer vorzeitigen Abreise aus Samswegen Erika berichteten, was wir dort alles erlebt hatten, schlug Erika mir vor, für mich in ihrer Wohnung eine Lesung zu veranstalten. Was sie auch tat. Bei dieser Lesung lernte ich ihre Stendaler Mitstreiter und auch Jochen Tschiche kennen. Im Herbst war dann die inzwischen heimgekehrte Bärbel Bohley wieder bei mir in Hammerfort zu Gast. Mit ihr kamen das Ehepaar Poppe und »Henne« Weißhuhn, um mit mir und Rechtsanwalt Zarneckow zu beratschlagen, wie man die in der Presse soeben veröffentlichten verwaltungsrechtlichen Reformansätze im Interesse der Opposition zukünftig nutzen könne.
Die Zeit wurde zunehmend geschwätziger. Selbst manche Richter und Staatsanwälte sagten inzwischen mit einem um die Mundwinkel spielenden Lächeln, dass es wie gewohnt wohl nicht mehr weitergehen könne. Wie Käfer ihre Fühler ausstrecken und sich gegenseitig abtasten, so klopften die Kollegen vorsorglich ihr Umfeld ab und fragten sich, wem sie vertrauen durften. Wenn ich nicht zu spät kommen wollte mit meinem Buchprojekt, musste bald etwas geschehen. Warum Duve mit der Herausgabe des »Vormundschaftlichen Staates« zögerte, war mir unerklärlich. Vielleicht gab es Probleme innerhalb des Rowohlt-Verlages. Bei Katja Havemann heulte ich mich Ende November über die nervende Warterei aus. Und sie wusste auch gleich, was man dagegen tun konnte. Sie lud Ulrich Schwarz, den akkreditierten »Spiegel«-Korrespondenten, zu einem gemeinsamen Abendessen ein.
Am zweiten Samstag im Dezember fuhr ich also nach Grünheide zu dem von ihr arrangierten gemütlichen Beisammensein. Katja hatte Adventskerzen angezündet. Das Leninporträt, welches bei ihr im Wohnzimmer aus Pietät gegenüber dem verstorbenen Nestor des Widerstands immer noch an der Wand hing, wirkte im Schein der Kerzen wie eine russische Ikone. Das Gespräch mit Ulrich Schwarz drehte sich um die Frage, ob die SED die zugespitzte Lage überhaupt noch unter Kontrolle hätte, oder ob nicht in breiten Schichten der Bevölkerung längst ein Widerwille rumorte und immer lebendiger werde, welcher zur Lösung der angestauten Probleme nach einer tiefgreifenden Umwälzung aller politischen Verhältnisse verlangte. »Von was für einem Widerstand redet ihr überhaupt? Euch bescheinigt doch jeder, dass ihr die Dummen seid.«
234
Schwarz äußerte unverhohlen seine Skepsis gegenüber der außerparteilichen Opposition, die er für schwach und überfordert hielt -»hin- und herschwankend zwischen Panik, Hysterie und Illusionen, je nachdem, welche Nachrichten gerade über die westlichen Sender gehen«. Katja wollte das nicht so stehen lassen. »Das kann sich ja ändern«, hielt sie Schwarz entgegen. Ich selbst war bei unserem Gespräch nicht ganz bei der Sache. Leicht verkrampft wartete ich nur darauf, wann ich meinen Ärger über Freimut Duves Hinhaltetaktik loswerden konnte. Als ich darauf zu sprechen kam, wusste Schwarz sofort einen Ausweg. Er werde, sicherte er mir zu, bei seiner nächsten Fahrt nach Hamburg Michael Naumann, den Verlagsleiter von Rowohlt, ansprechen und nachfragen, was der Grund für den von mir beklagten Zeitverzug sei.
Ulrich Schwarz hielt Wort. Zwei Wochen später teilte er mit, dass mein Buch im Frühjahr 1989 erscheinen würde. Ein paar Dinge gab es aber noch zu regeln. Heidelore ließ sich unsere gesamten Ersparnisse auszahlen. Wir brachten das Geld nach Güstrow zu unserer Freundin Sabine Schumann. Sie nahm die gebündelten Scheine entgegen und versteckte sie mit der Bemerkung »ein gutes Versteck wird mir noch einfallen« in ihrem Wäscheschrank zwischen Bettlaken und Kopfkissenbezügen. Auf dem Heimweg überlegten Heidi und ich, wie wir Falk aus den bevorstehenden Turbulenzen heraushalten könnten. Um Falks Zukunft ängstigten wir uns am meisten. Meine Idee, ab sofort in der Öffentlichkeit gesprächsweise durchblicken zu lassen, dass wir uns scheiden lassen wollten, gefiel Heidelore überhaupt nicht. »Da stehe ich da, als würde ich dich im Stich lassen«, hielt sie mir entgegen. Sicher, die Gefahr bestand durchaus, dass sie ausgerechnet bei Menschen an Achtung verlieren würde, mit deren Solidarität wir rechneten. Aber der denkbare Nutzen für sie und Falk, welcher mit einem von der Stasi registrierten Scheidungsgerücht verbunden wäre, rechtfertigte ein solches Vorgehen. Ob die Tschekisten auf die gelegte falsche Spur hereingefallen sind, mag dahingestellt bleiben. Unterm Strich wusste man ja nie genau, wodurch sie sich in ihrem Tun haben leiten lassen.
Was meinen bevorstehenden Zusammenstoß mit der Partei- und Staatsmacht betraf, wollten auch Katja und Bärbel Vorsorgen. Mit Ulrike Poppe und einem Kameramann kamen sie am zweiten Sonntag im März 1989 zu mir nach Hammerfort.
235
Ihr Plan war, für die im Osten beliebte Sendung des Westfernsehens Kennzeichen D einen Beitrag zu drehen, der mich bekannt machen sollte. Während der Kameramann unser Wohnzimmer in ein provisorisches Fernsehstudio umbaute, spazierten Bärbel und Ulrike mit mir auf dem Dammweg des Oder-Spree-Kanals in Richtung Groß Lindow. Vergegenwärtige ich mir heute noch einmal meine Gedanken und Gefühle, die mich bei diesem Spaziergang bewegten, bin ich sonderbar berührt von der Zwiespältigkeit meiner damaligen Lage; die Frauen sahen mich offensichtlich schon hinter Gittern. Ich wollte Bärbel und Ulrike gegenüber natürlich nicht naiv erscheinen. Selber kalkulierte ich ja diese Möglichkeit durchaus ein. Dennoch blieb ich optimistisch!
Meine Kurzfassung der politischen Lage beschrieb ich in dem Film, unter Bezugnahme auf die uns auferlegte beschränkte Bewegungsfreiheit als Wohnhaft in der DDR. Das hat manchem DDR-Gläubigen nicht gefallen. Es traf aber den Nerv der Zeit. Wie sehr ich den einfachen Leuten damit aus dem Herzen gesprochen habe, zeigte sich mir gleich nachdem unser Beitrag im ZDF ausgestrahlt worden war. Am darauffolgenden Tag fuhr ich in Wiesenau an der Minol-Tankstelle vor. Als ich aus meinem Wagen stieg, stürzten beide Kassiererinnen auf mich zu, hüpften um mich herum und juchzten immer wieder »Wohnhaft«, »Wohnhaft«, »Wohnhaft«. Sie wollten mich nicht bezahlen lassen. »Dafür darf ich Sie drücken«, gluckste die korpulente Chefin und presste mich, ohne meine Einwilligung abzuwarten, an ihren Busen.
(Zahlreiche Beschäftigte aus volkseigenen Betrieben, die von ihren Kollegen über unseren Fernsehspot informiert worden waren, verließen am nächsten Tag spontan ihre Arbeitsplätze, um sich die Wiederholung anzusehen. Die Partei reagierte wie üblich. Hastig wurden zur ideologischen Gefahrenabwehr die Sekretäre der SED-Grundorganisationen einbestellt. Aus Berlin herbeigeeilte Propagandisten rüsteten die Genossen »argumentativ« auf, um die in ihren Betrieben entbrannten Diskussionen zu zügeln. Aber selbst in diesen Schulungen gab es, wie mir mehrere Teilnehmer versicherten, nicht wenige Genossen, die den ihnen aufgetischten Sermon »über den Verräter Henrich« nicht widerspruchslos hinnehmen wollten und sich mit mir solidarisierten.)
236
»Zwei Jahre Knast halte ich aus«
Ulrich Schwarz wollte noch eine Rezension des »Vormundschaftlichen Staates« für den »Spiegel« schreiben. In der Osterausgabe sollten ausgewählte Passagen des Buchs abgedruckt werden. Um uns darüber zu besprechen, trafen wir uns am 19. März im Haus Wolfgang Strübings in Köpenick. Hier überlegten Schwarz und ich, wie man unseren Häuptlingen klarmachen könnte, dass es mit mir keine schnelle oder gar einverständliche Abschiebung nach Westdeutschland geben würde, wie sie im Jahr zuvor nach der Luxemburg-Demonstration praktiziert worden war. Die einzige Möglichkeit wäre die, meinte Schwarz, in seinem Spiegel-Artikel direkt darauf hinzuweisen, dass ich finster entschlossen sei, eine längere Haftstrafe in Kauf zu nehmen.
Er hat diese Botschaft in seiner Kommentierung meines Buches unmissverständlich publik gemacht. Unter ein Foto von mir setzte er das prollige Zitat: »Zwei Jahre Knast halte ich aus«. Und er erinnerte unsere Politbürokraten daran, dass sie sich die »Methode Bahro« - nach der letzten KSZE-Folgekonferenz - kaum noch einmal leisten könnten, wenn sie nicht den letzten Rest ihrer Reputation auf dem internationalen Parkett verspielen wollten. »Doch ebenso«, schrieb er, »verbietet es sich für die SED-Führung, den Bahro-Nachfolger einfach zu ignorieren. Denn das, was Henrich zum Zustand von Partei und Staat zu Protokoll gegeben hat, ist unter den SED-Mitgliedern durchaus virulent.«
Katja Havemann übermittelte mir noch den Wunsch des ZDF, welches für die Umrahmung unseres in Hammerfort produzierten Fernsehbeitrags ein paar Außenaufnahmen haben wollte. Entsprechend der Regieanweisung »Der Systemkritiker im Alltag« stolzierte ich also grimmig guckend und Entschlossenheit ausstrahlend am Gründonnerstag vor einer Kamera die menschenleere Genovevastraße in Köpenick einmal rauf und runter. Das Ganze dauerte keine fünf Minuten. Als ich danach gut gelaunt zu meinem auf der Mahlsdorfer Straße geparkten Auto schlenderte, fiel mir auf, dass mehrere Streifenwagen der Volkspolizei hier durch die Gegend kurvten. Die Suche nach mir hatte begonnen! Auch wenn das Buch noch nicht erschienen war und der Rummel erst mit dem »Spiegel«-Vorabdruck am Samstag losgehen sollte, gefolgt von Kennzeichen D am Mittwoch, konnten all meine Aktivitäten ja unmöglich unbemerkt geblieben sein - und nun hatte sich die Staatsmacht zum Zugriff entschlossen! Ein grün-weiß lackierter VP-Wartburg hielt auf meiner Höhe an. »Personenkontrolle! Ihren Personalausweis!« Der Polizist nahm Haltung an, als er meinen Namen im Personalausweis laut vor sich hin sprach und noch einmal fragte, ob ich »der Rolf Henrich« sei. »Ja, wer denn sonst?«, erwiderte ich, leicht verunsichert durch das Schmunzeln des vor mir stehenden Ordnungshüters. »Man wird ja wohl noch fragen dürfen, oder?« Es war zum Piepen. Mir fiel angesichts von so viel Freundlichkeit fast die Kinnlade herunter.
Auf der Rückfahrt nach Eisenhüttenstadt grübelte ich vergeblich, was diese Personenkontrolle zu bedeuten hatte. Ich konnte lediglich eins daraus ableiten: Einen Haftbefehl gab es augenscheinlich nicht. Die Pointe dieses Gründonnerstags verstand ich erst nach der Öffnung der Archive. Die Zollverwaltung in Berlin hatte an diesem Tag bei einem West-Ost-Reisenden in den frühen Morgenstunden ein Rezensions-Exemplar des »Vormundschaftlichen Staates« beschlagnahmt und daraufhin die Staatssicherheit alarmiert. Erst dieser Zufallsfund versetzte unsere allwissenden Wächter in die Lage, das Corpus Delicti endlich selbst in Augenschein zu nehmen. Da hatte ich ihnen mehr zugetraut.
237-238
#