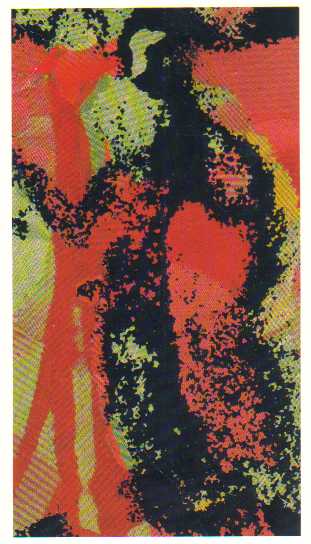
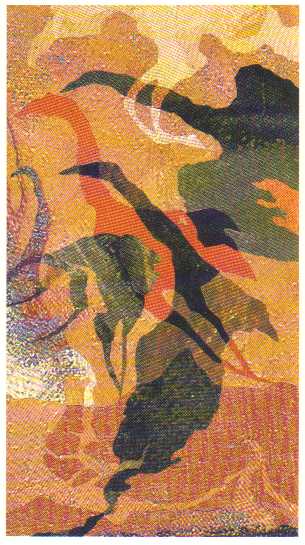 Flucht
FluchtHildesheimer-1991 Start Weiter
Liebe
Schülerinnen und Schüler,
meine Damen und Herren,
9-23
zunächst möchte ich mich bei der Jury, bei den Stiftern und Spendern sehr herzlich für den Preis bedanken. Er ist nicht mein erster, dafür aber wahrscheinlich mein letzter Literaturpreis. Und diesen letzten Preis von Jugendlichen zugesprochen zu bekommen ist für einen bald Fünfundsiebzigjährigen eine Ehre, um die ihn wohl viele beneiden würden, wenn sie damit nicht auch die fünfundsiebzig Jahre in Kauf nehmen müßten.
Die vorige und erste Preisträgerin war Ilse Aichinger. Ihre Rede war eindringlich, inspiriert und voller Elan, sie war einer großen Schriftstellerin würdig. Als Ausgangspunkt diente ihr ein Spruch, den sie irgendwo auf einer Mauer vorgefunden hatte. Er lautete: <Haltet die Welt an, ich will aussteigen!> So unverbindlich - weil ungefährlich und anonym - es auch sein mag, einen solchen Satz unbeobachtet irgendwo hinzuschreiben — im Gegensatz zu Ilse habe ich Sympathie für einen solchen Geheimschreiber.
Nur wäre ich - gesetzt den Fall, daß ich diese Art symbolischer Subversion pflegen würde - an seiner Stelle weitergegangen und hätte eine Aufforderung an alle, die mit dieser Welt nicht mehr zufrieden sind, miteinbezogen, es mir gleichzutun, um anderswo, auf einem wohnlichen Planeten unserer Wahl, eine neue Gesellschaft zu gründen, deren moralische Gesetze vielleicht von den unseren noch nicht einmal so verschieden sind, deren Einhaltung aber alle Mit-Umsteiger garantieren müßten.
Natürlich wäre der Wortlaut eines solchen Konzeptes schwerlich an einer Mauer unterzubringen. Zudem wäre - das sei zugegeben - die Aufforderung vage, unreflektiert und defätistisch. Daher würde ich sie wohl doch dahingehend einschränken, daß wir auf unserer Erde bleiben und versuchen, sie grundlegend zu verändern.
Nur steht da - an Bedrohlichkeit zunehmend - die Frage vor uns, ob es dazu nicht schon zu spät ist, angesichts der irreversiblen Schäden, die wir ihr zugefügt haben. Wir können den Schwund der Bewohnbarkeit unserer Erde nicht verhindern, er muß wohl in das Programm der Natur - oder, wenn man so will, in Gottes Programm - eingeplant sein.
10/11
Das Gesetz von Werden und Vergehen — dem übrigens alle Künste die wesentlichen Impulse verdanken, dem schließlich alle irdischen Dinge unterliegen —, wie könnte es sein, daß es für die Erde selbst nicht gelte! Vielleicht weil in diesem Fall das Vergehen der Schuld des Gewordenen entspringt?
Ich meine: wir sind dermaßen mit dem Werden präokkupiert, daß wir nicht merken, wie gewaltsam und tödlich das Vergehen sich vollzieht. Wir können demnach unseren Untergang nicht verhindern. Wohl aber können wir ihn vielleicht um Wesentliches hinausschieben. Dies allerdings nicht, ohne radikal umzudenken.
Ich benutze das Wort »umdenken« nicht gern, weil sich immer noch so wenige etwas darunter vorstellen können, obgleich es zum Gemeinplatz geworden ist. Wir kommen aber ohne es nicht mehr aus, und schon gar nicht, ohne die Konsequenzen daraus zu ziehen.
Ich gelte als Pessimist. Dieser Begriff wird unterschiedlich definiert. Er wird meist mißdeutet oder verkannt, daher auch verhöhnt.
Den ehrlichen Pessimisten kann wohl nichts mehr erfreuen, als daß er unrecht hat und durch ein entstehendes oder entstandenes Ereignis widerlegt wird. Denn mit Worten gibt er sich nicht zufrieden, er mißtraut ihrem objektiven Wert. Sein Pessimismus ist empirisch, er ist nicht etwa das Resultat einer morosen Veranlagung oder eines physischen oder vegetativen Defektes. Vielmehr entspringt er der geistigen Verarbeitung kollektiver, objektiver oder intersubjektiver Erfahrung. Er registriert jede Stufe der Veränderung im Weltgeschehen, jede Anomalie und jeden Mißbrauch veränderter Gegebenheiten, wobei er sich des Satzes »Ich hab's ja gleich gesagt« tunlichst enthält.
Es ist unrichtig zu behaupten, daß der Pessimist das Positive nicht sehe. Er sieht es, genießt es vielleicht noch mehr als der Optimist, der an die Permanenz des Schönen und des Sublimen glaubt. Freilich: er kommentiert es meist nicht, denn das gleichbleibend Positive überläßt er dem Kommentar der anderen. Darin liegt vielleicht der Fehler, der ihn unbeliebt macht.
11-12
Notwendigerweise hängt die Qualität seiner Interpretationen von der Qualität seiner Wahrnehmungsgabe und der Überzeugungskraft seiner Mitteilung ab. Er verlangt das Umdenken als einziges Mittel zum Überleben und zur Weitergabe des Lebens. Er widerlegt den frivolen und hartnäckig aufrechterhaltenen Gemeinplatz, daß es fünf vor zwölf sei, mit dem anscheinend immer wieder notwendigen Hinweis darauf, daß der Sekunden- oder Minutenzeiger nicht stillsteht. Die Zeit zu einer Umkehr oder zur Umwertung der grundlegenden Werte unserer Existenz sei so gut wie verstrichen, zwölf sei lang vorbei. Dennoch sei Morgengrauen nicht in Sicht, und erst recht kein Silberstreif am Horizont.
Nun muß man freilich zum Umdenken denken können, und das ist leider nicht jedermanns Sache. Mit »denken« meine ich nicht »an etwas denken« oder »über etwas nachdenken« oder »etwas bedenken«, sondern ich verstehe es als fortwährendes kontrapunktisches Selbstgespräch, als aktiven Vollzug, eine essentielle Stimme in der Partitur unseres Lebens, daher unaufhörliche Kontrolle all unseres Tuns und Lassens. Denken und Fühlen sollten in uns untrennbar durch einander bedingt sein.
Die Frage »Warum tue ich das, was ich tue?« begleite uns immer. Und das Generalthema dieses Denkens in unserer Gegenwart ist die fortschreitende, ins Unüberblickbare sich steigernde Zerstörung der Erde, deren Zeugen wir sind und deren Urheber wir nicht sein wollen.
Bezeichnend für die Problematik, für den Zwiespalt im menschlichen Bewußtsein und für die Begrenztheit unserer Aufnahmebereitschaft ist, daß das Zuendedenken vieler unserer die Zukunft betreffender Gedanken auf ein Tabu stößt. Daß an einem bestimmten Punkt der Vorhang fallt, die Konvention einsetzt und uns zwingt, die angefangene Reihe der Folgerungen abzubrechen und den Rest des vorgenommenen Denkmaterials ungedacht zu lassen.
13-14
Das Hindernis beginnt bei der Verdrängung des Gedankens an die sich grenzenlos potenzierende Übervölkerung der Erde. Sie ist unser fundamentales Problem, von dem alle anderen Probleme ausgehen. Darüber zu sprechen wäre Sache eines Statistikers, der die beängstigenden Zahlen authentisch wiedergeben könnte. Dennoch möchte ich zu bedenken geben, daß die Zahlen bisher noch bei jeder nationalen Zählung über die Prognosen der Experten hinausgegangen sind. Vor drei Jahren ergab die Volkszählung in China zehneinhalb Millionen Einwohner mehr als vorhergesagt.
Doch zurück zu diesem eigentümlichen und doch so verständlichen Tabu. Ich habe übrigens kein deutsches Wort für »Tabu« gefunden. Es ist das, wovon man nicht spricht. Nun ließe sich argumentieren, daß es für das, wovon man nicht spricht, auch kein Wort zu geben braucht. Aber das wäre ein allzu sprachfeindlicher und resignativer Standpunkt.
Zum Tabu: Wir alle hegen - wahrscheinlich aus Gewohnheit, aber ebenso gewiß auch vom Willen zur Verdrängung bewegt - eine Zuversicht in die Zukunft, die unserem wahren Zustand nicht entspricht. Die meisten von uns zum Beispiel betrachten das sogenannte Wirtschaftswachstum — übrigens kein adäquates Wort, da es organische Evolution vortäuscht —, das Wirtschaftswachstum also, das pro Jahr, unbeirrt zukunftsträchtig, steigt, als eine unbezweifelbare Errungenschaft.
Wir müssen uns aber darüber im klaren sein, daß es sich hier nicht nur um eine Hochrechnung von Leistung und Gewinn handelt, sondern auch um konkret Expandierendes. Daß all dieses Wachstum zu Material wird und sichtbar, spürbar, riechbar sich vergrößert. Und zwar nicht nur nach oben, sondern auch, auf meist unberechenbare und unheimliche Weise, nach unten in die Erde, wo es sich der sogenannten »Entsorgung« — ebenfalls ein Unwort — entzieht. Es breitet sich in die Fläche aus, wo es, zunehmend, Natur verdrängt, auf die wir aber immer mehr angewiesen sind.
15-16
Ich kann Ihnen nicht angeben, wie viele Quadratmeter Natur auf der Erde pro Minute verlorengehen, denn auch diese Zahl potenziert sich ständig. Ein Schweizer Bundesrat hat 1988 festgestellt, daß, wenn das Ausmaß der Bautätigkeit im Kanton Zürich konstant bleibt, der gesamte Kanton bis zum Jahr 2020 zubetoniert sein wird. Das Ausmaß bleibt aber nicht konstant, es hat inzwischen zugenommen.
Ich weiß aus Erfahrung, daß die Jugend sich dieser aus dem »Wachstum« entstehenden Probleme weitaus mehr bewußt ist und sie kritischer betrachtet als Erwachsene oder gar Über-Erwachsene wie ich, da sie mit dem Entstehen der Fehlentwicklung und der daraus resultierenden anwachsenden ökologischen Notlage groß geworden ist und diese sich tiefer in ihr Weltbild eingeprägt hat.
Ich versuche, das Wort »Umwelt« zu vermeiden. Nicht nur wird es zum Gemeinplatz, auf dem sich, zunehmend, auch die Alibi-Sucher tummeln, sondern der Begriff ist auch zu schwach. Er klingt, als handle es sich um den wohlbestellten Garten, der unsere menschliche Behausung umgibt. Natürlich ist das Wort nicht mehr zu umgehen, aber es bleibt ein Euphemismus und eine Verharmlosung.
Denn es handelt sich ja nicht nur um die Umwelt des Menschen, sondern um die Erde schlechthin, die Länder, die Meere, und damit - wahrhaftig nicht zuletzt - um das Reich der Tiere, Gottes andere und schon seit Ende der Sintflut benachteiligten Geschöpfe; um den machtlosen Partner des Menschen, um den es von Stunde zu Stunde schlechter bestellt ist und der, wie ich fürchte, in der Nachwelt zur Legende wird — sofern es eine Nachwelt gibt, die Legendenbildung gestattet.
Ich brauche nicht auf die verschiedenen Methoden der Ausrottung von Tieren einzugehen. Wöchentlich lesen wir über Spezies, die, wenn auch nicht durch unsere Schuld, so doch mit Hilfe unserer Gleichgültigkeit aussterben oder schon ausgestorben sind. Wie viele von uns sind sich im klaren darüber, daß eine Welt ohne Tiere auch für uns unbewohnbar wird! Wir würden ihr Aussterben nur um wenige Generationen überleben.
17-18
Natürlich gibt es Organisationen wie »Greenpeace«, die sich der Rettung der Tiere annehmen, und zwar meist in gefährlichen Einzelaktionen, die freilich oft nur von symbolischem Wert sind, da der Trend sich nicht in dieser Richtung entwickelt.
Fatalismus und Gleichgültigkeit herrschen vor. Und so erstirbt das animalische Leben auf der Erde, in den Bergen, den Wäldern, Steppen und Gewässern, ohne daß wir eine durch überzeugende Fakten begründete Hoffnung hegen könnten, daß unser Planet sich regeneriere und neues Tierleben hervorbringe.
Liebe Schüler und Schülerinnen, meine Damen und Herren:
All dies haben Sie schon mehrfach gehört oder gelesen oder sogar schon selbst formuliert. Vielleicht sind viele von Ihnen der Aufforderung, Tieren zum Überleben zu helfen, schon längst gefolgt und praktizieren ihre Hilfe mit Selbstverständlichkeit. Ich wollte dieses Thema auch nicht strapazieren, sondern einen Appell an jene richten, die mir potentiell beipflichten, sich aber die Situation noch nicht so weit ins Bewußtsein gerufen haben, daß sie aktiv geworden wären.
19
Tierliebe manifestiert sich nicht darin, daß man einen Hund hält. Sie ist vielmehr ein fundamentales, im Herzen verankertes Gefühl der Zusammengehörigkeit und des Mitleids, ja, der Verwandtschaft aller Lebewesen, die sich in die Schöpfung gerecht und ihrer Art gemäß teilen sollen. Sie ist überdies das notwendige Verlangen, die Grundgesetze der Liebe und der Toleranz durchzusetzen.
Und hier fällt eine Schuld auf die Intellektuellen, die Schriftsteller zumal. Sie sind mit überwältigender Mehrheit tierfremd. Es fehlt ihnen damit eine wesentliche Dimension in der Wahrnehmung irdischer Phänomene und somit natürlich auch der Wunsch, sie in ihr eigenes Leben zu integrieren. Die letzten Tierliebhaber unter den Schriftstellern waren Wolf Schnurre und Günter Eich.
detopia wikipedia Wolfdietrich_Schnurre (1920-1989) wikipedia Günter_Eich (1907-1972)
Schriftsteller und Geisteswissenschaftler sind ihrer Veranlagung nach homozentrisch, denn die Menschen und ihre Beziehung zueinander sind nicht nur ihr Material, sondern auch ihr Thema. Da die Menschheit sich heute in einem Zustand befindet, der ihr zunehmend gebietet, nicht nur auf die Stimme der Natur zu hören, sondern auch ihren dringenden Anforderungen gerecht zu werden, entsteht für den Schriftsteller eine neue Lage:
Das zwischenmenschliche Aktionsfeld und damit der Ort, an dem die Fabel sich vollzieht, verblaßt angesichts der drohenden Allgegenwärtigkeit geschändeter Natur in all ihren Erscheinungsformen. Bald wird der Mensch ihr nicht mehr gewachsen sein. Er wird hilflos wie die Tiere, doch im Gegensatz zu ihnen wird er mit seiner schweren Schuld konfrontiert. Angesichts dieser Lage wird ihm das Erzählen vergehen, er beginnt, seine neue Situation zu erforschen. Sein Werk wird entweder zum Zustands- oder zum Rechenschaftsbericht - offene oder verschlüsselte Autobiographie ist ja heute schon an der Tagesordnung - oder, umgekehrt, es wird zur Rekapitulation aller erfahrbarer Schönheit dieser Welt.
20-21/22
Zwei bedeutende Schriftsteller der Gegenwart seien hier als Beispiel genannt: Günter Grass prüft den objektiven Befund der Erde und teilt sein Erleben, zum Teil grafisch, mit. Peter Handke berichtet subjektiv über seine Befindlichkeit und setzt ein in seiner Qualität einmaliges Beispiel inneren Erlebens.
Geschichten erzählen beide nicht mehr, die Geschichten sind erzählt. Ihre Texte sind eindringliche Hinweise, bei Grass auf den Zerfall unseres einst so wunderbaren Lebensraumes, bei Handke auf die tiefe, beruhigende Wirkung des noch Bestehenden, wenn man so will, des Heilen.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Dies ist nun doch keine wirkliche, sinngerechte oder gar ermutigende <Rede an die Jugend> geworden, und ich möchte Ihnen fast raten, sie als eine subjektive, aber ehrliche Rechtfertigung eines alten Schriftstellers für sein Verstummen zu betrachten.
Ein Schriftsteller mag durch mehrere Generationen hindurch leben und alt werden, aber seine wahrhaft und wahrhaftig auswertbare Erlebnis- und Erfahrungskraft baut sich auf den Stadien seiner Jugend und seiner Frühzeit auf.
Und ich bezweifle sehr, ob er, in dieser Zeit lebend, noch einmal sein kreatives Bewußtsein auf die rapide sich verändernden Verhältnisse völlig umstellen kann, ohne sich von den Sichtweisen und Denkschemata seiner Frühzeit beeinflussen zu lassen. Gewiß: kein Leser verlangt Objektivität von ihm, aber er selbst muß das Objektive wägen können, um zu wissen, wie weit er sich davon entfernen kann.
Es gibt zwar Werte, die ewig sind - obgleich man auch daran heute zweifeln möchte -, aber es gibt keine generationenüberdauernden Regeln des menschlichen Zusammenlebens und der entsprechenden Kommunikation. Die Zukunft ist unsicher, und jede neue Entwicklungsstufe trifft uns letztlich unvorbereitet. Sie erschreckt und überfordert uns immer wieder aufs neue. Daher wären mahnende Worte eines alten Mannes an die Jugend eine Zumutung für sie. Der Ausruf »In Euren Händen liegt die Zukunft!« wäre nicht nur fehl am Platz, er wäre schamlos und zynisch.
Noch bis vor kurzem - zum Beispiel - lag ein erheblicher Teil der Zukunft in den Händen eines brutalen Gewaltherrschers und Umweltverbrechers von epochalem Zuschnitt. Und in wessen Hände sein Teil der Erde nach ihm gerät, steht dahin, ebenso wie die Frage, ob es jemals so friedlich wird, daß wir uns der Erde als Natur annehmen können.
Wir sind also - wie so oft in unserer Zeit - auf das Hoffen angewiesen. Im Hoffen sind Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, stärker und fester, als ich es bin. Und mein sehnlicher Wunsch wäre, daß Sie es nicht umsonst tun und später auf einer Erde leben können, deren Rettung sie Ihnen zu verdanken hat.
Ich weiß, daß ich in dieser Rede nicht viel gesagt habe. Dennoch habe ich ein gutes Gewissen, denn ich habe Sie nicht angelogen. Und ich hoffe, daß dereinst der nächste Preisträger meine Worte mit Fug und Recht in den Wind schlagen kann.
22-23
Ende
Desintegration
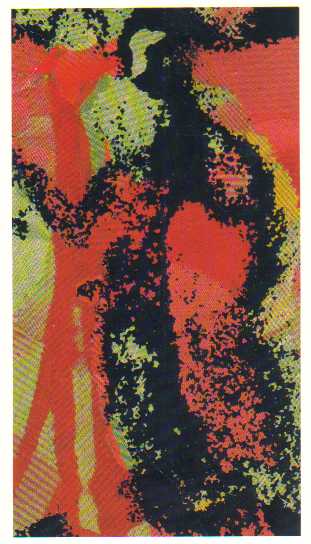
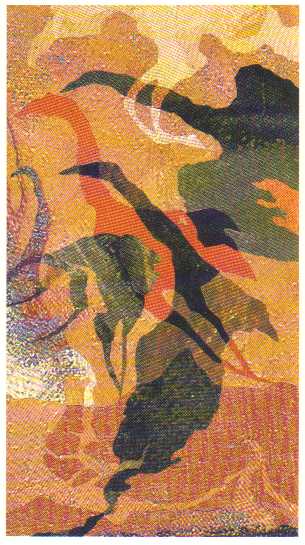 Flucht
Flucht
Wolfgang Hildesheimer (1991) Rede an die Jugend