James/Jim E. Lovelock
Unsere Erde wird überleben
Gaia: Eine optimistische Ökologie
Gaia – A new look at life on Earth
1979 by Oxford University Press
1982 bei Piper
1984 bei Heyne
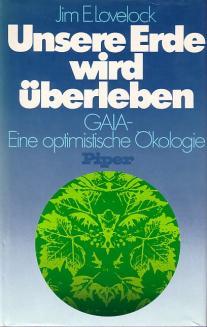
1979 224 Seiten
Bing.Buch
detopia:
|
|
James/Jim E. LovelockUnsere Erde wird überleben Gaia: Eine optimistische Ökologie Gaia – A new look at life on Earth
1979 by Oxford University Press 1982 bei Piper 1984 bei Heyne |
|
1979 224 Seiten Bing.Buch
detopia: |
|
In alten Kulturen wird die Erde als Lebensprinzip, als Gottheit verehrt. Die alten Griechen nannten sie GAIA. Der englische Naturwissenschaftler Jim E. Lovelock greift die Idee dieser Wesenheit auf. Er vertritt die These, daß die Biosphäre eine sich selbst regulierende Einheit ist. Das bedeutet, daß sich GAIA gegen ihre Zerstörung wehrt, sich letztlich auch gegen den Menschen wehrt, im Interesse des Menschen. Lebende Materie verhält sich angesichts der Bedrohung ihrer Existenz nicht passiv. Es scheint, als sei auch die Atmosphäre im Zusammenwirken sämtlicher Lebensformen so gestaltet, daß sie notwendige Kontrollfunktionen übernehmen kann. Das ganze System verhält sich offensichtlich wie ein Organismus, wie ein Lebewesen. Lovelocks Vorstellung von der Biosphäre als einer sich selbst regulierenden Wesenheit bietet eine notwendige Alternative zu der pessimistischen Ansicht, daß die Natur nur eine geistlose Materie darstelle, die der Mensch sich unterwerfen und damit vernichten könne. |
Inhalt Inhalt.pdf Vorwort
1: Einleitung 2: Der Anfang 3: Die Entdeckung Gaias 4: Kybernetik 5: Die gegenwärtige Erdatmosphäre 6: Das Meer 7: Gaia und der Mensch: das Problem der Umweltverschmutzung 8: Unser Leben als Teil Gaias 9: Epilog
Glossar Literaturhinweise |
Leseprobe
Vorwort
Das Bild von „Mutter Erde“ oder, wie die Griechen sie vor langer Zeit nannten, von Gaia ist durch die Jahrhunderte weithin lebendig geblieben und zur Grundlage eines Glaubens geworden, der sich noch heute neben den großen Religionen behauptet. Aus den immer tieferen Einsichten in unsere natürliche Umwelt und dem Fortschritt der Ökologie sind jüngst Vermutungen erwachsen, wonach die Biosphäre mehr sein könnte als nur die Gesamtheit aller lebenden Wesen, die Land, Wasser und Luft als ihre natürlichen Lebensräume bevölkern. Alter Glaube und neuzeitliches Wissen, beides verschmolz gefühlsmäßig in jener Ehrfurcht, mit der die Astronauten mit ihren eigenen Augen und mit der wir indirekt die Erde in all ihrer strahlenden Pracht vor dem tiefdunklen Hintergrund des Weltraums enthüllt sahen. Doch dieses Gefühl, so stark es sein mochte, beweist nicht, daß Mutter Erde lebt. Gleich einem religiösen Glauben läßt es sich nicht wissenschaftlich prüfen, ist es von seinem Wesen her dem Zugriff der Vernunft entzogen.
Die Raumflüge zeigten mehr als die Erde nur aus einem neuen Blickwinkel. Sie brachten auch Informationen über die Atmosphäre und die Oberfläche der Erde, die einen neuen Einblick in die Wechselwirkungen zwischen den belebten und den unbelebten Bereichen dieses Planeten boten. Daraus ist die Vorstellung, ist das Modell entstanden, wonach die lebende Materie der Erde zusammen mit der Lufthülle, den Ozeanen und den Landflächen ein komplexes System bildet, das sich als ein einziger Organismus betrachten läßt und die Fähigkeit besitzt, unseren Planeten als eine geeignete Stätte des Lebens zu erhalten.
Dieses Buch ist der persönliche Bericht einer Reise durch Raum und Zeit, die der Suche nach Beweisen für dieses Bild der Erde galt. Dieses Forschen begann vor etwa fünfzehn Jahren und hat durch viele verschiedene Gebiete der Naturwissenschaften geführt – von der Astronomie bis zur Zoologie. Solche Reisen strengen an, da die Grenzen zwischen den einzelnen Wissenschaften eifersüchtig von Fachleuten bewacht werden und innerhalb jedes Gebiets eine andere Geheimsprache erlernt werden muß.
Normalerweise würde eine derart ausgedehnte Reise übermäßig kostspielig, und auch ihr Ertrag an neuem Wissen wäre nur gering; doch ebenso, wie der Handel zwischen zwei kriegführenden Nationen oftmals noch weiterläuft, so kann auch ein Chemiker solch entfernte Disziplinen wie Meteorologie oder Physiologie durchstreifen, sofern er etwas zum Tausch anbieten kann. Gewöhnlich wird das irgendeine Apparatur oder ein Verfahren sein. Ich hatte das Glück, kurzzeitig mit A.J.P. Martin zusammenzuarbeiten, der unter anderem die Gaschromatographie entwickelte, eine ungemein wichtige chemische Analysetechnik. Mir gelangen damals einige Verbesserungen, die den Anwendungsbereich dieser Erfindung erweiterten. Eine davon war der sogenannte Elektroneneinfangdetektor, ein Gerät, das sich durch seine ungemein hohe Empfindlichkeit beim Nachweis schwächster Spuren von bestimmten Substanzen auszeichnet. Diese Empfindlichkeit machte es erstmals möglich, Rückstände von Pestiziden in allen Lebewesen dieser Erde nachzuweisen – bei Pinguinen der Antarktis ebenso wie in der Milch stillender Mütter in den USA.
Diese Entdeckung war hilfreich für die Abfassung von Rachel Carsons außerordentlich einflußreichem Buch „Der stumme Frühling“: Sie lieferte die nötigen Belege, mit denen Rachel Carson dann ihre Sorge über den Schaden begründen konnte, den diese allgegenwärtigen giftigen Substanzen der Biosphäre zufügen. Immer wieder wurden mit dem Elektroneneinfangdetektor winzige, aber dennoch wirksame Mengen toxischer Chemikalien an Orten aufgespürt, wo sie nicht sein sollten. Zu diesen Eindringlingen zählen: PAN (Peroxyazetyl-Nitrat), ein giftiger Bestandteil des Smogs über Los Angeles; PCB (Polychlorbiphenyl) in abgelegenen, naturbelassenen Landstrichen; und jüngst, in der gesamten Atmosphäre, Chlor-Fluor-Kohlenwasserstoffe und Stickoxyde - Substanzen, die im Verdacht stehen, den Ozonschild der Stratosphäre zu schwächen.
Zweifellos waren es die als Handelsgüter sehr geschätzten Elektroneneinfangdetektoren, die es mir ermöglichten, meine Suche nach Gaia durch die verschiedenen Gebiete der Naturwissenschaften fortzusetzen und dabei tatsächlich auch, im wörtlichen Sinne, um die Erde zu reisen. Obschon meine Rolle als Kaufmann mir interdisziplinäre Reisen gestattete, waren diese doch kein leichtes Unterfangen: Die vergangenen fünfzehn Jahre haben viel Unruhe innerhalb der Biowissenschaften mit sich gebracht, insbesondere dort, wo die Wissenschaft in den Bereich der Machtpolitik hineingezogen wurde.
Als Rachel Carson uns auf die Gefahren hinwies, die vom massierten Einsatz toxischer Chemikalien drohen, brachte sie ihre Argumente mehr nach Art einer Anwältin denn als Wissenschaftlerin vor. Anders ausgedrückt: Sie wählte dasjenige Beweismaterial aus, das für ihren Fall sprach. Die chemische Industrie antwortete, da sie dadurch ihre Existenz bedroht sah, mit ebenso ausgesuchten Argumenten, um sich zu verteidigen. Nun mag das der richtige Weg gewesen sein, den Menschen in jenen Punkten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, in denen das Problem die Gesellschaft als Ganzes berührte, und vielleicht war das in diesem Fall wissenschaftlich entschuldbar; doch dieses Beispiel scheint Schule gemacht zu haben. Seitdem werden Unmengen wissenschaftlicher Argumente und Beweise in Sachen Umwelt wie in einem Gerichtssaal oder wie bei öffentlichen Anhörungen vorgetragen. Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, daß dies zwar in dem Sinn positiv ist, als die Öffentlichkeit dabei entsprechend den Regeln der Demokratie an Fragen von allgemeinem Belang beteiligt wird, daß es indes nicht der beste Weg ist, wissenschaftliche Wahrheit ans Licht zu bringen. Denn die Wahrheit, so heißt es, ist das erste Opfer des Kriegs. Und es ist ihr ebenso abträglich, wenn nur ein ausgesuchter Teil von ihr dazu herangezogen wird, einen Fall gesetzmäßig zu rechtfertigen.
Wo es um Fragen der Umwelt geht, so scheint es, spaltet sich die wissenschaftliche Gemeinschaft in Kampfgruppen, ordnet man sich geradezu zwanghaft den Glaubenssätzen jener Genossenschaft unter, der man nun einmal angehört. Die ersten sechs Kapitel dieses Buchs handeln nicht von Gegenständen sozialer Kontroversen – zumindest nicht unmittelbar. Doch mit den letzten drei Kapiteln, in denen es um Gaia und die Menschheit geht, befinde ich mich auf einem Schlachtfeld, auf dem heftige Kämpfe im Gange sind.
In seinem Buch „Sex, Wissenschaft und Gesellschaft“ stellt Sir Alan Parkes fest: „Wissenschaft kann ernsthaft sein und dennoch nicht unzugänglich.“ Ich habe mich darum bemüht, diese weisen Worte immer im Gedächtnis zu behalten; dennoch war ich in meiner Aufgabe, für eine allgemeine Leserschaft Sachverhalte aufzubereiten, die normalerweise in einer zwar präzisen, doch für Eingeweihte bestimmten Sprache ausgedrückt werden, manchmal fast überfordert. Aus diesem Grund finden sich Passagen und Sätze, die sich zugleich anthropomorph und teleologisch lesen.
Ich habe den Namen Gaia oft als Kürzel für die eigentliche Hypothese gebraucht, daß die Biosphäre eine sich selbst regulierende Wesenheit darstellt, dazu befähigt, unseren Planeten gesund zu erhalten, indem sie die chemische und physikalische Umwelt überwacht. Gelegentlich war es schwierig, ohne ausgiebige Umschreibungen nicht so von Gaia zu sprechen, als sei sie bekanntermaßen ein fühlendes Wesen. Dies ist um nichts ernster gemeint als die Bezeichnung „sie“ für ein Schiff, gebraucht von der Mannschaft, die auf ihm fährt – in der Erkenntnis, daß sogar Holz- und Metallteile, zweckmäßig geformt und zusammengefügt, zu einer übergreifenden Persönlichkeit mit charakteristischen Zügen werden können, die mehr ist als die bloße Summe der Teile.
Kurz nachdem ich dieses Buch geschrieben hatte, stieß ich auf einen Artikel von Alfred Redfield, erschienen 1958 im „American Scientist“. Er stellte darin die Hypothese auf, daß die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre und der Ozeane biologisch kontrolliert sei. Ich freue mich, Redfields Beitrag zur Entwicklung der Hypothese über Gaia noch an dieser Stelle würdigen zu können, zugleich aber erkenne ich, daß viele andere diese oder ähnliche Vorstellungen entwickelt haben müssen und daß manche sie vielleicht veröffentlicht haben. Die Vorstellung von Gaia, von einer lebenden Erde, war in der Vergangenheit für den Großteil der Naturwissenschaften nicht annehmbar; deshalb dürften frühere Saaten nicht aufgegangen, sondern unter der Streu wissenschaftlicher Schriften begraben geblieben sein.
Ein so breit gefächerter Gegenstand, wie dieses Buch ihn zum Inhalt hat, erfordert viele Beratungen. Ich möchte den zahlreichen wissenschaftlichen Kollegen danken, die mir geduldig und unermüdlich ihre Zeit zur Beratung geliehen haben, besonders Professor Lynn Margulis aus Boston, der mein ständiger Lehrer und Ratgeber war [die meine ständige Lehrerin und Ratgeberin war]. Ebenso danke ich Professor C. E. Junge aus Mainz und Professor B. Bollin aus Stockholm, die mich als erste ermutigten, über Gaia zu schreiben. Weiter danke ich meinem Kollegen Dr. James Lodge in Boulder, Colorado, und Sidney Empton vom Shell-Forschungsinstitut sowie Peter Fellgett, Reading, der mich ermutigte, die Untersuchungen fortzusetzen.
Mein besonderer Dank gilt Evelyn Frazer, die die zunächst aus einem ungeordneten Mosaik von Sätzen und Abschnitten bestehende Rohfassung dieses Buches in eine lesbare Form brachte und die dabei so geschickt vorging, daß am Ende alles genau so dastand, wie ich es hätte sagen wollen, wenn ich es gekonnt hätte.
Zum Schluß möchte ich mich bei Helen Lovelock bedanken, die nicht nur das Manuskript tippte, sondern auch eine Umgebung schuf und pflegte, in der Schreiben und Denken möglich waren.
Am Ende des Buches habe ich, nach Kapiteln geordnet, die wichtigsten Informationsquellen und Vorschläge für