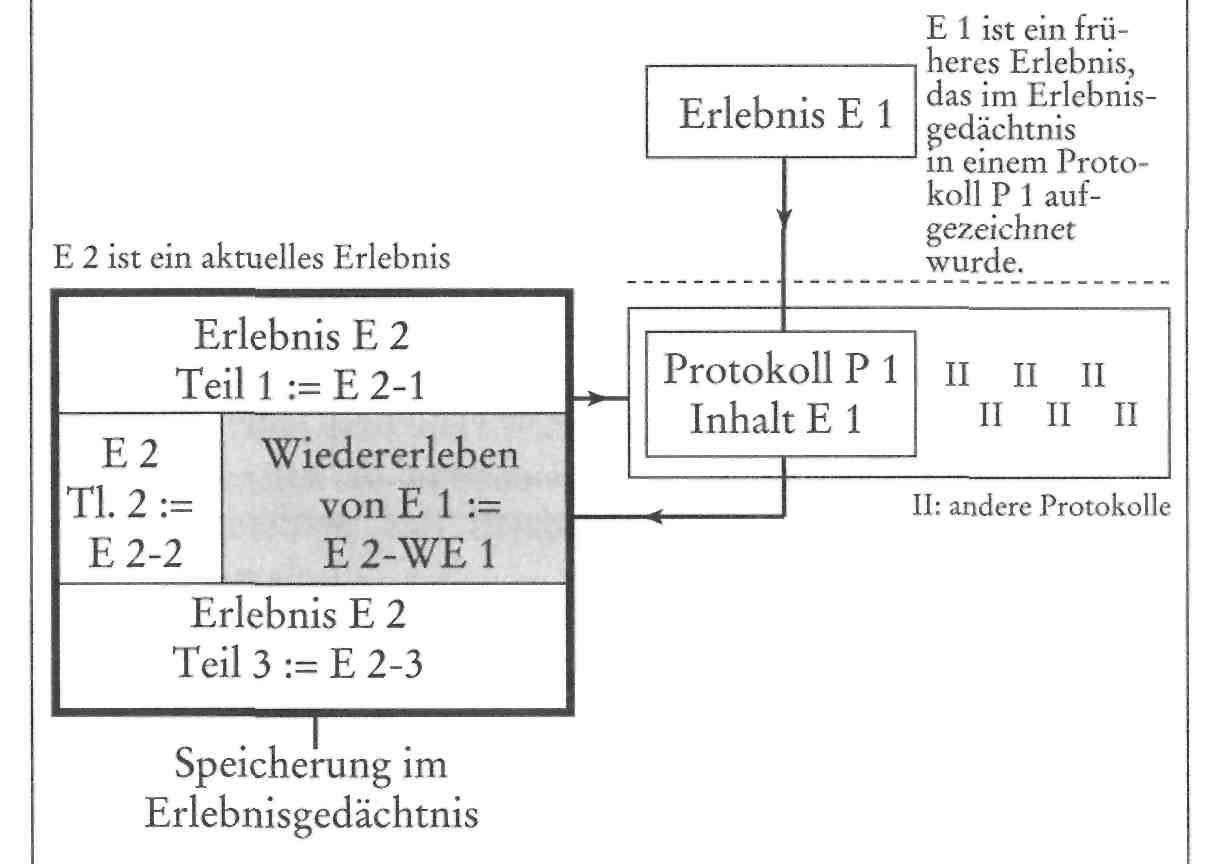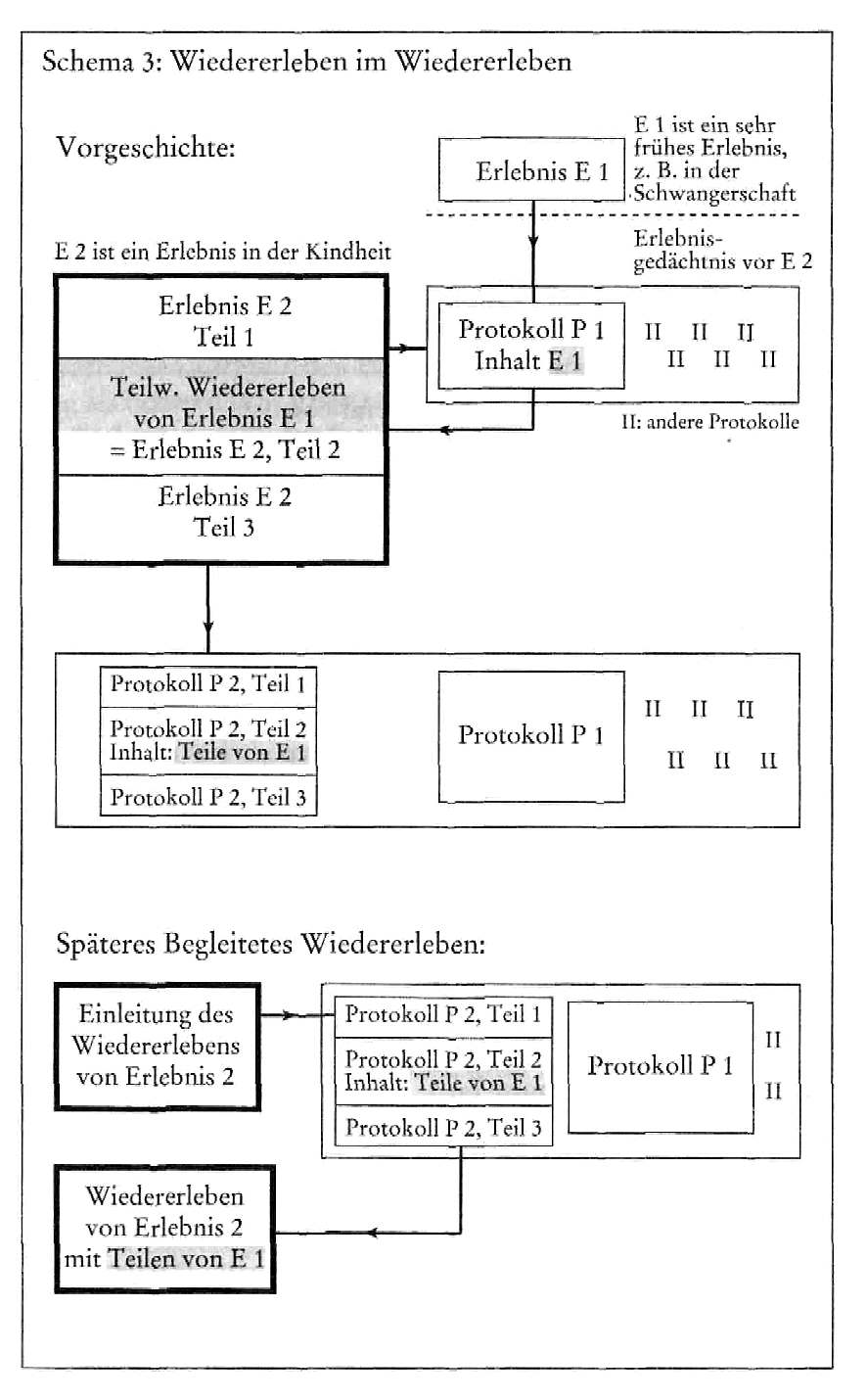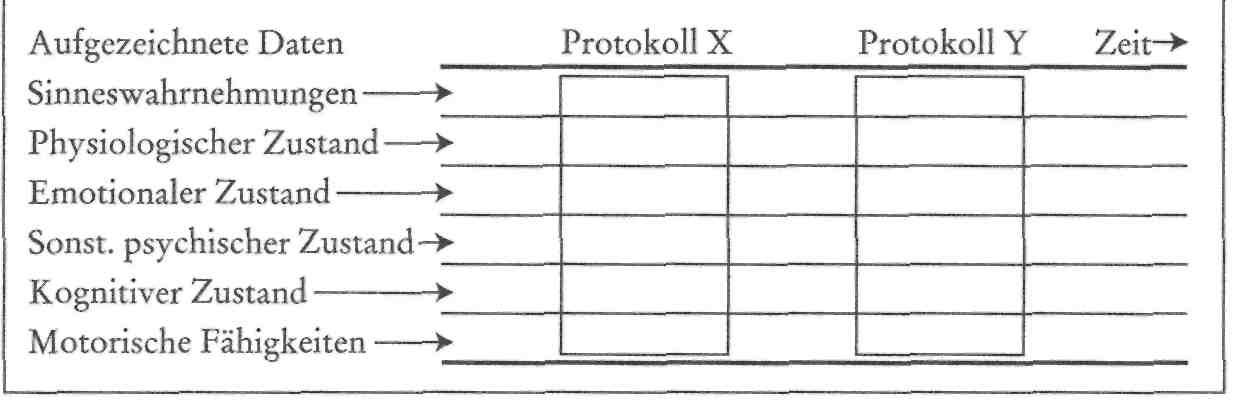•
Da ist eine, die redet immer. Sie ist nie still, sie redet immerzu. (Thea will
absolut nicht hören, was dieses Kind sagt, aber schließlich kann sie die
Wahrnehmung nicht länger unterdrücken:) Sie sagt, ich soll lieb sein, soll
mich nicht so anstellen. Er muß das tun, es muß sein. Ich bin selber schuld.
Ich bin böse. Immer wieder sagt sie das. (Thea schlägt sich zwischendurch
wiederholt mit den Fäusten an den Kopf; sie will die Stimme zum Schweigen
bringen.)
(Dieses
Kind ist offenbar ein Produkt einer »Introjektion« oder einer Identifikation
mit dem Vater, dessen Sätze es ständig wörtlich rezitiert. [Auch der Vater
redete oft - und mit der Absicht einer Gehirnwäsche - viertelstundenlang
pausenlos auf Thea ein, wobei diese sich immer die Ohren zuhalten wollte.]
Bezeichnenderweise kann Thea die Emotionen dieses Kindes nicht nachempfinden
und wiedererleben, sie kann dem Kind nur mit Widerwillen zuhören.)
•
Eine andere ist wütend (Thea ballt die rechte Hand zur Faust und bewegt sie,
als ob sie damit schlagen oder stechen wolle). Sie schreit ... sie schreit
ganz laut: »Nein, nein, nein!« Sie ist eingesperrt, in einen Käfig
eingesperrt, sie darf nicht raus ... sie ist zu gefährlich. (Sehr viel
später erst erfahre ich, daß der Käfig kein Phantasieprodukt war: der Vater
hatte der widerspenstigen Thea immer wieder gedroht, sie werde demnächst in
einen Käfig gesperrt, den er gerade baue. Einmal zeigte er ihr sogar eine
Skizze davon.)
•
Da sind noch mehr ... Eine ist ganz klein, die weint und ist traurig, niemand
hat sie lieb (Thea beginnt bitterlich zu weinen). Sie will, daß sie jemand
liebhat. Sie wünscht es sich so sehr, sie ist doch noch so klein ... (Daß
jemand sie liebhabe, ist Theas innigster Wunsch, den sie jedoch im Laufe der
Zeit mehr und mehr verdrängt hatte: »Ich brauche niemanden, ich brauche euch
alle nicht!«)
•
(Nach einer Weile beruhigt sich Thea wieder, doch nach einer kurzen Pause
beginnt sie erst ängstlich, dann panisch zu atmen und reißt die Augen voller
Angst auf.) Da ist eine, die hat Angst ... schreckliche Angst. Sie hat immerzu
Angst. Sie (das Mädchen wie die Angst) ist immer da. (Dies ist in der Tat
Theas emotionales Grundbefinden.)
79
•
(Als die Angst nach einer Weile abgeklungen ist, beginnt Thea erst fast
unmerklich, dann immer deutlicher zu lächeln. Es ist ein seltsames, irres
Lächeln.) Da ist eine, die hat sich 'ne Höhle gebaut, da darf niemand rein.
Sie redet nicht, sie hat einfach aufgehört zu reden ... Sie ist so weit weg,
sie gehört irgendwie nicht mehr dazu ... (Thea hatte schon lange gelernt, bei
sehr großen Schmerzen »weit wegzugehen«.)
•
(Thea wird wieder unruhig und zeigt dann Anzeichen zunehmender Schmerzen.) Es
tut so weh! Au, au! - Da ist noch eine ... der tut's so weh (Thea weint
lange). Die muß immer hin, wenn's weh tut ... (gemeint ist: Sie ist
diejenige, die zum Vater gehen muß, wenn dieser ruft.) Es ist nicht die erste
... da waren vorher schon mehrere ... (»Was ist aus denen geworden?«) Die
sind weg ... da waren so viel Schmerzen, die haben sie nicht ausgehalten ...
die sind gestorben.
Immer
wenn Thea die sieben Kinder durchgegangen war, spürte sie ihre eigene
ungeheure Verwirrung und ihre Angst, verrückt zu werden: »Was ist nur mit
mir los? Was geschieht da mit mir? Werde ich verrückt?«
Nach
der Sitzung, in der die sieben Kinder erstmals deutlich geworden waren, ist
Thea äußerst erstaunt und beunruhigt wegen des Erlebten. Sie fragt mich
immer wieder, was da vorgegangen sei. Ich erinnere sie schließlich an das,
was sie seit langem über multiple Persönlichkeiten weiß. Sie meint,
darüber gelesen zu haben oder aber diesen Zustand zu erleben, sei doch
zweierlei. (So wie eben kognitives Erinnern und Wiedererleben zweierlei sind.)
Sie habe sich nicht mehr wie eine eigenständige Person gefühlt, sondern eher
wie eine Wohnung, in der sich die anderen herumgetrieben hätten. Plötzlich
begreift sie auch mit großer Erleichterung, warum sie ihr Leben lang immer
zwanghafte Angst hatte, die Kontrolle zu verlieren.
Im
Abschnitt 5.1 habe ich berichtet, daß akute körperliche Ausnahmezustände
wie zum Beispiel Krankheiten, die früher in einer traumatischen Situation
bestanden und darüber hinaus einige Zeit andauerten, auch nach dem
Wiedererleben der betreffenden Situation in der Therapie eine Weile anhalten
können. Dies gilt auch für Emotionen und akute psychische Ausnahmezustände:
Wenn die in einer traumatischen Situation ausgelösten Emotionen oder
psychischen Ausnahmezustände (wie zum Beispiel der oben beschriebene
tranceartige Zustand Theas) seinerzeit einige Stunden oder
80
gar
Tage anhielten (die lang anhaltenden Wirkungen von Traumata, die gleichsam
chronisch werden, sind hier nicht gemeint), dann kann die Person auch nach dem
Begleiteten Wiedererleben im Alltag einige Zeit lang davon akut betroffen
sein.
5.3.
Kognitive Zustände und Fähigkeiten beim Wiedererleben
Mit
kognitiven Zuständen und Fähigkeiten meine ich die Gesamtheit der zu einem
bestimmten Zeitpunkt im kognitiven Gedächtnis eines Menschen gespeicherten
und abrufbaren (erinnerbaren) Informationen sowie seine kognitiven
Fähigkeiten (»Denkfähigkeiten«). Seine augenblicklichen kognitiven
Fähigkeiten zu dem betrachteten Zeitpunkt können durch Störungen mehr oder
weniger vermindert sein, sind aber ein Charakteristikum des jeweiligen
Zustands der Person. Eventuelle Defizite mögen der Person nicht immer bewußt
sein, können aber vom Therapeuten in etwa gleichem Maße beobachtet werden,
wie es in der früheren Realität möglich gewesen wäre.
Beispiel:
Unter
dem Einfluß eines starken Beruhigungsmittels ist die damals achtjährige Thea
nicht fähig, die Frage des Vaters »Was ist drei mal drei?« zu beantworten.
Sie quält sich sichtlich mit der Lösung der Aufgabe und ist durch ihren
Mißerfolg verängstigt, weil »ich genau weiß, daß ich das sonst immer
weiß!« Nachdem sie drei Tage »weitergegangen« ist und die Wirkung der
Droge nachgelassen hat, beantwortet sie mühelos meine Fragen nach vier mal
vier, fünf mal fünf usw.
Vorhandene
Informationen und Fähigkeiten können, wie obiges Beispiel zeigt, abgefragt
und eventuell von der Person demonstriert werden: Wie heißt du? Wie alt bist
du? Weißt du, was XY (irgendein Begriff) bedeutet? Gehst du schon in den
Kindergarten? Kannst du schon zählen, lesen, schreiben, rechnen? Ist deine
Mama da? Wo bist du jetzt? Fragt man nach etwas (damals) Unbekanntem, schaut
die Person verständnislos drein. Und manchmal hat man auch mit anscheinend
deplazierten Fragen unerwartetes Glück.
81
Beispiel:
In
Begleitung von K. erlebt Nathaiie eine Erkältung im Babyalter wieder. Aus
irgendeinem Grund fragt K. sie nach dem Wochentag und erhält prompt die
Antwort »Sonntag«. »Woher weißt du das?« - »Mama sagt: >Muß dieses
doofe Kind ausgerechnet am Sonntag krank werden!<« Das ermutigt K., sie
nach ihrem Alter zu fragen. Nach kurzem Überlegen sagt Nathaiie: »Sechs
Wochen - Mama sagt.« - »Was hat denn die Mama gesagt?« Sofort wird die
kleine Nathaiie sehr traurig. Nach einigem Sträuben - der Satz tut ihr
offenbar sehr weh - bringt sie mühsam und unter Tränen hervor: »Sechs
Wochen ist die jetzt da, und nix als Theater!«
Die
folgenden Fallbeispiele zeigen, in welchem Maße man beim Begleiteten
Wiedererleben Einblick in die kognitiven Fähigkeiten (und in das seelische
Befinden) eines Menschen und in die Verhältnisse in unserer Gesellschaft zu
einer hier über dreißig- Jahre zurückliegenden Zeit gewinnen kann.
Fallbeispiel
10: Gespräch mit einer »Zweijährigen«
K.
ist während der Therapie - zunächst unbeabsichtigt - zu einer fiktiven
Gesprächspartnerin der kleinen Nathaiie geworden. Später benutzte sie die
von ihr entdeckte Möglichkeit, sich mit der kleinen Nathaiie in ihrer
damaligen Situation zu unterhalten, manchmal absichtlich zur Gewinnung
zusätzlicher Informationen und - vor allem - um Nathaiie Erholungspausen von
schrecklichen Erlebnissen zu schenken. Diese Gespräche machen Klein-Nathalie
sehr viel Freude, aber merkwürdigerweise kann sie sich nach der Sitzung nicht
an deren Inhalt erinnern, wogegen sie doch die wiedererlebten Geschehnisse aus
der damaligen Zeit nachher genau kennt. (Nach der Sitzung freut sie sich immer
sehr über die Schilderungen dieser Gespräche.) Wenn sie aber in einer der
folgenden Sitzungen eine etwas spätere Episode aus ihrer Kindheit
wiedererlebt, kann sie sich (während des Wiedererlebens) sehr wohl an die
Gespräche erinnern. Mehr noch: Es zeigt sich dabei, daß sie aus den
früheren Gesprächen sogar kognitiv gelernt hat. So hat beispielsweise K. ihr
einmal den Begriff »Vergangenheit« erklären müssen (Nathaiie war damals
drei Jahre alt). Einige Zeit später fragt K. die kleine Nathaiie, ob sie noch
wisse, was »Ver-
82
gangenheit«
bedeutet. Nach kurzem Überlegen kommt die Antwort: »Alles, was vor heute
ist.«
Das
Folgende ist ein wörtliches Therapieprotokoll, die Transkription einer
Videoaufzeichnung. Nathalie spricht für ihr Alter eine gut entwickelte
Sprache, kann jedoch manche Laute noch nicht richtig aussprechen.
K:
Wie alt bist du denn? Weißt du das schon?
N:
Noch paarmal ßlafen, dann so: (sie zeigt zwei Finger der
linken
Hand; die kleine Nathalie ist Linkshänderin) K: Du bist also zwei. Dann hast
du ja bald Geburtstag? N: Hmm ...
K:
Und kannst schon so gut sprechen! N: Hmm ... sprechen ... das is ßön! K:
Kannst schon so viele Wörter! Die merkst du dir immer
gut?
N: (Imitiert Schwester Erika mit erhobenem Zeigefinger:)
»Genau
ßuhören!« sagt Eerka. K: Ja, genau zuhören, dann merkt man sich die
Wörter. Da
hast
du dir schon so viele Wörter gemerkt? N: Wörter ßöön! K: Zahlen auch?
N:
So was? (streckt abzählend nacheinander die Finger aus) K: Ja, eins - zwei -
drei ... das sind Zahlen. N: (Schüttelt den Kopf) Sind niß ßön ... kann
man niß mit pie-
len.
K: Aber mit Wörtern kann man spielen? N: Ja!
K:
Erzähl mal! Wie kann man denn mit Wörtern spielen? N: (Lacht, tippt sich mit
der flachen Hand an die Stirn) Im
Topf!
K: Im Kopf? - Erzähl mal, wie man damit spielt! N: (Macht mit den Fingern
vertauschende Bewegungen) Vorn
und
hinten ... und dann umgedreht! K: Ach, umgedreht! So verdrehst du die Wörter?
Sag mir mal
so
ein Wort, ein verdrehtes! N: (Denkt kurz nach) Sseibenfenster! Mußt du
jetzt... K: Muß ich jetzt raten? Kann das sein ... vielleicht ...
Fensterscheibe? N: Sehr gut!
K:
Das ist schön! - Machst du das mit der Schwester Erika? N: Ja.-Jetzt du!
83
K:
(Sucht ein Wort, schaut sich dabei im Zimmer um) Topfblume?
N:
(Leicht ungehalten:) Das iß doch'n richtiges Wort!
K:
(Stutzt) Ja ... kein gutes Beispiel ... aber das kann man auch umdrehn!
N:
(Überlegt, hilft mit den Fingern nach, nickt) Blumentopf! -Aber das iß doch
wieder ein richtiges Wort!
K:
Ja, das sind beides richtige Wörter ... kein gutes Beispiel...
N:
(Lächelt verschmitzt, schüttelt dann den Kopf) Große Leute können das niß
so gut! (Beide lachen)
K:
Ja, du hast das ja schon so viel geübt ... (denkt nach) -Weißt du denn, was
aus ... Läuseblatt wird?
N:
Läuse? - Das sind die kleinen Krabbeltierchen (macht mit den Fingern
Laufbewegungen)
K:
Ja.
N:
(Denkt nach ... bewegt die Finger ... dann plötzlich:) Blattläuse!
Im
weiteren Verlauf des Gesprächs kommen die beiden auch auf das Essen zu
sprechen: Nathalie mag kein warmes Essen, das tut am Gaumen weh und im Magen
wird ihr schlecht (siehe dazu Fallbeispiel 2). Sie mag kein Fleisch, keinen
Pudding, keine Milch, nur kalten Tee. (Für alle diese Aversionen gibt es gute
Gründe, sie hängen mit dem schon lange vorher aufgedeckten sexuellen
Mißbrauch Nathalies durch den Großvater im Babyalter zusammen.) Dann
beschreibt sie genau die einheitliche Kleidung der Kinder im Heim: Bluse,
Faltenrock, Schürze (sonntags weiß) und weiße Strümpfe. Dann kommen sie
auf die Beinschiene zu sprechen, die Nathalie zur Korrektur einer Fehlhaltung
des linken Fußgelenks (der Folge einer schweren Mißhandlung durch den
Bruder) tragen muß. Schwester Erika hat ihr begreiflich zu machen versucht,
daß sie die Schiene immer tragen muß, damit sie später schnell laufen kann.
(Nathalie hat mit knapp zwei Jahren beschlossen, später Läuferin und
Springerin zu werden; das geht nur, wenn sie die Schiene immer trägt.) K.
gebraucht im Gespräch darüber das Wort »vernünftig« und muß nun der
Zweijährigen erklären, was das bedeutet - aus dem Stegreif keine ganz
leichte Aufgabe. K. gibt sich redlich Mühe, und nach zwei Versuchen hat
Nathalie verstanden: »Das ist, wenn ich was versteh' und es dann mach' - das
ist vernünftig?«
84
Plötzlich
beginnt Nathalie an den Fingernägeln zu knabbern, sie wird sichtlich nervös.
Nur mit Mühe kann K. sie bewegen, über den Grund zu sprechen: Es wird gleich
Nacht, und Nathalie hat Angst davor: »Dann sind so komische Sachen in meinem
Kopf, und die Hände sind kalt und mir ist schlecht im Bauch - wie bei warmem
Essen.« Und oft muß sie sich mitten in der Nacht im Bett aufsetzen, damit
sie Luft bekommt. Schwester Erika hat ihr erzählt, daß sie schon als Baby
immer wieder die Luft anhielt und in Atemnot geriet und daß es nun schon viel
besser geworden sei. Und oft hat sie »die Töne im Kopf« (sie meint, wie K.
aus früheren Sitzungen weiß, Geräusche wie heftiges Schnaufen und Stöhnen
bei sexuellen Aktivitäten). Als K. die Geräusche nachahmt, um sie noch
tiefer in ihre Angst hineinzuführen und die Auflösung zu beschleunigen,
schreit Nathalie laut: »Nein, nein!« und will nicht weiter darüber reden.
Wer denn die Töne mache, fragt K. Das bringt Nathalie in Panik; sie wirft
sich auf die Seite und zittert am ganzen Körper. (Zweifellos erinnert sie
sich hier an frühere Mißhandlungen.)
Fallbeispiel
11: Gespräch mit einer »Dreijährigen«
Nathalie
ist nun drei Jahre und drei Monate alt. Seit einigen Monaten muß sie gegen
ihren Willen jedes Wochenende daheim bei ihrer Mutter (die sie »die Frau«
nennt) verbringen, wo der Großvater sie regelmäßig besucht - und
mißbraucht. (Damit nicht genug: Er verkauft sie auch an andere Männer, die
sie in seinem Beisein in seinem Atelier - er ist Fotograf - foltern und
sexuell mißbrauchen, während er Pornoaufnahmen davon macht. Wir haben
inzwischen erfahren, daß er damit seine vierzehntäglichen Besuche der
Spielbank in Baden-Baden finanziert hat.) Bald nach Beginn der Besuche und
einem dadurch verursachten Suizidversuch (sie hat sich eine lange Treppe im
Heim hinabfallen lassen) hört Nathalie, die Wörter und Sprache so liebte
(siehe S. 82 ff.), auf zu sprechen. Nur in der künstlichen, »virtuellen«
Welt, die sich Nathalie und ihre Begleiterin in der Therapie erschaffen haben
(und die uns noch beschäftigen wird), spricht sie mit K. Ihrer
Sprechfertigkeit merkt man anfangs den Mangel an Übung an, später nimmt sie
erkennbar zu.
Nathalie
stottert jetzt (dies wird in der Transkription nur angedeutet), manchmal mehr,
manchmal weniger, je nach dem Ge-
85
sprächsthema,
und noch immer stößt sie mit der Zunge an, was jetzt mehr auffällt als vor
einem Jahr.
K:
Haben wir eigentlich Winter oder Sommer jetzt? (Nathalie weiß mit der Frage
nichts anzufangen.)
K:
N K N K: N K
Ist
es kalt ?
Ja,
kalt ... aber kein Ssnee, ßade ...
Kein
Schnee? Du magst Schnee gern?
Ja-
Habt
ihr schon (Advents-)Kerzen an?
Ja,
ßwei Kerzen.
Zwei
Kerzen habt ihr an? Im Kinderheim oder bei der
Frau?
N: Im Kinderheim.
K:
Hat die Frau auch einen Adventskranz mit Kerzen drauf? N: Ja, aber nicht so
ßön. K: Der ist nicht so schön? Und heute ist die zweite Kerze
dran?
Ist heut' Sonntag? N: (Sehr bestimmt:) Nein, heut' ist nicht Sonntag! K: Was
ist denn heute? - (Nathalie überlegt.) K: (Versucht ihr zu helfen:) Heut' ist
schon die zweite Kerze
dran
... ist schon Sonntag gewesen? N: Ja ... gewesen!
K:
Und jetzt habt ihr ... Freitag ... oder Samstag? N: (Überlegt, nimmt dabei
die Finger zu Hilfe:) Sa ... Sa ...
Samstag.
K: Samstag. Ach, Freitag ist Kindergarten und am Samstag
kommst
du zu der Frau? N: Nein ... Freitag nach dem Kindergarten. K: Ach ja, gestern
bist du schon zu der Frau gekommen.
Heut'
ist Samstag, und morgen kommt die dritte Kerze
dran?
N: Ja!
K:
Ach so! Und die Frau hat auch einen Adventskranz. N: Ja, ist aber nicht so
ßön, viel kleiner. K: Und im Heim? N: Da haben wir drei Adventskränze!
Einen auf dem Tisch
und
einen riiiesengroßen an der Decke, mit ßooo dicken
Kerzen
dran (zeigt mit den Händen, wie dick sie sind).
Muß
der Onkel Eduard raufklettern und anmachen. K: Welcher Onkel?
Onkel
Eduard!
Ach,
der Onkel Eduard! Euer Hausmeister?
Hausmeister?
Das
kennst du nicht, das Wort?
Ähäh...
Der
Mann, der alles ganz macht?
Jaaa.
Wenn was kaputt ist, dann kommt der immer.
Und
der hängt auch den großen Adventskranz auf?
Ja
- und den riiiesig großen Tannenbaum.
Ah,
habt ihr so was auch?
Ja,
draußen - bis in'n Himmel!
Bis
in den Himmel geht der?
Ach,
der ist ßön!
Da
muß er aber eine große Leiter haben!
Ja,
ganz große Leiter, kann man so ausziehn.
Eine
ganz große Leiter, bis in den Himmel.
(Etwas
ungehalten:) Die Leiter nicht - der Tannenbaum! -
(Kurze
Pause, dann plötzlich:) An Weihnachten will ich
aber
nicht zu der Frau!
Du
warst Weihnachten immer im Kinderheim? Ist's da
schön?
Ja-
Dann
geht ihr in die Kirche? Ja.
Was
macht ihr da in der Kirche? (Erstaunt:) Weißt du das nicht, was man da macht?
Doooch.
(Stöhnt
ungeduldig.) Mit dem lieben Gott reden. Machst du das gerne?
Jaa,
jaa, aber Weihnachten und Ostern und so alle Tage, die wichtig sind, da
dauert's immer so lang! Da ist es langweilig?
Ja,
dann hör' ich gar nicht zu und red' im Kopf mit dem lieben Gott.
Du
redest im Kopf mit dem lieben Gott? Und dann guck' ich mir die Maria an ...
mit dem Jesuskind. Und was sagst du dann zum lieben Gott? (Heftig:) Daß diese
neuen Leute verschwinden! Die neuen Leute? Die Frau und der Junge (ihr Bruder)
und der Opi?
N:
Ja, und daß er mich wieder richtig machen soll in meinem Kopf!
87
K:
Ist es nicht mehr richtig in deinem Kopf?
N:
Nein! Alles durcheinander!
K:
Und da sagst du ihm, daß er die neuen Leute verschwinden lassen soll und dich
wieder richtig machen soll in deinem Kopf?
N:
Ja - und daß er auf meine Eerka aufpassen soll. Und daß der doofe Frieder
nicht immer seinen Kopf abschalten soll. (Frieder, drei Jahre älter als
Nathalie, leidet unter epileptischen Anfällen. Nathalie aber glaubt, daß er
absichtlich »seinen Kopf abschaltet«. )*
Und
daß ich mich freu', daß es so schöne viele Bäume gibt ... und daß ich
sein Jesuskind mal gern sehen möchte!
K:
Ach!
N:
Jaa! Wenn Weihnachten ist, hat Jesuskindchen Geburtstag ... aber man kann es
gar nicht sehen.
Wenn
ich allein in der Kirche bin, dann muß ich nicht immer mit dem lieben Gott
reden - dann merk' ich den!
K:
Ach, dann merkst du den?
N:
Ja.
K:
Das ist schön! Wie fühlt sich das an? Was spürst du da?
N:
(Denkt nach.) Soo schwer zu sagen! (Überlegt weiter.) Kein Knubbel mehr im
Bauch ... dann wird's innen drin ganz warm ... kein Durcheinander im Kopf ...
K:
Aha!-Was noch?
N:
(Mit wachsender Erregung:) Dann ... dann ... dann gibt's die ganze Welt nicht
mehr!
K:
Ach so! Dann gibt's die ganze Welt nicht mehr? Nur den lieben Gott und dich?
N:
Jaa, ßoo ist das!
K:
Ach ja, jetzt versteh' ich das! Schön ist das! Da gehst du sicher öfter
allein in die Kirche? Die ist immer offen?
N:
Ja. Und wenn die doofe Schwester Eva Maria - (erschrickt) - das darf ich jetzt
nicht sagen! - und wenn die Schwester Eva Maria, wenn die mich sieht, dann
fragt die mich immer, was ich gebetet hab'. Und die Eerka sagt (sehr
bestimmt), das geht keinen Menschen auf der Welt was an!
K:
Ja, aber es ist schön, daß du mir das erzählt hast, da versteh' ich dich
dann besser.
*
Übrigens lebt auch Frieder noch und der später auftauchende »schlaue
Thomas«, und sie alle und Magda und Schwester Erika haben sich inzwischen
öfter getroffen.
N:
(Etwas ungläubig:) Verstehst du das?
K:
Ja, das versteh' ich gut! Wann hast du denn immer so ein
Durcheinander
im Kopf? N: (Stöhnt.) Wenn dunkel ist ... und wenn Montag ist ... K: Ja ...
da muß am Sonntag irgendwas passiert sein? N: Sonntag? K: Oder? Warum ist am
Montag immer alles so durcheinander
im
Kopf? N: Ich mag Sonntag nicht ... nicht mehr! Nee, nee, nee! K: So? Und
Samstag? N: Auch nicht!
Diese
beiden Transkriptionen können nur einen kleinen Teil dessen wiedergeben, was
die Videoaufnahmen zeigen: Mimik und Gestik der kleinen Nathalie, die
Unvollkommenheiten ihrer Sprache, ihr Zögern und Stottern, ihre Unruhe und
ihre Angst, wenn von den Wochenenden bei »der Frau« die Rede ist, die
Zeichen ihrer Liebe zu ihrer »Eerka«, ihr tiefes Glück bei ihren
Gesprächen mit dem lieben Gott, ihre Geborgenheit im Kinderheim - und ihr
Entsetzen bei jedem GedanKen an die schrecklichen Erlebnisse »daheim«. Doch
selbst die Videoaufnahmen können nur zeigen, was für den Zuschauer und
Zuhörer von außen erkennbar ist; sie lassen lediglich erahnen, was die
kleine Nathalie dabei erlebt. So sind also die oben geschilderten Dialoge
doppelte Transkriptionen, zweifache Transformationen und Abstraktionen der
Wirklichkeit des Wiedererlebens. Dennoch: Sie zeigen immerhin ein wenig von
dessen Vieldimensionalität; sie zeigen, wie beim Wiedererleben einer längst
vergangenen Zeit der Organismus sogar seinen kognitiven Zustand von damals
annimmt und Wortschatz wie Sprech- und Denkfertigkeiten einer Zwei- oder
Dreijährigen offenbaren kann. Und nicht zuletzt lassen diese Protokolle
erahnen, wie dürr, abstrakt, »kopfig«, lückenhaft und eindimensional
kognitive Erinnerungen im Vergleich zum Wiedererleben sind.
89
5.4
Motorische Fähigkeiten beim Wiedererleben
Unter
Motorik versteht man die Bewegungen des Körpers und der Körperteile, die
weitgehend bewußt kontrolliert oder zumindest bewußt eingeleitet werden und
dann, je nach Übung, mehr oder weniger automatisch, fast reflexartig
ablaufen. Die elementaren Bewegungsfähigkeiten des Menschen werden auch
Willkürmotorik genannt. Sie entfalten sich in den ersten 15 Lebensmonaten und
können beim Wiedererleben reproduziert (bzw. falls sie noch fehlen, eben
nicht reproduziert) werden oder zumindest vom Therapeuten erfragt werden. Wenn
eine Person zum Beispiel ihr frühes Säuglingsstadium wiedererlebt, dann ist
sie nicht in der Lage, sich zu drehen; sie kann nicht anders als auf dem
Rücken liegen, allenfalls den Kopf heben und Arme und Beine bewegen. Dagegen
kann man beim Wiedererleben späterer Phasen sehr oft Krabbel- oder
Laufbewegungen beobachten. Aus den Wahrnehmungen und Auskünften kann daher
auf das gerade wiedererlebte Alter geschlossen werden.
Die normale Entwicklung
der Willkürmotorik verläuft etwa wie folgt:
90
Beispiel:
Ein
Therapeut sagte zu einem Patienten, der sich gerade im Mutterleib »befand«,
er möge (in der Zeit) vorangehen - und erhielt prompt die Antwort: »Ich kann
doch noch nicht gehen!« (Seither vermeiden wir solche Anweisungen und sagen
lieber etwa: »Die Zeit vergeht... ein Tag ... noch ein Tag ...)
Bei
den komplexeren Bewegungsabläufen, die ein hohes Maß von (erst
einzuübender) Koordination erfordern, spricht man auch von Psychomotorik;
dazu gehören die mimischen und gestischen Bewegungen (die zur individuellen
Gewohnheit werden können und dann hochgradig reflexartig verlaufen) und
Bewegungsabläufe wie Schwimmen, Schreiben, Radfahren, Klavierspielen usw.
Letztere werden auch psychomotorische Fähigkeiten genannt. Beim Wiedererleben
eines früheren Geschehens verfügt die Person über genau die
psychomotorischen Fähigkeiten, die sie seinerzeit hatte.
Beispiel:
Barbara
wiedererlebte ein sehr unangenehmes Geschehen aus ihrer Kindheit. Unmittelbar
danach wird sie von ihrer Begleiterin gebeten, über das Erlebte zu sprechen.
Sie will dies aus Scham nicht tun. »Magst du es vielleicht aufschreiben?«
Mit der für solche Situationen charakteristischen reflexartigen Schnelligkeit
kam etwas barsch die Antwort: »Ich kann doch noch nicht schreiben!« Bald
stellte sich heraus, daß Barbara damals erst drei Jahre alt war.
Im
Vergleich zu den in den vorangegangenen Abschnitten behandelten Fähigkeiten
spielen die motorischen Fähigkeiten beim Wiedererleben eine nur bescheidene
Rolle. Immerhin ist wichtig, daß sie wie alle anderen Fähigkeiten und
Zustände wiedererlebt werden können. Das Wiedererleben ist also ein
ganzheitlicher, alle Eigenschaften, Fähigkeiten und Zustände des Organismus
umfassender und sie darstellender, reproduzierender Vorgang. Dies wird um so
deutlicher, je genauer man die Eigenschaften des Wiedererlebens studiert, und
um so deutlicher wird auch, wie sehr es sich vom kognitiven Erinnern
unterscheidet. Dies im einzelnen immer wieder erneut nachzuweisen und
festzuhalten, erschien eben so notwendig, wie es - leider - für die Leserin
und den Leser ermüdend gewesen sein mag.
*
91
6.
Vorläufige Zusammenfassung
Aufgrund
der bisher beschriebenen Beobachtungen läßt sich folgende Zwischenbilanz
ziehen:
1.
Das von der Posttraumatischen Belastungsstörung bekannte Symptom des
Wiedererlebens einer früheren traumatischen Situation (durch eine entfernt
ähnliche Situation initiiert oder spontan in Alpträumen auftretend) weist
auf eine besondere Fähigkeit des menschlichen Organismus hin, die jedoch in
diesem Zusammenhang als belastende Störung registriert wird.
2.
Beobachtungen im Alltag und verbreitete Hinweise in der biographischen
Literatur deuten darauf hin, daß das Wiedererleben zumindest ansatzweise auch
unter normalen Umständen auftreten kann und keineswegs nur traumatische
Situationen betrifft. Auch dabei wird es im allgemeinen durch situative
Ähnlichkeiten angeregt (siehe Schema 2 auf Seite 93).
3.
Beobachtungen in psychotherapeutischen Sitzungen mit einer speziellen Methode,
die ich »Begleitetes Systematisches Wiedererleben« nenne, zeigen, daß das
Wiedererleben systematisch eingeleitet und psychotherapeutisch genutzt werden
kann. Auf diese Weise können sowohl spontan auftauchende frühere Erlebnisse
(auch solche mit nichttraumatischem Inhalt) als auch ganz bestimmte, gezielt
ausgewählte Geschehnisse wiedererlebt werden. Diese können aus allen
Lebensabschnitten der Person stammen, vom frühen pränatalen Zustand bis zur
Gegenwart.
Das
Prädikat »systematisch« im Namen der Methode soll darauf hinweisen, daß
-
das Wiedererleben systematisch eingeleitet wird,
-
die wiederzuerlebenden traumatischen Geschehnisse oft nach ihrer
Zusammengehörigkeit systematisch ausgewählt werden, und
-
das Wiedererleben ein und desselben Traumas so lange wiederholt wird, bis das
»Protokoll« gelöscht ist und das Trauma nicht mehr wiedererlebt werden
kann.
4.
Während des Begleiteten Wiedererlebens konnte wiederholt beobachtet werden,
daß Kinder innerhalb eines früheren Erlebnisses (das gleichsam die
Rahmenhandlung für das Folgende bildet)
92
ein
noch früheres Geschehen wiedererlebten (»Wiedererleben ir Wiedererleben«,
siehe Schema 3 auf Seite 94), was zeigt, daß in de Kindheit Wiedererleben
eine verbreitete Erscheinung ist. Die wurde auch durch Beobachtungen meiner in
Kindergruppen ai beitenden Mitarbeiterinnen bestätigt, daß auf eine
situative Anre gung hin Kinder häufiger in ein früheres Geschehen »zurückfal
len« und dieses wiedererleben. Ich bin überzeugt, daß Eltern un Erzieher
ebenfalls diese Beobachtungen machen würden, wenn si von dem Phänomen des
Wiedererlebens wüßten.
Schema
2: Situativ angeregtes Wiedererleben (Wiedererleben im Alltag oder
»Wiedererleben im Erleben«)
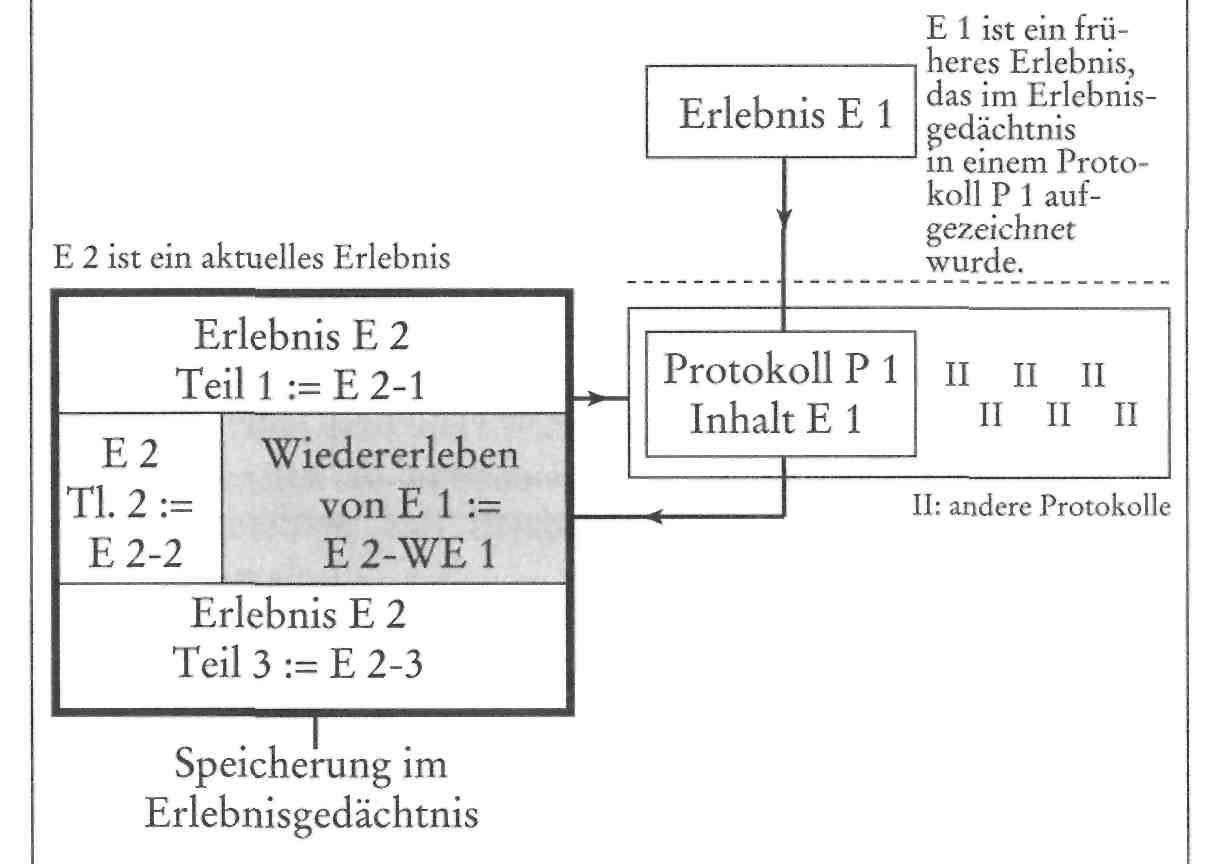
Irgendeine
Wahrnehmung im 1. Teil von E 2 regt durch eine situative Ähnlichkeit über
das Protokoll P 1 das Wiedererleben des Erlebnisses E 1 an (»Situative
Anregung«). Dieses Wiedererleben wird Bestandteil des Erlebnisses E 2.
Gleichzeitig wird die Wahrnehmung des aktuellen Geschehens (vermindert)
fortgesetzt (E 2, Teil 2 := E 2-2). Im allgemeinen folgt danach noch ein 3.
Teil des Erlebnisses E 2 (E 2-3). Das gesamte Erlebnis E 2 wird im
Erlebnisgedächtnis gespeichert.
93
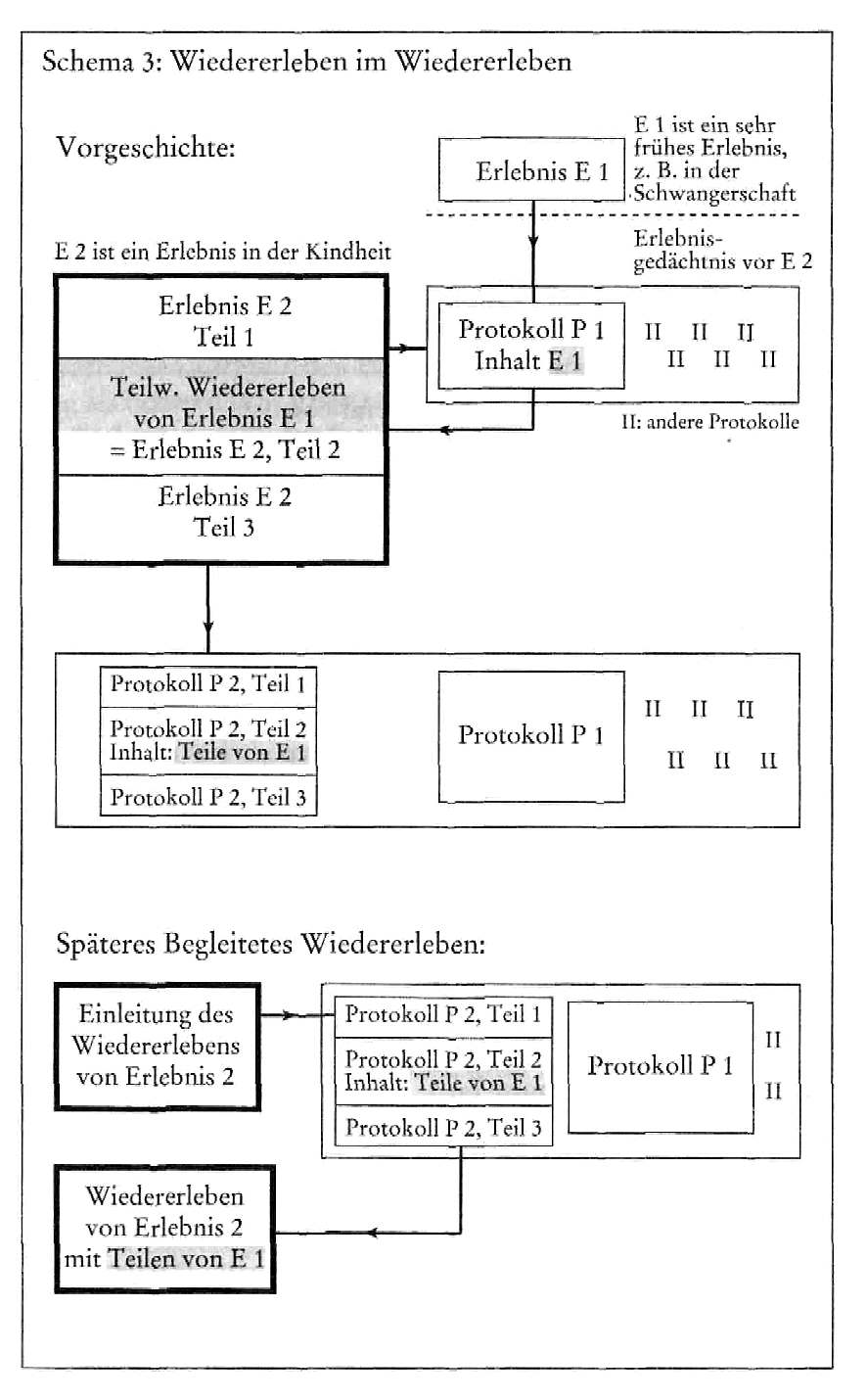
94
Wiedererleben
unterscheidet sich in Inhalt, Qualität und Quantität der Reproduktionen
sowie im subjektiven Erleben der Person (neuerliches Erleben vs. abstrakte
kognitive Erinnerung) radikal und total vom hinlänglich bekannten kognitiven
Erinnern an frühere Erlebnisse.
Daher
ist evident, daß es sich beim Wiedererleben um einen völlig anderen Prozeß
als beim kognitiven Erinnern handeln muß. Der darauf folgende, naheliegende
Schritt ist die Hypothese, daß den beiden so verschiedenen Prozessen
Wiedererleben und kognitives Erinnern zwei ebenso verschiedene
»Datenspeicher«, also Gedächtnisse (»Erlebnisgedächtnis« vs. kognitives
Gedächtnis). entsprechen und schließlich auch zwei verschiedene Speicheroder
Einprägungsvorgänge (»Erlebnislernen« vs. kognitives Lernen). Für diese
Annahmen sprechen folgende Beobachtungen:
•
Erlebnislernen ist unabhängig vom Vorhandensein und vom Funktionieren des
Bewußtseins und des kognitiven Gedächtnisses, beides unbedingte
Voraussetzungen des kognitiven Lernens.
•
Erlebnislernen erfolgt mühelos, ohne Absicht und ohne Willensanstrengung mit
sehr viel größerer Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit als kognitives Lernen.
(Da der Begriff »Lernen« sehr leicht mit absichtlichem und meist
anstrengendem [kognitiven] Lernen assoziiert wird, erinnere ich nochmals
daran, daß Erlebnislernen so unbeabsichtigt, mühelos und beiläufig zum
Erleben erfolgt, daß Erleben und Erlebnislernen untrennbar verbunden sind.)
•
Erlebnislernen umfaßt nicht nur die Wahrnehmungen der äußeren, sondern auch
die der inneren Sinne. Letztere werden oft gar nicht bewußt registriert, zum
Teil können sie überhaupt nicht bewußt wahrgenommen werden.
•
Beim Wiedererleben können auch die ursprünglichen Reaktionen des Organismus
auf (äußere wie innere) Sinneswahrnehmungen und die sich daraus ergebenden
Körperzustände reproduziert werden. Bestandteil dieser Dimension des
Wiedererlebens ist es, daß der frühere Körperzustand nachgebildet wird, und
zwar
-
im Körper: innere Schmerzen, Störungen des Gleichgewichtssinns, Übelkeit
..., Körpertemperatur, Blutdruck, Pulsfrequenz, Tonuslage des vegetativen
Systems, Koliken, Schüttelfrost ...