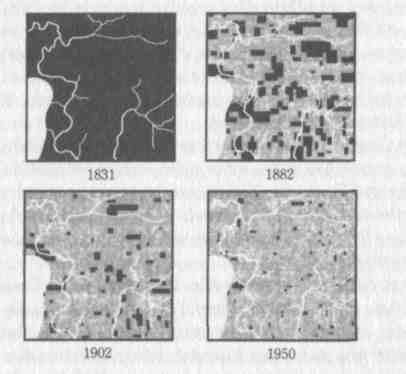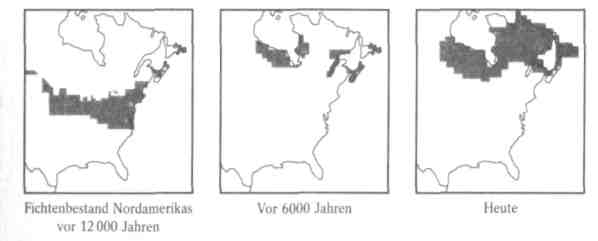Mit
<Welt> meinte Wordsworth
in seiner berühmten Klage natürlich die menschliche Sphäre, die schon 1806
ihre Bürger zu umschließen, einzuschließen und völlig zu absorbieren
schien. Mit <Natur> meinte er den Rest des Planeten.
Nach
fast zwei Jahrhunderten des Nehmens und Gebens müssen wir eine neue
Klage anstimmen:
Wenig
von dem, was wir in der Natur erblicken, ist nicht unser. Die Welt ist
zuviel für uns; auf eine Art, die über das hinausgeht, was Wordsworth
meinte. Am Nordpol, über dem Pazifik und über dem antarktischen Eis ist die
Atmosphäre mit Kohlenstoff, Schwefel, Stickstoff, Phosphor und Chlor belastet
— durch uns. Es sind jetzt Löcher im Himmel, und das Sonnenlicht, das durch
sie scheint, ist nicht mehr so gutartig, wie es zu Wordsworth' Zeiten war.
Dieses harte neue Licht ist ebenfalls unser Werk. Das Wetter selbst droht,
sich zu ändern, und wenn es sich ändert, wird eine neue Abfolge der
Jahreszeiten von uns verursacht worden sein.
Sogar
die grüne Biosphäre liegt inzwischen weitgehend in unserer Hand, ist Teil
unserer Welt des Nehmens und Gebens.
Ökologen
schätzen, daß die Pflanzen aller Kontinente durch Photosynthese jährlich
mehr als hundert Milliarden Tonnen organische Materie produzieren. Diese
bezeichnen sie als »irdische Netto-Primärproduktion« und legen sie bei
ihrer globalen Buchführung zugrunde. Einer Studie
des Ökologen Peter Vitousek und seiner Kollegen an der Stanford University
zufolge macht das, was die Menschen jährlich entweder selbst essen oder an
ihre Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine verfüttern oder für Nutz- und
Feuerholz niederschlagen, jährlich etwa vier Milliarden Tonnen dieser
Primärproduktion aus.
Vier
Milliarden Tonnen von hundert entsprechen vier Prozent. Das allein ließe sich
noch rechtfertigen, da wir die dominierende Rasse auf diesem Planeten sind.
Aber wenn wir die Biomasse hinzuzählen, die wir verbrennen, wenn wir das Land
bestellen, und die wir wegwerfen, wenn wir Korn dreschen und Baumwolle zupfen,
wenn wir zudem die brachliegenden Felder in Betracht ziehen, dann kommen wir
Vitousek und seinen Kollegen zufolge auf eine Summe von dreißig Milliarden
Tonnen Netto-Primärproduktion, die allein im Rahmen des Lebens und
Wirtschaftens der Menschen anfallen. Dreißig Prozent der Gesamtproduktion
also.
Wenn
wir den Betrag an organischer Materie oder Biomasse mitrechnen, die der Planet
preisgibt, wenn wir jedes Jahr mehr und mehr Land für Felder und Weiden,
Hausbauplätze, Parkplätze, Dorf- und Stadtstraßen hinzunehmen, beträgt
unser Anteil (zuzüglich des ganzen Kohlenstoffs, den wir verbrauchen und an
dessen Neuschaffung wir die Biosphäre hindern) jährlich annähernd vierzig
Milliarden Tonnen der Netto-Primärproduktion. Vierzig Prozent.
Demographen
rechnen mit einer Verdoppelung der menschlichen Bevölkerung in den nächsten
hundert Jahren, von mehr als fünf Milliarden heute auf zehn Milliarden im
Jahre 2100. Wie der Ökologe Paul
Ehrlich bemerkt, »impliziert das den Glauben, daß unsere Spezies
ohne Gefährdung achtzig Prozent der Netto-Primärproduktion verbrauchen
kann«.
Der
Geschäftsmann in uns mag sich fragen, wie er an die restlichen zwanzig
Prozent kommen kann. Aber wir sollten entsetzt sein. Die meisten der
Veränderungen, die wir in der natürlichen Ordnung vorgenommen haben, haben
sich seit der Klage Wordsworth' 1806 vollzogen. Aus unserer Sicht ist das eine
lange Zeit, aus der Sicht des Planeten ist seitdem kaum Zeit vergangen. Die
meisten dieser Veränderungen waren zudem kumulativ, und ob sie nun zuerst in
der Luft, im Meer oder auf dem Land auftraten, sie alle ändern die
Bedingungen für das Leben auf der Erde.
Solche
plötzlichen globalen Veränderungen betreffen die Grundlinie, die äußerste
Grundlinie, die durch die geologischen Schichten unter unseren Füßen
repräsentiert wird. Diese Felsschichten sind voller fossiler Überreste von
Arten, die nach kurzen Streßperioden ausstarben. In der Wissenschaft der
Veränderung könnte dies das einzige
unveränderliche Gesetz sein: Alle globalen Veränderungen führen zur
Auslöschung von Arten.
*
(d-2015:) P.Ehrlich bei
detopia