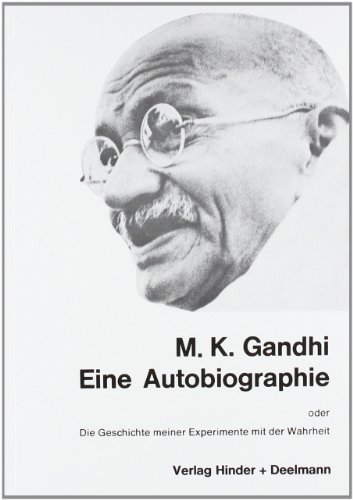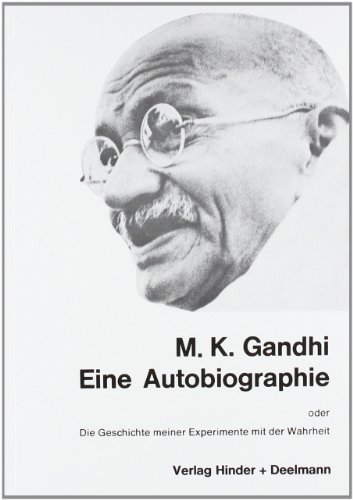
11 - Gedanken über Gandhi
1949 by George Orwell in <Partisan Review>, Januar 1949
159-170
Heilige sollte man immer für schuldig halten, solange nicht ihre Unschuld erwiesen ist — aber die Maßstäbe, die man dabei anlegen muß, sind natürlich nicht in allen Fällen die gleichen.
Im Falle Gandhi ist man geneigt zu fragen, wie weit er von Eitelkeit bestimmt wurde (dem Bewußtsein seiner selbst als eines bescheidenen, nackten, alten Mannes, der auf einer Gebetmatte sitzt, imstande, Imperien durch die Kraft seines Geistes ins Wanken zu bringen) und wieviel er von seinen eigenen Prinzipien opferte, als er sich auf die Politik einließ, die ihrem Wesen nach untrennbar mit Gewalt und Betrug verbunden ist. Um das abschließend zu beantworten, müßte man Gandhis Handeln und seine Schriften bis ins letzte Detail studieren, denn sein ganzes Leben war eine Art Pilgerfahrt, bei der jeder Umstand von Bedeutung war.
Der erste Teil seiner Autobiographie, der mit den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts schließt, spricht stark zu seinen Gunsten, und zwar um so mehr, als er den Abschnitt umfaßt, den Gandhi als <nicht regenerierte Epoche seines Lebens> bezeichnen würde, und einen daran erinnert, daß in dem Heiligen oder Quasi-Heiligen ein kluger, vielseitig begabter Mensch steckte, der, wenn er gewollt hätte, als Anwalt, Verwaltungsbeamter oder sogar als Geschäftsmann eine brillante Karriere hätte machen können.
Etwa um die Zeit, als die Autobiographie* zum ersten Mal erschien, las ich, wie ich mich erinnere, das Anfangskapitel auf den schlecht gedruckten Seiten einer indischen Tageszeitung. Es machte einen guten Eindruck auf mich, den Gandhi damals nicht machte.
* <Die Geschichte meiner Erfahrungen (Experimente) mit der Wahrheit> von M.K.Gandhi, übersetzt aus dem Gujarati von Mahadev Desai.
Alles, was sich mit ihm verband — selbstgesponnene Kleidung, ›seelische Kräfte‹ und vegetarische Nahrung —, bot keinen großen Reiz, und sein mittelalterlich anmutendes Programm war offensichtlich für ein rückständiges, hungerndes, überbevölkertes Land nicht das richtige.
Es war weiter klar, daß die Engländer ihn benutzten oder es mindestens glaubten. Genaugenommen war er als Nationalist ihr Feind, aber da er in jeder Krise sich dafür einsetzen würde, Gewalttätigkeiten zu verhindern — was vom englischen Standpunkt dasselbe war, wie die Unterbindung jeder wirksamen Aktion —, sah man in ihm ›unsern Mann‹. Im privaten Gespräch wurde das manchmal mit zynischer Offenheit zugegeben.
Die Haltung der indischen Millionäre war ähnlich. Gandhi rief sie zur Buße auf, und natürlich war er ihnen lieber als die Sozialisten und Kommunisten, die ihnen bei der ersten Gelegenheit ihr Geld abgenommen hätten. Wie zuverlässig solche Kalkulationen auf lange Sicht sind, bleibt fraglich, meint doch Gandhi selbst, daß »am Ende die Betrüger nur sich selber betrügen«. Wie dem auch sei, die Zuvorkommenheit, mit der er fast immer behandelt wurde, ging zum Teil auf die Annahme zurück, daß er nützlich sei. Die englischen Konservativen wurden erst wütend auf ihn, als er, wie 1942, seine Gewaltlosigkeit tatsächlich auch einem anderen Eroberer gegenüber zur Anwendung brachte.
Aber selbst damals konnte ich beobachten, daß die Regierungskreise, die gewöhnlich halb belustigt, halb ablehnend über ihn sprachen, ihn aufrichtig gern hatten und bewunderten, je nach Lage der Dinge. Nie wurde der Verdacht laut, er sei korrupt oder im gewöhnlichen Sinne ehrgeizig, oder irgendeine seiner Handlungen sei von Furcht oder Böswilligkeit bestimmt. Bei der Beurteilung eines Mannes wie Gandhi legt man scheinbar strenge Maßstäbe an, so daß einige seiner besten Eigenschaften so gut wie unbemerkt blieben.
160
So wird schon aus der Autobiographie ersichtlich, daß er von Natur aus ungewöhnlichen Mut besaß. Dafür war die Art, wie er starb, später ein weiterer Beweis. Jeder im öffentlichen Leben stehende Mann, der seiner persönlichen Sicherheit auch nur das geringste Interesse beimaß, hätte sich sorgfältiger geschützt. Er dagegen scheint völlig frei von dem, schon an Verfolgungswahn grenzenden Mißtrauen gewesen zu sein, das wie E. Forster in <A Passage to India>* richtig bemerkt, das hervorstechende indische Übel ist — so wie Heuchelei das englische.
Er war ohne Zweifel wach genug, um die Unehrlichkeit zu bemerken, hat aber scheinbar angenommen, daß der Mensch von Natur gut war und man diese Seite nur anzusprechen brauchte. Obwohl er aus armer Familie stammte und sein Leben unter ungünstigen Voraussetzungen begann, auch seiner Erscheinung nach eher unansehnlich war, lagen ihm Neid oder Minderwertigkeitsgefühle fern.
Als er zum ersten Mal in Südafrika das Rassenproblem in seiner schlimmsten Form kennenlernte, scheint er eher etwas wie Verwunderung empfunden zu haben. Selbst als er einen Kampf führte, der in Wahrheit ein Rassenkampf war, beurteilte er nie Menschen nach ihrer Rassenzugehörigkeit oder Hautfarbe. Der Gouverneur einer Provinz, ein Baumwollmillionär, ein halbverhungerter Drawidischer Kuli, ein englischer gemeiner Soldat — sie alle waren für ihn unterschiedslos menschliche Wesen, die ziemlich auf die gleiche Weise ansprechbar waren. Bemerkenswert ist, daß ihm selbst unter den denkbar schlechtesten Umständen, in Südafrika, wo er sich zum Wortführer der indischen Kolonie machte, seine europäischen Freunde nicht untreu wurden.
In kurzen Abschnitten für Zeitungsfortsetzungen geschrieben, ist die Autobiographie kein literarisches Meisterwerk, aber um so eindrucksvoller dank der Banalität eines Großteils des darin enthaltenen Materials.
* <Auf der Suche nach Indien>, erschienen 1921.
161
Man tut gut, daran zu erinnern, daß Gandhi mit den üblichen Ambitionen indischer Studenten ins Leben trat und seine radikalen Anschauungen nur schrittweise und in manchen Fällen fast gegen seinen Willen annahm. Es ist interessant, daß es eine Zeit gab, in der er einen Zylinder trug, Tanzstunden nahm, Französisch und Lateinisch lernte, auf den Eiffelturm fuhr und sogar Violine spielte, alles mit dem Gedanken, sich der europäischen Zivilisation so vollständig wie möglich anzupassen. Er gehört nicht zu den Heiligen, die sich bereits von klein auf durch ungewöhnliche Frömmigkeit auszeichnen, und ebensowenig zu denen, die nach sensationellen Ausschweifungen der Welt entsagen. Er gesteht rückhaltlos seine Jugendsünden, aber in Wirklichkeit ist da nicht viel zu gestehen.
Auf der Titelseite des Buches befindet sich eine Photographie, die alle Habseligkeiten Gandhis zur Zeit seines Todes zeigt. Das Ganze ist kaum mehr wert als fünf Pfund, und wenn man all seine Sünden, wenigstens seine fleischlichen, auf einen Haufen zusammengetragen hätte, würden sie wohl seiner irdischen Habe entsprochen haben. Ein paar Zigaretten, einige Bissen Brot und Fleisch, ein paar in seiner Kindheit der Dienstmagd gestohlene Annas, zweimal der Besuch eines Bordells (beide Male ohne Erfolg), ein gerade eben noch vermiedener Sündenfall mit seiner Wirtin in Plymouth, ein Wutanfall, das ist ungefähr alles.
Schon als Kind war er außerordentlich ernst, eher ein ethischer als religiöser Wesenszug, aber bis zu seinem 30sten Lebensjahr hat seine Entwicklung noch keine endgültige Richtung genommen. Sein erstes Auftreten in so etwas, wie dem öffentlichen Leben, hing mit seinem Vegetariertum zusammen. Unter seinen weniger bürgerlichen Fähigkeiten spürt man die ganze Zeit die soliden Geschäftsleute aus dem Mittelstand, die seine Vorfahren waren.
Man fühlt, daß er selbst zu einer Zeit, in der er bereits jeden persönlichen Ehrgeiz verloren hatte, ein einfallsreicher, energischer Anwalt gewesen sein muß und dazu ein zielbewußter politischer Organisator, immer sorgsam darauf bedacht, die Ausgaben niedrig zu halten, ein geschickter Komiteevorsitzender und unermüdlicher Sammler von Unterschriften.
162
Sein Charakter war außergewöhnlich komplex, wies aber nichts auf, was man hätte aufzeigen und schlecht nennen können. Ich glaube, auch Gandhis erbitterte Feinde werden zugeben müssen, daß er ein besonderer, interessanter Mann war, der die Welt durch sein bloßes Dasein bereicherte. Ob er auch ein liebenswerter Mensch war, und ob seine Lehren irgendeinen Wert für diejenigen besitzen, die jeden religiösen Glauben ablehnen, dessen bin ich nie ganz sicher gewesen.
In späteren Jahren war es üblich, von Gandhi so zu sprechen, als ob er nicht nur mit der westlichen linken Bewegung sympathisiere, sondern ihr geradezu als Mitglied angehöre. Anarchisten und Pazifisten haben ihn besonders für sich in Anspruch genommen, wobei sie auf seine Ablehnung jeder Art von Zentralismus und jeglicher Staatsgewalt verwiesen, jedoch geflissentlich die transzendenten und antihumanistischen Tendenzen seiner Lehre übersahen.
Ich meine, man sollte sich darüber klar sein, daß sich Gandhis Lehren nicht mit dem Grundprinzip in Einklang bringen lassen, wonach der Mensch das Maß aller Dinge ist.
Unsere Aufgabe besteht darin, das Leben auf dieser Erde lebenswert zu machen, dem einzigen Wirkungsbereich, den wir haben. Seine Lehren haben nur Sinn in der Annahme, daß Gott existiert, und daß die reale Welt eine Illusion ist, der man entfliehen sollte. Es lohnt sich, die Vorschriften näher zu untersuchen, die Gandhi sich auferlegte und die er — auch wenn er vielleicht nicht von jedem seiner Anhänger die genaueste Einhaltung verlangte — für unerläßlich hielt, wenn man Gott und der Menschheit dienen wollte.
An erster Stelle stand das Verbot des Genusses von Fleisch und, wenn möglich, jeder Art von Nahrung, die von Tieren stammte. (Gandhi selbst mußte allerdings aus Gesundheitsrücksichten einen Kompromiß in bezug auf Milch schließen, scheint es aber immer als einen Rückfall empfunden zu haben).
163
Weiter keinen Alkohol oder Tabak, keine Gewürze oder Zutaten, selbst nicht einmal aus dem Pflanzenreich, da man nicht um des Essens willen essen sollte, sondern nur um sich bei Kräften zu halten. Zweitens, möglichst kein Geschlechtsverkehr, war das unumgänglich, dann nur zu dem Zweck, Nachkommen zu zeugen, und deshalb nur in langen Abständen.
Mitte dreißig legte Gandhi selbst das Gelübde des <Bramahcharya> ab, was nicht nur völlige Keuschheit bedeutet, sondern die Ausschaltung aller sexuellen Begierden. Diese Bedingung ist, wie mir scheint, ohne eine entsprechende Diät und häufiges Fasten schwer zu erfüllen. Eine der Gefahren des Milchtrinkens besteht darin, daß es sexuelle Begierden hervorrufen kann. Und schließlich — und das ist der wesentlichste Punkt für den Gottsucher —, er darf für niemanden besondere Freundschaft oder Liebe empfinden.
Enge Freundschaften sind gefährlich, sagt Gandhi, weil »Freundschaft und Freunde einander beeinflussen« und weil man durch die Ergebenheit einem Freunde gegenüber zu falschen Handlungen verleitet werden kann. Das ist unbestreitbar richtig. Mehr noch — dient man Gott oder der Menschheit als Ganzem, kann man nicht einem einzelnen Menschen den Vorrang geben. Auch das ist richtig, und es bezeichnet den Punkt, an dem die humanistische und die religiöse Weltanschauung nicht mehr in Einklang zu bringen sind.
Liebe besagt dem gewöhnlichen Menschen nichts, wenn man nicht einen Menschen mehr liebt als andere. Aus der Autobiographie geht nicht deutlich hervor, ob Gandhi sich seiner Frau und seinen Kindern gegenüber rücksichtslos benahm. Fest steht jedoch, daß er bei drei Gelegenheiten lieber seine Frau und eins seiner Kinder hätte sterben lassen, als ihnen die vom Arzt verschriebene Nahrung tierischen Ursprungs zu verabreichen.
164
Ebenso ist sicher, daß der Tod in diesen Fällen nicht eintrat und ebenso, daß Gandhi — allerdings unter moralischem Druck in entgegengesetzter Richtung — dem Kranken die Wahl überließ, ob er durch die Begehung einer Sünde sein Leben retten wollte. Dennoch, hätte die Entscheidung allein bei ihm gelegen, hätte er ohne Rücksicht auf das damit verbundene Risiko die Verabreichung von tierischer Kost verboten. Für unser Handeln, sagt er, muß es eine Grenze geben bis zu der wir gehen, um am Leben zu bleiben, und diese Grenze verläuft ein beachtliches Stück diesseits von Hühnerbrühe.
Diese Einstellung mag edel sein; aber in dem Sinne, den, wie ich glaube, die meisten Menschen dem Wort beilegen, ist sie unmenschlich. Das Wesentliche des Menschseins liegt darin, nicht Vollkommenheit anzustreben, sondern bereit zu sein, um der Treue zu einem Menschen willen auch eine Sünde zu begehen, das Asketentum nicht so weit zu treiben, daß jede freundschaftliche Verbundenheit unmöglich wird, und sich darauf gefaßt zu machen, am Ende besiegt und mit leeren Händen dazustehen, der unvermeidliche Preis dafür, seine Liebe auf andere menschliche Einzelwesen fixiert zu haben.
Zweifellos sind Alkohol, Tabak usw. Dinge, die ein Heiliger meiden sollte, aber auch Heiligkeit ist etwas, was menschliche Wesen vermeiden sollten. Dafür gibt es eine einfache Widerlegung, aber man sollte sich hüten, sie zu machen. In diesem Yoga-besessenen Zeitalter ist man nur zu schnell mit der Annahme bei der Hand, daß es nicht nur besser ist, keine ›Bindungen‹ einzugehen, statt das irdische Leben in vollem Umfang zu bejahen, sondern daß der Durchschnittsmensch ausweicht, weil sie mit zu vielen Schwierigkeiten verbunden sind.
Mit anderen Worten, der Durchschnittsmensch ist ein verhinderter Heiliger. Es ist fraglich, ob das stimmt.
Viele Leute haben einfach nicht den Ehrgeiz, Heilige zu sein, und vermutlich haben einige, die Heiligkeit erlangten oder danach strebten, sich nie ernstlich versucht gefühlt, sich wie menschliche Wesen zu benehmen.
165
Wenn man der Frage bis zu ihrem psychologischen Ursprung nachginge, würde man meiner Meinung nach entdecken, daß die Hauptursache für das Nichteingehen von Bindungen in dem Wunsch liegt, der Last des Lebens zu entrinnen, vor allem der Liebe, die geschlechtlich oder nicht, immer ein schweres Stück Arbeit bleibt.
An dieser Stelle braucht das Problem nicht näher untersucht zu werden, ob das übersinnliche oder das menschliche Ideal ›höher‹ steht. Entscheidend ist, daß beide unvereinbar sind. Man muß sich für Gott oder den Menschen entscheiden, und alle ›Radikalen‹ und ›Progressiven‹, vom sanftesten Liberalen bis zum wildesten Anarchisten, haben sich für den Menschen entschieden.
Dennoch kann man Gandhis Pazifismus bis zu einem gewissen Grade von seinen andern Lehren trennen. Sein Ursprung war religiös, aber er beanspruchte für ihn auch den Rang einer fest umrissenen Technik, einer Methode, die angestrebte, politische Wirkung zu erzielen. Es war eine andere Haltung als die der meisten westlichen Pazifisten. Satyargraha, von Gandhi zuerst in Südafrika entwickelt, war eine Art gewaltloser Kriegführung, eine Form, den Gegner niederzuzwingen, ohne ihn zu verletzen und ohne dabei Haß zu empfinden noch zu wecken. Es umfaßte Dinge wie zivilen Ungehorsam, Streiks, das Blockieren von Bahnlinien durch Niederlegen auf die Schienen, Polizeiattacken durchzustehen ohne davonzulaufen und ohne zurückzuschlagen, und dergleichen mehr.
Gandhi war dagegen, Satyargraha mit »passiver Widerstand« zu übersetzen. Auf Gujarati scheint das Wort »Festigkeit in der Wahrheit« zu bedeuten.
Als junger Mann diente Gandhi als Krankenträger auf englischer Seite im Burenkrieg, und er war bereit, das gleiche im Krieg 1914-18 wieder zu tun. Selbst nachdem er sich völlig von jeder Gewaltanwendung losgesagt hatte, war er ehrlich genug zu gestehen, daß es notwendig sein könnte, in einem Krieg Partei zu ergreifen.
166
Er tat es, und konnte auch nicht anders, nachdem sein Kampf sich ausschließlich um die Gewinnung der nationalen Unabhängigkeit drehte, er bezog nicht die Linie steriler Unehrlichkeit, nach der in einem Krieg beide Seiten gleich viel wert sind, es also keinen Unterschied macht, wer gewinnt.
Ebensowenig zog er vor — im Gegensatz zu westlichen Pazifisten — unliebsamen Fragen auszuweichen. Im Zusammenhang mit dem letzten Krieg gab es eine Frage, zu der auch Pazifisten eine klare Antwort zu geben verpflichtet waren:
»Was ist mit den Juden?
Kann man ruhig zusehen, daß sie ausgerottet werden?
Wenn nicht, was schlagen Sie zu ihrer Rettung vor, ohne auf das Mittel des Krieges zurückzugreifen?«
Ich muß gestehen, daß ich von keinem Pazifisten im Westen eine ehrliche Antwort auf diese Frage gehört habe, dagegen eine Menge von Ausflüchten. Zufällig wurde an Gandhi eine sehr ähnliche Frage im Jahre 1938 gerichtet. Seine Antwort findet sich in Louis Fischers <Gandhi und Stalin>.
Danach vertrat Gandhi den Standpunkt, die deutschen Juden sollten kollektiv Selbstmord begehen, um die ganze Welt und das deutsche Volk gegen Hitlers Gewaltherrschaft aufzurütteln. Nach dem Krieg rechtfertigte er diese Ansicht mit den Worten, die Juden hätten sowieso den Tod gefunden und hätten daher auch um ihrer Sache willen freiwillig sterben können.
Man hat den Eindruck, daß eine solche Einstellung selbst einen so großen Gandhi-Bewunderer wie Fischer vor den Kopf stieß, aber Gandhi war nur ehrlich. Wenn man selber kein Leben auslöschen will, so muß man doch damit rechnen, daß das Leben auf andere Weise erledigt wird. Als er 1942 den gewaltlosen Widerstand gegen die Invasion der Japaner propagierte, gab er offen zu, daß das mehrere Millionen Menschenleben kosten könnte.
Man hat allen Grund zur Annahme, daß Gandhi, der schließlich 1869 geboren wurde, um diese Zeit das Wesen des Totalitarismus nicht begriff und alles unter dem Gesichtspunkt seines Kampfes gegen die englische Regierung sah. Der entscheidende Punkt dabei war nicht, daß die englische Regierung ihn mit Nachsicht behandelte, sondern daß er immer in der Lage war, sich Gehör zu verschaffen.
167
Wie aus dem oben zitierten Satz hervorgeht, glaubte er »die Welt aufrütteln zu können«. Das ist aber nur denkbar, wenn die Welt die Möglichkeit bekommt, über die betreffenden Vorgänge informiert zu werden. Man sieht nur schwer, wie Gandhis Absicht sich in einem Lande hätte durchführen lassen, in dem Gegner des Regimes mitten in der Nacht verschwanden, ohne daß man je wieder von ihnen hörte. Ohne Presse- und Versammlungsfreiheit ist es nicht nur unmöglich, an die Weltöffentlichkeit zu appellieren, sondern auch eine Massenbewegung auszulösen, ja nicht einmal dem Gegner den eigenen Standpunkt zur Kenntnis zu bringen.
Wäre in Rußland in diesem Augenblick ein Gandhi denkbar? Selbst wenn, was könnte er erreichen?
Wenn die gleiche Idee alle gleichzeitig ergriffe, könnten sie einen zivilen Ungehorsamkeitsfeldzug durchführen, aber nach den Erfahrungen mit der Hungersnot in der Ukraine, würde auch das nichts ändern. Aber angenommen, es ließe sich ein gewaltloser Widerstand gegen die eigenen Regierungen oder fremde Besatzungsmächte wirksam organisieren, wie will man das international zur Wirkung bringen?
Die Widersprüche in verschiedenen Äußerungen Gandhis über den letzten Krieg scheinen darauf hinzudeuten, daß er diese Schwierigkeiten gekannt hat. Auf die Außenpolitik angewandt, hört der Pazifismus entweder auf, pazifistisch zu sein, oder führt zur Unterwerfung. Überdies muß die Voraussetzung Gandhis, die sich im Umgang mit Einzelpersonen so erfolgreich erwies — daß nämlich Menschen mehr oder weniger auf ein großzügiges Entgegenkommen in der gleichen Weise antworten, ernstlich bezweifelt werden. Es ist zum Beispiel nicht unbedingt zutreffend, wenn man es mit Irren zu tun hat.
Dann erhebt sich die Frage: Wer ist normal? War Hitler normal? Und wäre nicht denkbar, eine ganze Kultur, gemessen an einer anderen, als anormal zu bezeichnen?
Und soweit man die Gefühle einer ganzen Nation messen kann: besteht irgendein nachweisbarer Zusammenhang zwischen einer großzügigen Handlung und einer freundschaftlichen Erwiderung darauf? Ist Dankbarkeit ein Element der internationalen Politik?
168/169
Diese und ähnliche Fragen bedürfen einer eingehenden Erörterung und zwar dringend, da uns vielleicht nur noch wenige Jahre bleiben, ehe jemand auf den Knopf drückt und die Raketen zu fliegen beginnen.
Es ist fraglich, ob die Zivilisation noch einen Weltkrieg überleben kann, und es wäre durchaus denkbar, daß der einzige Ausweg in der Gewaltlosigkeit liegt. Gandhi wäre bereit gewesen — und das gehört zu seinen besten Eigenschaften —, die oben von mir angeschnittenen Fragen einer ernsten Prüfung zu unterziehen, und wahrscheinlich hat er diese Fragen und ähnliche in einem seiner unzähligen Zeitungsartikel behandelt.
Man merkt, daß es vieles bei ihm gab, das er nicht verstand, aber es gab nichts, das er nicht zu sagen oder zu denken gewagt hätte.
Ich habe nie viel Sympathie für ihn aufbringen können, bin aber nicht sicher, ob er als politischer Denker in der Hauptsache nicht recht hatte. Ich glaube auch nicht, daß sein Leben verfehlt war. Als er dem Attentat zum Opfer fiel, erklärten viele seiner wärmsten Bewunderer sonderbarerweise, er habe lange genug gelebt, um sein Lebenswerk in Trümmer sinken zu sehen. In Indien tobte ein Bürgerkrieg, der als Nebenerscheinung des Machtüberganges vorauszusehen war.
Gandhi hatte sein Leben nicht mit dem Versuch verbracht, Hindus und Mohammedaner miteinander auszusöhnen. Sein politisches Hauptziel, die friedliche Beendigung der englischen Herrschaft, hatte er schließlich erreicht. Wie gewöhnlich deckten sich die entscheidenden Faktoren. England zog sich kampflos aus Indien zurück, ein Vorgang, den nur wenige politische Beobachter ein Jahr vorher vorausgesagt haben würden. Anderseits war es eine Labour-Regierung, die den Entschluß faßte. Eine konservative Regierung, besonders eine unter der Führung von Churchill, hätte mit Sicherheit anders gehandelt.
Wenn es aber um 1945 in England eine breite öffentliche Strömung zugunsten der Unabhängigkeit Indiens gab, so muß man fragen, ob dieses nicht weitgehend der persönliche Einfluß Gandhis war. Und falls Indien und England — was eintreten könnte — schließlich zu einem anständigen, freundschaftlichen Verhältnis gelangen sollten, wird das dann nicht zum Teil Gandhis Verdienst sein, der seinen Kampf unbeirrt, ohne Haß führte und die politische Atmosphäre entgiftete?
Daß es überhaupt möglich ist, solche Fragen zu stellen, deutet seine Größe an.
Man mag, wie ich etwa, eine Art ästhetischer Abscheu für Gandhi haben, man mag es ablehnen, ihn für einen Heiligen zu halten, wofür viele eintreten (er selbst hat übrigens nie den Anspruch erhoben), man mag weiter Heiligkeit als Ideal ablehnen und deshalb die Ansicht vertreten, daß Gandhis Hauptziele antihuman und also reaktionär waren, aber als Politiker, verglichen mit anderen politischen Führern unserer Zeit, welch sauberen Geruch hat er hinterlassen!
169-170
#