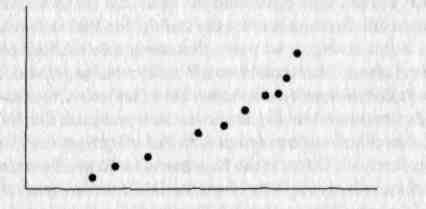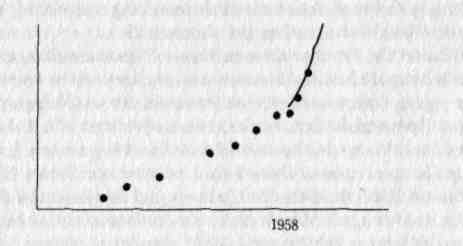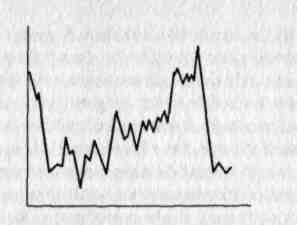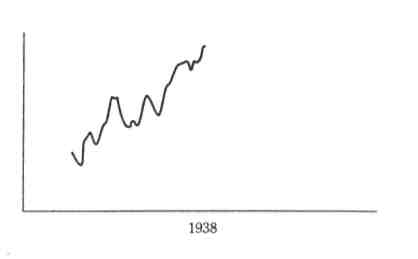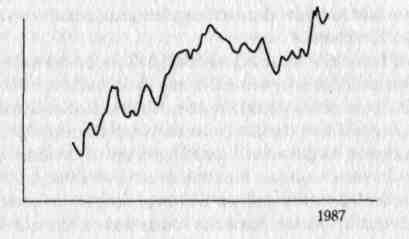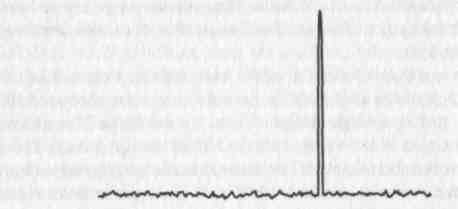Start Fußnoten
Weiter
5. Langsames Heureka
Vorzeichen
bedeuteten ihm nichts, und er war unfähig, die
Botschaft
der Prophezeiung
zu entziffern, bis die Erfüllung
sie direkt
vor seine Tür gebracht hatte. -
Joseph
Conrad
69-102
Man
gerät ins Staunen, wenn man liest, was Menschen zu Beginn des
Treibhauseffekts über ihn gedacht haben. In seinem populären, 1906
veröffentlichten Buch <Das Werden der Welten> hieß der
schwedische Chemiker Svante Arrhenius
die Wärme noch willkommen. »Durch Einwirkung des erhöhten
Kohlensäuregehalts der Luft hoffen wir, uns allmählich Zeiten mit
gleichmäßigeren und besseren klimatischen Verhältnissen zu nähern,
besonders in den kälteren Teilen der Erde...«
In
einer (damals unbekannten, heute oft zitierten) 1938 erschienenen Arbeit
verkündete der englische Ingenieur George
Callendar, daß sich die Temperatur der Erde bereits erhöhe.
Fast niemand erwähnt je Callendars Fazit: Er erklärte, das Kohlendioxid, das
wir in die Luft abgäben, verbessere nicht nur das Weltklima, sondern ließe
außerdem alle Feldfrüchte besser gedeihen. »Jedenfalls«, schrieb
Callendar, »sollte die Wiederkehr der tödlichen Eiszeiten um unbestimmte
Zeit aufgeschoben sein.«
en.wikipedia
Guy_Stewart_Callendar wikipedia
Guy_Stewart_Callendar
1957
veröffentlichten Revelle
und Suess die berühmten Zeilen,
die ich schon zitiert habe. »Die Menschen führen ein langfristiges
geophysikalisches Experiment einer Art aus, die in der Vergangenheit nicht
möglich gewesen wäre und in der Zukunft nicht wiederholbar sein wird«,
schrieben Revelle und Suess. »Das Experiment könnte«, fügten sie
hinzu, »wenn es entsprechend dokumentiert würde, eine tiefe Einsicht in
die Prozesse gewähren, die Wetter und Klima bestimmen.«
Heute
werden diese Worte meist als Warnung verstanden. Ein Autor nannte sie vor
kurzem eine »morbide Untertreibung«. Mit unserem jetzigen Wissen
fällt es uns schwer, sie anders zu lesen. Aber die Worte des Berichts sind
bestenfalls neutral; Revelle selbst hat bekannt, daß er nicht wirklich über
den Treibhauseffekt besorgt war, als er sie schrieb. Er hatte sie
hauptsächlich aus reiner wissenschaftlicher Begeisterung zu Papier gebracht. Er
und Suess waren froh darüber gewesen, daß dieses Experiment zu ihren
Lebzeiten stattfand und sie Zeugen sein konnten.
Wir
wissen schon sehr lange davon, aber wir haben es erst vor ganz kurzer Zeit
verstanden. Seit Arrhenius wußten die Menschen einfach nicht, was sie sahen.
Und es gab auch keinen einzelnen Augenblick, in dem jemand <Heureka!>
rief. Es gab nur etwas, das ein Student, der sich mit dem Treibhauseffekt
beschäftigte, »die Entwicklung eines Bewußtseins« nannte.
In
den sechziger Jahren zum Beispiel ermöglichten neue
Geräte den Forschern, mit der Überprüfung der Hypothese Arrhenius'
zu beginnen. Der erste elektronische Computer wurde während des Zweiten
Weltkriegs gebaut. In den frühen sechziger Jahren waren die Computer »klug«
und zuverlässig genug, um den Klimaexperten zu helfen, die immens
komplizierten Mechanismen zu untersuchen, die das Wetter der Erde bestimmen.
Arrhenius
hatte geschätzt, welche Erwärmung des Planeten Breitengrad für Breitengrad
durch den Treibhauseffekt zu erwarten war. Er hatte die Zeittafel seiner
Voraussagen im <Philosophical Magazine> vom April 1896 veröffentlicht.
Es war eine bemerkenswerte Vorhersage, wenn man bedenkt, daß es die erste
überhaupt war, und sie berücksichtigte sämtliche Faktoren. Arrhenius begann
damit, daß er die Konzentrationen von Wasserdampf und Kohlendioxid in der
Atmosphäre schätzte.* Er erklärte Schritt für Schritt die physikalischen
Mechanismen, durch die jene Gase die Luft erwärmen.
*
Er stützte diese Schätzungen auf die Beobachtung, die ein amerikanischer
Astronom vom Mondaufgang gemacht hat. Samuel
Langley hatte die infrarote Strahlung des vollen Mondes gemessen,
wenn dieser über Lone Pine, Colorado, aufging. Indem er Langleys Ergebnisse
benutzte, war Arrhenius fähig zu schätzen, wieviel Infrarotstrahlung die
Atmosphäre der Erde absorbiert, und daher auch, wieviel Treibhausgas in der
Luft war. (Die Erforschung des Treibhauseffekts war bereits
interdisziplinär und international.)
70
Er
versuchte sogar in seine Berechnungen miteinzubeziehen, was
wir
heute Rückkopplung nennen. Er nahm an, daß ein großer Teil
des Eises und Schnees in der Nähe der Pole zu schmelzen beginnen könnte,
wenn sich der Planet aufwärmt. Das hinterläßt dunkle Tundren und dunkle
Meere. In der Folge erwärmt sich alles — als striche man ein weißes Dach
mit schwarzer Farbe. Je dunkler das Terrain wird, desto mehr erwärmen sich
diese Teile der Erdoberfläche. Dort schmilzt mehr Schnee, der Erdboden
erwärmt sich noch mehr... und so weiter.
All
diese Überlegungen füllen mehr als dreißig in kleiner Schrift bedruckte
Seiten im <Philosophical Magazine>, und Arrhenius hatte jede der darin
vorkommenden Berechnungen selbst vorgenommen. Am Ende
folgt eine Aufstellung der Vorhersagen. Demnach erhöht sich die
Durchschnittstemperatur auf dem Planeten Erde um fünf bis sechs Grad
Celsius, wenn sich die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre
verdoppelt.
In
den sechziger Jahren begannen Klimaexperten, Arrhenius' Voraussagen mit Hilfe
von Computern nachzurechnen. Eine der ersten ernst zu nehmenden Analysen wurde
1967 von S. Manabe und R. Wetherald vom <Geophysical Fluid Dynamics
Laboratory> in New Jersey veröffentlicht. Nachdem sich immer mehr
Wissenschaftler mit dem Computer vertraut machten und viele Forscher anfingen,
sich mit dem Treibhauseffekt zu befassen, wurde dieses Phänomen zu einem der
interessantesten Gegenstände der Wissenschaft. Der Computer half den
Forschern, die Angelegenheit auf einer Detailebene zu durchdenken, die
Arrhenius phantastisch gefunden hätte.
Um
Vorhersagen bezüglich des Treibhauseffekts machen zu können, konstruieren
die Experten heutzutage ein funktionsfähiges
maßstabgetreues Modell der Erde im Innern eines Supercomputers. Sie fangen
mit einem leeren Globus an, der in ein den Längen- und Breitengraden
entsprechendes Gitter aufgeteilt ist. In der Regel hat jeder Gitterausschnitt
eine Seitenlänge von mehreren hundert Kilometern. Die Ausschnitte setzen
sich, beginnend an der Planetenoberfläche, in die dritte Dimension bis hoch
in die Atmosphäre fort und sind in ein Dutzend Schichten riesiger
Luftraumkörper unterteilt.
Auf
die Oberfläche dieses leeren Globus zeichnen die Experten eine Karte der Erde
mit den größten Seen, Flüssen und Gebirgen. Dann geben sie dem Computer die
für die Bewegungen von Luftmassen geltenden physikalischen Regeln ein: Heiße
Luft steigt empor, kalte sinkt; jede Aktion bewirkt eine gleich starke
Reaktion. (Die meisten dieser Regeln sind einfach — ein Mathematiker kann
sie auf die Rückseite eines Kuverts schreiben.)
71
Daraufhin
programmieren die Forscher den Computer, so daß er unter Beachtung der Regeln
das Wetter
in jedem einzelnen Teil der Atmosphäre berechnet, vom Boden bis in die
oberste Schicht, und immer berücksichtigt, auf welche Art das Wetter in ihm
durch das Wetter in den benachbarten Teilen beeinflußt wird.
Die
vier ausgeklügeltsten dieser globalen
Zirkulationsmodelle oder GZMs befinden sich im Hauptquartier des
<British Meteorological Office> in Bracknell bei London, im <National
Center for Atmospheric Research> in Boulder, Colorado, im <Goddard
Institute for Space Studies> in New York und im <Geophysical Fluid
Dynamics Laboratory> in Princeton, New Jersey.
Wenn
man eine dieser Modellerden aktiviert und sie sich drehen läßt, beginnt
irgendwo in den Siliziumschaltkreisen des Computers eine leuchtende Sonne auf-
und unterzugehen. Winde kommen auf und lassen wieder nach. Strahlströme
ziehen in neuntausend Meter Höhe nach Westen. Aktiviert man das Modell lange
genug, geht der Sommer in den Herbst über, die Sonne steht niedriger am
Himmel, Eis bildet sich auf dem arktischen Meer, Schneestürme suchen
Kamtschatka und Ontario heim. Aus den wenigen einfachen Regeln entwickelt der
Computer in einem digitalen Code aus Einsen und Nullen ein Modell des Wetters
auf dem Planeten Erde.
Die
nationalen Wetterdienste benutzen derartige Modelle. Meteorologen sammeln in
großen Mengen Daten von Wetterstationen und -satelliten. Dann lassen sie ihre
Modellerde das Wetter des nächsten Tages simulieren. Die schnellsten
Supercomputer der Welt können eine Milliarde Rechenschritte pro Sekunde
ausführen, aber das Wetter ist derart kompliziert, daß der Computer selbst
bei dieser atemberaubenden Geschwindigkeit ungefähr eine halbe Stunde
Rechenzeit benötigt. In dieser halben Stunde schieben sich Warm- und
Kaltfronten kreuz und quer über die Oberfläche des Modellglobus —
sprunghaft wie die Bewegungen der Schauspieler in alten Filmen —, bis sie
die Gebiete erreichen, die sie in der Realität morgen einnehmen könnten.
Klima
stellt ein anderes, in mancher Hinsicht einfacheres Problem dar. Klima ist das
durchschnittliche Wetter. Genauer gesagt, Klima ist das Wetter, das in
einer bestimmten Gegend des Planeten in einem typischen Frühling, Sommer,
Herbst oder Winter zu erwarten ist. Wetter ist ein unerwarteter Platzregen in
Allentown, Pennsylvania, am Mittwoch um 12.08 Uhr; Klima dagegen ist der in
Millimetern ausgedrückte Niederschlag im Lehigh Valley während eines
durchschnittlichen Aprils. Wetter ist die Route, die ein einzelner Sturm
einschlägt; Klima ist die Sturmbahn, die eine Million Stürme über eine Ecke
eines Kontinents eingeschlagen haben, wie der
Trampelpfad von Generationen von Studenten über eine Ecke des Campusrasens.
72
Das
Leben eines Individuums ist nicht vorhersagbar, aber die durchschnittliche
Lebenskurve einer Million Individuen ist statistisch ziemlich genau erfaßbar.
Das ist der Grund, weswegen Physiker das Verhalten von Gasen voraussagen
können, die aus Schwärmen von Molekülen bestehen, deren individuelles
Verhalten nicht bestimmbar ist; und das ist auch der Grund, aus dem
Versicherungen genug Geld einnehmen, um Büropaläste in allen größeren
Städten der Welt bauen zu können.
Für
ihre Klimastudien vereinfachen die Forscher ihre Zwillingserde, lassen sie sie
für das Äquivalent von Jahrzehnten, Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden
drehen und entnehmen jedem Punkt der Oberfläche die jahreszeitlichen
Mittelwerte. Die Resultate sind eine ziemlich genaue Annäherung an das Klima
der realen Welt. Die Modelle weisen die groben klimatischen Züge aller
Kontinente in allen vier Jahreszeiten auf. Sie sind noch nicht fähig,
Einzelheiten wie unterschiedliche Länder darzustellen; alles, was viel
kleiner als ein Kontinent ist, wird als Detail behandelt.
Das
lateinische Wort für »voraussagen« ist praedicere; das Wort
»prophezeien« beinhaltet das griechische prophanai, das ebenfalls
»voraussagen« bedeutet. Im Japanischen lautet das entsprechende Wort ura oder
uranai, »dasjenige, das vorausliegt und daher unsichtbar ist«.
Manchmal können uns Computermodelle helfen, dem Schicksal in die Karten zu
schauen, das Unsichtbare zu sehen. Immer wieder haben die Erbauer von Modellen
in Brackneil, Boulder, Princeton und New York in ihren Spielzeugwelten
dasselbe Experiment nachvollzogen, das die menschliche Rasse zur Zeit mit
ihrem Planeten anstellt. Sie fügen der Atmosphäre zusätzliche dreihundert
Teile pro Million Kohlendioxid hinzu, aktivieren ihr Modell und achten darauf,
was passiert. Auf jeder dieser Erden beginnt die Oberflächentemperatur nach
dem Zusatz an Kohlendioxid zu steigen; anfangs langsam, dann immer schneller
und schneller.
Natürlich
sind diese Modelle, wie einer ihrer Schöpfer es ausdrückte, nur »schmutzige
Glaskugeln«. Die tatsächliche Rate der Temperatursteigerung ist ungewiß.
Die Höhe, in die die Quecksilbersäule an den verschiedenen Orten der Welt
steigen wird, ist nicht exakt vorherzusagen. Aber der
Anstieg der globalen Temperatur kann als gesichert gelten, mit einer
Abweichung von nur plus/minus fünfzig Prozent.
Die
durchschnittliche Temperatur an der Planetenoberfläche wird um zwei
bis sechs Grad Celsius ansteigen; das entspricht etwa dem, was Arrhenius 1896
vorausgesagt hat.
73
In
den sechziger Jahren, während Klimaexperten ihre ersten Computersimulationen
vornahmen, entdeckten Astronomen, daß der Nachthimmel bereits zwei Beweise
für die Kraft des Treibhauseffekts zeigt. Der eine ist die Venus, der andere
der Mars.
Diese
Planeten haben sich ungefähr zur selben Zeit wie die Erde gebildet, vor rund
viereinhalb Jahrmilliarden. Sie bestehen auch in etwa aus denselben Elementen
wie die Erde. Sie haben ähnliche Umlaufbahnen um die Sonne — weder sehr
weit draußen, wie der Pluto, noch sehr weit innen, wie der Merkur. Venus und
Erde sind fast gleich groß; der Mars ist ein wenig kleiner.
Aber
trotz der starken Ähnlichkeit sind diese drei Welten getrennte Wege gegangen.
Astronomen haben das in den sechziger und siebziger Jahren durch von der Erde
aus vorgenommene Mikrowellenbeobachtungen und Raumsonden, die den Planeten
Besuche abstatteten, herausgefunden.
Die
Oberfläche der Venus ist so heiß wie das Innere eines Ofens, etwa
vierhundertfünfzig Grad Celsius, bei Tag und bei Nacht, das ganze Jahr über,
vom Äquator bis zu den Polen. Falls je Wasser auf der Venus existiert haben
sollte, ist es längst verdampft.
Der
Mars hingegen ist kälter als die Antarktis, das ganze Jahr über, von den
Polen bis zum Äquator. Alles Wasser ist unter der Marsoberfläche im
Permafrost gebannt.
Man
kann diese Temperaturunterschiede nicht durch die Entfernung von der Sonne
erklären. Zwar ist die Venus der Sonne am nächsten, etwa hundertacht
Millionen Kilometer, dann folgt die Erde mit hundertfünfzig Millionen
Kilometern, dann der Mars mit zweihundertachtundzwanzig Millionen Kilometern.
Aber nach der Entfernung allein müßte die Venus wärmer, die Erde milder und
der Mars kälter sein; wie drei Camper, die in Entfernungen von einem,
anderthalb und zweiein viertel Metern um ein großes Lagerfeuer sitzen. Die
Auswirkung des Abstands auf die Temperatur läßt sich genau berechnen, und
sie allein ist auch nicht annähernd stark genug, um die Venus in einen
Brutkasten und den Mars in einen Eiskeller zu verwandeln. Dieses Phänomen
wird gelegentlich als Goldilocks*-Problem bezeichnet: Wieso ist die Venus zu
heiß, der Mars zu kalt, und wieso hat die Erde in etwa die richtige
Temperatur?
*
»Goldilocks and the three Bears«, Untertitel des Buchs Tetrascroll von R.
Buckminster Fuller; deutsch: Goldlöckchen und die drei Bären, Köln 1983
(Anm. d. Übers.)
74
Der
entscheidende Punkt ist der, wie die drei Welten mit ihrem Kohlenstoff
verfahren sind. Sie sind mit etwa der gleichen Menge an Kohlenstoff
ausgestattet. Aber der größte Teil des Kohlenstoffs auf der
Erde ist in Sedimente und Gestein eingeschlossen. Er ist sicher unter unseren
Füßen verstaut, wo er keinen Treibhauseffekt erzeugen kann. Auf der Venus
wurde der größte Teil des Kohlenstoffs auf irgendeine Weise freigesetzt. Die
Atmosphäre der Venus beinhaltet 350.000mal so viel Kohlenstoff wie die der
Erde. Das ist soviel Kohlenstoff, daß er die Venus allein durch sein Gewicht
unbewohnbar macht. Kohlendioxid drückt mit der hundertfachen Kraft der
Erdatmosphäre auf die Oberfläche dieses Planeten. Durch diesen Druck ist die
Venusluft so dick und suppig, daß selbst die sanfteste Brise die Gewalt eines
Hurrikans hat. Die sowjetischen Ingenieure mußten ihre
Venera*-Robot-Sonden so massiv wie U-Boote bauen, weil die Landung auf der
Venus einer Tauchfahrt von etwa einem Kilometer Tiefe in einem irdischen Meer
entspricht.
Die
Venus ist von Wolken verhüllt, und nur sehr wenig Sonnenlicht dringt bis an
ihre Oberfläche durch. Der Boden liegt in einem so tiefen Schatten, daß
seine Temperatur unter dem Gefrierpunkt sein müßte. Aber die großzügige
Ausstattung der Venusatmosphäre mit Kohlendioxid hält die
Oberflächentemperatur nicht nur oberhalb des Gefrierpunkts, sondern sogar
über der Temperatur, bei der Wasser siedet — sie ist heiß genug, um Blei
schmelzen zu lassen.** Von der Erde aus erscheint der
Abendstern mit bloßem Auge betrachtet wie eine kühle Schönheit (daher sein
Name »Venus«), aus der Nähe gesehen ist er ein Inferno.
Der
Mars ist das Gegenteil der Venus. Seine Atmosphäre ist hundertmal dünner als
die der Erde und zehntausendmal dünner als die der Venus. Sein gesamter
Kohlenstoff ist in Sedimenten eingeschlossen. Aufgrund des mangelnden
Treibhauseffekts ist die Oberfläche des Mars steinhart gefroren.
*
Die russischen Sonden Venera 3 bis 9 erreichten die Venus in den Jahren 1967
bis 1975, Nummer 3 stürzte ab, 8 und 9 blieben auf der Venusoberfläche
knapp eine Stunde lang funktionstüchtig. (Anm. d. Übers.)
**
Der Treibhauseffekt auf der Venus verhindert nicht nur die Evolution von
Lebewesen, er verhindert auch die Entwicklung der Lithosphäre, der festen
Kruste der Venus. Auf der Erde sinken an manchen Stellen beständig große
Bruchstücke der Lithosphäre —Platten genant — ins Erdinnere hinab, an
anderen Orten erheben sie sich aus der Tiefe. Ihre Bewegung gehört zu einem
Muster der Konvektion, das an das Aufschäumen kochenden Wassers erinnert
(und auch von denselben Kräften erzeugt wird: heißes Gestein steigt empor,
kaltes sinkt). Das Brodeln des Planeten wird in Zehnmillionen von Jahren
gemessen. Eine an der Oberfläche zutage tretende Folge ist die
Kontinentaldrift. Dieses Phänomen ist als Plattentektonik bekannt. Auf der
Venus ist die Oberfläche hingegen zu heiß, um zu sinken. »Von der
Venus«, schreibt der Geophysiker Don Anderson, »haben wir erfahren, daß
eine dichte Atmosphäre und der Treibhauseffekt die Oberfläche so weit
erwärmen können, daß sie in schwimmendem Zustand bleibt und verhindert
wird, daß die Kruste absinkt.«
Wenn
die Erde einen so starken Treibhauseffekt aufwiese, wäre unser Planet tot.
Es gäbe keine Biosphäre, keine Hydrosphäre, keine Kryosphäre und keine
Noosphäre; und in der Lithosphäre würden gar die Kontinente aufhören zu
driften.
75
Wahrscheinlich
war der Mars einmal mit mehr Leben erfüllt. Sein gefrorener Boden weist
Gräben auf, die große Ähnlichkeit mit ausgetrockneten Flußbetten haben.
Zudem gibt es zahlreiche erloschene Vulkane. Als sie noch tätig waren,
könnten sie genug Kohlendioxid freigesetzt haben, um eine Atmosphäre zu
schaffen, die hundertmal dichter als die jetzige war — so dicht wie die der
Erde heute. Deshalb mag der Mars einst einen stärkeren Treibhauseffekt und
ein so gemäßigtes Klima wie das der Erde erlebt haben — mit Regenfällen
und Wasserläufen (und vielleicht sogar mit primitivem Leben).
Die
Farbe des Planeten ist rot und feurig (daher der Name Mars), aber er ist so
kalt, daß sein Wasser nicht schmelzen kann, nicht einmal im Sommer; nicht
einmal am Äquator. An den Polen sind die Winter so kalt, daß ein Teil der
Atmosphäre des Mars am Boden festfriert.*
Diese
Kontraste sind derart auffällig, daß Weltraumforscher Allegorien der drei
Planeten schufen, fast in der Manier mittelalterlicher Astronomen. Sie
sprechen von Venus und Mars als den warnenden Beispielen für die Menschen.
Venus: Das Vierhundertfache unserer Treibhauserwärmung — ein Ofen, Mars:
weniger als die Hälfte der auf der Erde durch den Treibhauseffekt erzeugten
Wärme — ein Eisschrank. Wenn in der Erdatmosphäre so viel Kohlenstoff wie
in der Venusluft wäre, würden unsere Ozeane verkochen. Wenn die
Erdatmosphäre so wenig Kohlenstoff wie die Marsluft aufwiese, wären unsere
Ozeane kompakte Eismassen. Es ist offensichtlich, daß wir genau darauf achten
sollten, was wir mit unserem Kohlenstoff anfangen.
Generationen
von Kindern haben sich beim ersten Stern, den sie am Abendhimmel sahen —
meist war es der Abendstern, die Venus —, etwas gewünscht. Alle diese
Generationen arbeiteten und arbeiten an der Erfüllung ihrer Wünsche und
lassen diese Welt ein wenig mehr der Venus ähnlich werden.
Diese
Studien im Weltraum haben nicht nur die Treibhaustheorie erhärtet, sie haben
außerdem aufgezeigt, daß der Treibhauseffekt in extremen Fällen eine
Scheide zwischen Leben und Tod sein kann. Die Klimaexperten William Kellogg
und James Hansen und der Astronom Carl Sagan zählten zu den ersten Forschern,
die einen Blick in das Inferno der Venus geworfen haben. Sie alle sprachen
später freimütig über
den Treibhauseffekt auf der Erde. Zum Teil hatte die Venus sie radikalisiert.
*
Sie bildet Trockeneis: gefrorenes Kohlendioxid.
76
In
den achtziger Jahren wurde eine noch bedeutungsvollere Reihe von Indizien für
die Wirksamkeit des Treihauseffekts in den Eisdecken der Erde gefunden, nach
einer langen Suche, die im International Geophysical Year begann. Im Verlauf
dieses großen Jahres der Forschung bohrte ein Team amerikanischer Eisexperten
ein mehr als dreihundert Meter tiefes Loch in die Eisschicht im nordwestlichen
Grönland. Es gelang dem Team, das Eis aus dem Loch herauszuholen. Sie
schnitten es in kurze, schimmernde Zylinder, die sie Eiskerne nannten (das Eis
aus dem Kern des Lochs).
Das
Bohrteam verschiffte einen Teil des Eises in Labors, um es analysieren zu
lassen. Die dortigen Geochemiker erkannten sofort, daß die Eisdecke in
geologischen Schichten angelegt war, ähnlich dem Schlamm am Boden eines Sees
oder Sand und Steinen auf dem Meeresgrund. Die Schichten sind nahe der
Oberfläche sehr jung und werden immer älter, je tiefer man gelangt. Viele
der jährlichen Schichten sind ziemlich deutlich abgegrenzt (obwohl die
Grenzen gewöhnlich eher chemisch bestimmbar als dem Auge sichtbar sind).
Durch chemische und isotopische Meßmethoden kann man die Jahre
zurückverfolgen, wie bei den Ringen der Bäume.
Es
stellte sich heraus, daß die Schichten weit zurückreichten. Die unterste
Schicht der Eisdecke Grönlands und der Antarktis, in mehreren hundert Metern
Tiefe, besteht aus Eis, das vor fast einer halben Jahrmillion als Schnee fiel.
Anfangs
wollten die Eisexperten nur mehr über Eis erfahren. Aber
die sieben Sphären der Erde sind derart verkettet, daß die Erforschung der
einen zu Enthüllungen über alle sieben führen kann. Nach sorgfältiger
Untersuchung stellte sich heraus, daß die Eisschichten Spuren allen
Geschehens verewigt hatten, von plötzlichen Helligkeitsschwankungen der Sonne
bis zu prähistorischen Vulkanausbrüchen. Das Eis hat Spuren einer heftigen
Eruption im Jahr 1645 v.Chr. festgehalten. Ungefähr zu jener Zeit könnte der
Vulkan Thera (ital. Santorin) im Ägäischen Meer ausgebrochen sein, die
minoische Kultur ausgelöscht und die Legende von Atlantis begründet haben.
Das
Eis hat außerdem offenbart, wie sehr das Vorhandensein des Menschen die
Atmosphäre verändert. Man bedenke nur zum Beispiel die Menge an Blei
in unserer Atemluft. Vor nicht allzulanger Zeit gab es noch Experten,
die behaupteten, das meiste Blei sei natürlichen Ursprungs und stamme aus
Vulkanen, Seegischt und Bodenausdünstungen.
77
Dann
untersuchten Claude Boutron, ein Eisexperte aus Grenoble, und Clair Patterson,
ein amerikanischer Geochemiker am California Institute of Technology, die
Eisschichten der letzten siebenundzwanzigtausend Jahre. Sie entdeckten, daß
der Bleigehalt im Schnee Grönlands und der Antarktis heute zweihundertmal
größer ist, als er in prähistorischen Zeiten war. »Unsere Resultate«,
schreiben Boutron und Patterson, »zeigen, daß mehr als neunundneunzig
Prozent des Bleis, das sich heute in der Troposphäre der nördlichen
Hemisphäre befindet, von menschlichen Aktivitäten herrührt.«
Und
obendrein zeigt das Eis das rasche Ansteigen des Säuregehalts der
Niederschläge. Ein Team unter der Leitung Paul Mayewskis von der Universität
von New Hampshire und Willi Dansgaards aus Kopenhagen analysierte einen
Eiskern aus Grönland, der die Jahre 1896 bis 1984 umfaßte. Sie stellten
fest, daß sich die Sulfatkonzentration etwa seit 1900 verdreifacht hatte. Die
Nitratkonzentration hat sich seit ungefähr 1955 verdoppelt.
Diese
Veränderungen sind auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen, ebenso wie
die Radioaktivität in den jüngsten Schichten der Eiskerne. Diese Schichten
weisen eindeutig Spuren der Radioaktivität auf, die bei den in den fünfziger
Jahren durchgeführten nuklearen Testexplosionen freigesetzt wurde.
Aber
die dramatischste Geschichte, die das Eis erzählt, handelt vom
Kohlendioxid.
Das
Eis enthält eine Unzahl von Gasbläschen — wie Mineralwasser —, und jedes
dieser Bläschen umschließt eine Probe der Erdatmosphäre, seit Jahrzehnten,
Jahrhunderten und Jahrtausenden hermetisch versiegelt. (Tatsächlich bestehen
etwa zehn Volumenprozent aller Gletscher aus eingeschlossener Luft.) Die
Anthropologen können auf Knochen, die Geologen auf Gestein und Fossilien
zurückgreifen, die Archäologen verfügen über Töpfe, Pyramiden und Papyri.
Schon in den sechziger Jahren erkannten Eisforscher, daß sie auf eine Quelle
von vergleichbarem Wert für Klimaexperten gestoßen waren. Sie hatten fossile
Luft gefunden. Wenn sie es schafften, die winzigen Gasblasen zu öffnen und
die darin eingeschlossenen Gasproben zu analysieren, konnten sie herausfinden,
wie die Erdatmosphäre in prähistorischen Zeiten beschaffen war.
Das
führte unter anderem zu einer dringlichen Frage: Wieviel Kohlendioxid haben
die Menschen in die Atmosphäre gejagt, und eine wie hohe Dosis hat die Erde
tatsächlich mitbekommen? Dank Keeling wußte man, daß sich das Gas heute in
der Luft ansammelt. Aber ohne eine Probe fossiler Luft konnte niemand genau
sagen, wieviel Kohlendioxid vor der industriellen Revolution in der Luft war.
Niemand wußte genau, was sich in der Luft befand, bis Keeling sein globales
Netz errichtete. Diese Ungewißheit verdunkelte den Forschungsgegenstand.
78
In
den sechziger und siebziger Jahren versuchten Teams unter Leitung des
Physikers und Eisexperten Hans Oeschger an der Berner Universität, Claude
Lorius in Grenoble und andere sich darin zu übertreffen, die Eisdecken
Grönlands, der Antarktis und der Alpen anzubohren. Sie veröffentlichten
Dutzende wissenschaftlicher Arbeiten darüber und sammelten Eiskerne, die
aneinandergelegt eine Länge von rund zehn Kilometern ergeben hätten. Das Eis
lagert heute zum größten Teil im zehnstöckigen Gefrierhaus der Buffalo
Refrigerating Company in Buffalo, New York. (Die Wissenschaftler mieteten
einen Teil des besten Stockwerks an, das die Firma zu bieten hatte, dasjenige,
in dem auch Hummer gelagert werden.)
In
den frühen achtziger Jahren hatte die Berner Gruppe eine brauchbare Methode
gefunden, die Luft in den Eisblasen zu analysieren. Als erstes zerlegten sie
einen Eiskern in spielwürfelgroße Stücke. Dann, im Labor, nahmen sie einen
Würfel mit Zangen auf, ließen ihn in eine Vakuumkammer, die unter dem Namen
»Cracker« bekannt ist, fallen, versiegelten die Kammer und pumpten die Luft
aus ihr heraus. Anschließend wurde ein Schalter umgelegt, und Stahlnadeln
drangen durch ein Gitter in die Kammer. Der Eiswürfel wurde augenblicklich in
winzige Splitter zerteilt. Die Luft entwich sofort und wurde in einen Tubus
gesogen. Dort schoß ein Laser einen Strahl infrarotes Licht in das Gasgemisch
und maß den Anteil an Kohlendioxid. Die Wissenschaftler wiederholten diesen
Prozeß einige Male und stellten den mittleren Wert fest.
Nur
ein Zehntel des Volumens eines Eiswürfels besteht aus Luft. Und nur ungefähr
ein Dreitausendstel davon ist Kohlendioxid. Um den Betrag an Kohlendioxid in
der alten Luft mit dem entsprechenden Gehalt in der heutigen Luft zu
vergleichen, müssen die Forscher diesen Hauch eines Hauchs farblosen,
geruchlosen und geschmacklosen Gases mit einer Genauigkeit von wenigen Teilen
pro Million messen. »Man muß schon ziemlich feinfühlig vorgehen«,
sagt ein Physiker der Schweizer Gruppe lakonisch dazu.
Während
die Forscher diese raffinierte Labortechnik noch weiter ausarbeiteten, bohrte
ein Team amerikanischer und Schweizer »Luftjäger« einen Eiskern an der
Siple Station in der westlichen Antarktis heraus. Dort sind die
Schneeschichten aus den letzten Jahrhunderten ungewöhnlich regelmäßig und
fein säuberlich getrennt. Indem sie diesen Kern an andere, ältere Kerne
ansetzte und die im Eis eingeschlossene Luft mit Hilfe des Crackers und des
Lasers analysierte, gelang es Oeschgers Mitarbeitern, die fortlaufende
Geschichte des Gases der letzten zehntausend Jahre zu rekonstruieren — von
der späten Steinzeit bis zum postindustriellen Zeitalter.
79
Während
des größten Teils dieses Zeitraums war der Kohlendioxidgehalt in der
untersuchten Luft ungefähr gleich. Er wich nie mehr als ein paar Prozent von
der Grundlinie von zweihundertachtzig Teilen pro Million ab. Mitte des 18.
Jahrhunderts begann er anzusteigen, kurz nachdem Watt seine erste
Dampfmaschine konstruiert hatte. Im 19. Jahrhundert wurde er durch die
brennenden Wälder und die Verwertung des von den amerikanischen Pionieren
gefällten Nutzholzes hochgetrieben. Um 1958 hatte er etwa
dreihundertfünfzehn Teile pro Million erreicht. Die Geschichte des Gases von
1734 bis 1958 stellt sich wie folgt dar:
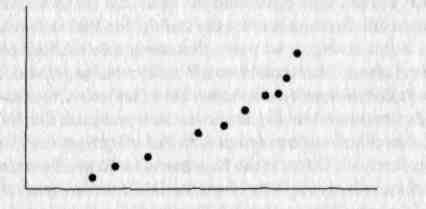
Das
Jahr 1958 erscheint in dieser Aufzeichnung im Eis wie der Bolzen, der zwei von
gegenüberliegenden Ufern aus gebauten Autobahnbrückenteile miteinander
verbindet. Denn der Wert, den die Forscher für 1958 im Eis herausfanden,
entsprach Keelings Zahl aus diesem Jahr. Die beiden Methoden der Beweisführung
hatten zu demselben Ergebnis geführt. Wenn man Keelings Aufzeichnungen mit
einbezieht, liest sich die Geschichte der letzten zehntausend Jahre so:
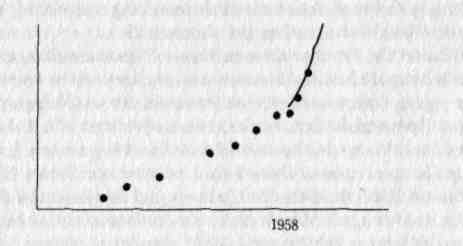
80
Einen
weit älteren Eiskern haben russische Forscher und Techniker in der
Wostok-Station in der Ostantarktis, dem kältesten Ort der Erde, ausgebohrt.
In den achtziger Jahren begann die Grenoble-Gruppe, diesen über anderthalb
Kilometer langen Kern zu analysieren. Er reicht durch das gesamte Holozän
(Alluvium) der warmen Periode, in der wir uns heute befinden, bis zur letzten
Eiszeit, durch diese hindurch bis in die vorige warme Periode hinab und
von dort bis an den Beginn der vorletzten Eiszeit vor hundertsechzigtausend
Jahren zurück.
Mitte
der achtziger Jahre veröffentlichte die französische Gruppe die
Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre für die Länge dieses Kerns —
neben Keelings Kurve wahrscheinlich der wichtigste Beweis für den
Treibhauseffekt.
Arrhenius
würde viel darum gegeben haben, wenn er diese Resultate hätte sehen können.
Seiner Ansicht nach lag eine globale Erwärmung, der er positiv
gegenüberstand, noch in so ferner Zukunft, daß er es für angebracht hielt,
sich bei seinen Lesern dafür zu entschuldigen, daß er sich auf den Seiten
des <Philosophical Magazine> noch weiter mit diesem Punkt befaßte: »Ich
hätte diese langwierigen Berechnungen gewiß nicht ausgeführt, wenn nicht
ein außergewöhnliches Interesse mit ihnen verbunden gewesen wäre«,
schrieb er. Worin bestand dieses außergewöhnliche Interesse?
In
der Physikalischen Gesellschaft in Stockholm ist es gelegentlich zu sehr
lebhaften Diskussionen über die wahrscheinliche Ursache
der Eiszeiten gekommen, und alle diese Diskussionen haben meiner
Meinung nach ergeben, daß noch keine zufriedenstellende Hypothese darüber
vorliegt...
Das
ist es, was sowohl Arrhenius als auch den englischen Physiker Tyndall und den
amerikanischen Geologen Thomas Chamberlin erregte. Wie schon erwähnt, nahmen
diese Forscher an, daß ein Absinken der Kohlendioxidwerte vor mehreren
Jahrzehntausenden die Ursache der letzten Eiszeit gewesen war.
Der
Eiskern von Wostok beweist, daß der Kohlendioxidgehalt in der Luft mit der
Eiszeit sinkt und steigt, wenn das Eis zu schmelzen beginnt. In warmen
Perioden des Planeten kommt Kohlendioxid zwischen zweihundertsechzig und
zweihundertachtzig Teilen pro Million vor. In kalten Zeiten sind es
hundertneunzig bis zweihundert Teile. Es ist eine Berg- und Talfahrt, und
zwischen den Bergen und Tälern liegen Jahrtausende.
81
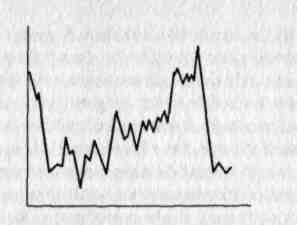
Niemand
weiß, was die Kohlendioxidwerte vor dem Auftreten des Menschen ansteigen und
absinken ließ. Hier liegen Ursache und Wirkung nach wie vor im dunkeln.
Manchmal scheint sich zuerst der Gasgehalt, manchmal zuerst die Erdtemperatur
geändert zu haben. Reagiert das Eis auf die Veränderung des Gasgehalts, oder
reagiert das Gas auf eine Veränderung im Eis? In beiden Fällen liefert der
Eiskern aus Wostok einen direkten Beweis für Arrhenius' Hypothese. Klar ist,
daß Änderungen des Kohlendioxidgehalts in der Vergangenheit mit
Klimaveränderungen verbunden waren, die zu den größten und sich am
schnellsten vollziehenden gehörten, welche unser Planet je erlebt hat — den
Eiszeiten.
Die
Analyse des Eises aus Wostok hat zudem ergeben, daß es Aussagen über die
globalen Durchschnittstemperaturen ermöglicht.* Der Anstieg und Abfall der
Erdtemperatur in den letzten hundertsechzigtausend Jahren liest sich wie
folgt:

*
Diese Analyse geschah indirekt durch eine Analyse der Sauerstoffisotope im
Eis. Siehe auch mein Buch <Planet Erde>.
82
Eines
Tages breitete Hans Oeschger die Tabellen der Temperatur und der
Kohlendioxidwerte in seinem Büro in Bern vor sich auf dem Schreibtisch aus
und schüttelte den Kopf. Die meisten der Berge und Täler
in den Temperaturaufzeichnungen stimmten mit denen der
Kohlendioxidaufzeichnungen überein. Sie hätten zwei Ansichten derselben
Berg- und Talfahrt sein können, oder ein Profil desselben Alpenteils. »Zu
schön«, sagte Oeschger. Er meinte, die Übereinstimmungen seien zu groß, um
in ihnen einen Zufall sehen zu können. Das Kohlendioxid scheint eine Art
Hauptregler für das Klima dieses Planeten zu sein. Und wir haben diesen
Regler bereits jetzt so weit hochgedreht, wie die letzte Eiszeit ihn nach
unten stellte.
In
Princeton, New Jersey, studierte Syukuro Manabe die der Eisdecke entnommenen
Daten, um ein Computermodell zu entwerfen, und beschloß, sie seinem Modell
zuzufügen. Er reduzierte den Kohlendioxidgehalt seiner Modellerde auf
zweihundert Teile pro Million. Die Temperatur der Modellerde sank, eine
Eiszeit war die Folge. Anschließend erhöhte er den Gasgehalt auf dreihundert
Teile pro Million, und sein Erdmodell ließ die Eiszeit hinter sich. Manabe
hob und senkte den Kohlendioxidspiegel seines Modells, wie auch der
atmosphärische Kohlendioxidgehalt in der realen Welt in den vergangenen
hundertsechzigtausend Jahren gestiegen und gesunken war. Jeder Änderung der
Kohlendioxidwerte folgten die globalen Temperaturen, stiegen an oder sanken,
wie sie es in den letzten hundertsechzigtausend Jahren tatsächlich getan
hatten.
»Das
überzeugte mich«, sagt Oeschger in Bern. »Wissen Sie, ich hatte
diese Dinge schon seit dreißig Jahren untersucht. Aber als Wissenschaftler
muß man stets skeptisch bleiben. Man muß immer wieder von vorn anfangen — verstehen
Sie, was ich meine?«
Während
sich die untrüglichen Hinweise häuften, änderte sich die Weltsicht der
Geowissenschaftler. Die Turbulenzen in den sieben Sphären und die
erstaunliche Verkettung der Sphären rückten immer mehr in ihr Bewußtsein.
Sie begannen zu erkennen, wie vieles schiefgehen kann. Einen Wendepunkt
stellte ein Buch dar, das eine amerikanische Biologin 1958 zu schreiben begann
— zufällig in demselben Jahr, in dem Keeling anfing, den Kohlendioxidgehalt
der Erdatmosphäre auf dem Mauna Loa zu messen.
Rachel
Carson hatte jahrelang bei einer amerikanischen Naturschutzbehörde
gearbeitet und schon zwei schwärmerische Bestseller
über die Weltmeere geschrieben. Für das Buch,
das ihr letztes werden sollte, begann sie Informationen über
Insektizide zu sammeln. Es widerstrebte ihr, das Schwärmerische zugunsten des
Polemischen aufzugeben, aber sie fühlte, daß die Beweise ihr keine andere
Wahl ließen.
83
Damals
hielten die meisten Leute das Versprühen der massenhaft verkauften
Insektizide für eine elegante Methode, gegen Moskitos, Hausfliegen und Zecken
anzugehen. Die Industriechemiker, die DDT (Dichlordiphenyltrichloräthan) und
andere Schädlingsvernichter eingeführt hatten, waren auf ihre Leistung
ebenso stolz, wie Thomas Midgley es auf seine FCKWs gewesen war.
In
ihrem 1962 veröffentlichten Buch <Der stumme Frühling> erklärte
Rachel Carson, daß die
Insekten, gegen die das DDT gerichtet war, oft immun dagegen wurden, während
Vögel, Bienen, Fische, Schafe, Rinder und Menschen vergiftet werden, wenn
sich die Chemikalie über das ganze Ökosystem verteilt. Sie erwähnte die
Millionen Tonnen von Pestiziden, die versprüht wurden, und die daraus
resultierende Besorgnis. »Sollte man es für möglich halten, daß jemand
glaubt, man könne eine derartige Giftbarrikade auf der Erdoberfläche
errichten, ohne sie für alles Leben unbewohnbar zu machen?« fragte sie.
»Sie sollten nicht >Insektizide< heißen, sondern >Biozide<.«
Der
Arbeitstitel des Buchs hatte »Kontrolle der Natur«* gelautet, und als
Biologin konzentrierte sich Rachel Carson zwar auf die Insektizide, behauptete
aber darüber hinaus, daß die gewaltsamen Versuche unserer Spezies, die Natur
zu kontrollieren, oft so übel wie das DDT zurückschlagen. Sie führte den
Fallout nach Kernwaffentests im Freien und die Verseuchung von Flüssen und
Seen mit Reinigungsmitteln als Beispiele für all die Dinge an, die zur
»Vergiftung der Luft, des Erdbodens, der Flüsse und Meere« beitragen. (Die
am meisten verbreitete Verseuchung erwähnte sie hingegen nicht. Das
Kohlendioxid sollte nämlich erst später Aufmerksamkeit erregen.)
Für
viele Leute war es 1962 ein Schock, sich vorzustellen, eine hochmoderne
Technologie könnte zu Rückschlägen führen, eine in Teilen pro Million,
Milliarde oder Billion gemessene Chemikalie ihre Gesundheit gefährden; der
Mensch könnte die Frühlingswälder unwiderruflich zum Schweigen bringen. Der
stumme Frühling trug zum Aufbruch der Umweltschutzbewegung der sechziger
und siebziger Jahre bei.
Vor
der Umweltschutzbewegung sahen sich die Forscher nicht veranlaßt, die
Annahme, daß der Aufbau des Kohlendioxidgehalts begrüßenswert sei, zu
revidieren. Immerhin ist dieses Gas das wichtigste Nebenprodukt des
materiellen Fortschritts und somit der Menschen selbst, und Wissenschaftler
neigten zu einem professionellen Stolz über die Zunahme der menschlichen
Bevölkerung sowie ihres materiellen Wohlergehens.
*
»Control of Nature«. Der Originaltitel von »Der stumme Frühling« lautet
Silent Spring. (AdÜ)
84
Callendar
zum Beispiel, der Ingenieur war, bezeichnet sich in dem heute
berühmten Aufsatz von 1938 als »Dampfingenieur bei der British Electrical
and Allied Industries Research Association«. Er förderte die industrielle
Nutzung der von Watt eingeführten Dampfmaschine. Für ihn war es
selbstverständlich, den Aufbau von Kohlenstoff in der Luft als einen
günstigen Nebeneffekt der Dampfmaschine zu bezeichnen. »Heute hält sie
unsere Häuser warm, morgen die ganze Welt« — das war 1938 der Tenor
seiner Einstellung.
Bald
nachdem Rachel Carsons Buch erschienen war, begannen Wissenschaftler zu
fürchten, das wichtigste Nebenprodukt des Fortschritts könne sich als
negativ erweisen; sie gewöhnten sich an, Kohlendioxid als Verunreinigung
anzusehen und mit demselben Schuldgefühl von ihm zu sprechen, das mit dem
Wort Unreinheit im Alten Testament und dem Miasma der griechischen Tragödie
verbunden war.
Es
war mehr als ein Wandel der intellektuellen Mode. Die Auswirkungen der
stürmischen Entwicklung der Weltindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg
(deutlich sichtbar in den Aufzeichnungen am Mauna Loa sowie in den Eisdecken
Grönlands und der Antarktis) wurden auf dem ganzen Planeten spürbar. In
diesen beiden Jahrzehnten lernten die Menschen zahlreiche Nebenwirkungen der
Kontrolle über die Natur kennen. Da waren nicht nur DDT und der Fallout,
sondern auch Abfall, eutrophierte Seen, Blei in der Luft, die
Minamatakrankheit*, Ölpest, Ozon, Aussterben von Arten, Überbevölkerung,
Love Canal**, saurer Regen und der Reaktorunfall auf Three Miles Island.
Ein
Jahrzehnt nach Erscheinen des Buchs Der stumme Frühling veröffentlichte
der amerikanische Ökologe Barry Commoner Der Kreis schließt sich. Commoner
formulierte als allgemeines Gesetz der Ökologie, »daß jede größere von
Menschen verursachte Veränderung in einem natürlichen System wahrscheinlich
eine Schädigung dieses Systems hervorruft«.
*
Minamatakrankheit: erstmals in der Minamatabucht in Kiuschu aufgetretene
chronische Quecksilbervergiftung. (Anm. d. Übers.)
** Der Love Canal wurde 1978 durch Präsident Carter aufgrund seiner
langjährigen chemischen Verunreinigung zur »desaster area« erklärt und
evakuiert. (AdÜ.)
85
Stellen
Sie sich vor, Sie öffnen den hinteren Deckel Ihrer Taschenuhr, schließen
die Augen und stoßen auf gut Glück mit einem Bleistift in das
freigelegte Uhrwerk. Das fast sichere Ergebnis wäre eine Beschädigung
Ihrer Uhr... aber (dieses) Ergebnis ist nicht absolut sicher. Es besteht
eine geringe Chance, daß
die Uhr nicht richtig ging und dieser Fehler durch die zufällige
Berührung mit dem Bleistift behoben wurde. Doch dieses Ergebnis ist
äußerst unwahrscheinlich... Man könnte ein Uhrengesetz aufstellen, das
besagt, daß »der Uhrmacher am besten darüber Bescheid weiß«.
In
den sechziger, siebziger und achtziger Jahren begannen einige Wissenschaftler,
die sieben Sphären ebenso als eine Ganzheit zu betrachten, wie es die
Ökologen schon bei der Biosphäre zu tun gewohnt waren. Sie erkannten, daß
der Umgang der Menschen mit dem Kohlendioxid so war, als stochere man, in
Anlehnung an das Bild mit der Uhr, mit einer Bleistiftspitze ausgerechnet im
wichtigsten chemischen Zyklus der Natur herum.
Das
Verständnis des Treibhauseffekts wird sich natürlich noch entwickeln. Aber
wahrscheinlich wird nie mehr jemand so überschwenglich darüber schreiben wie
Arrhenius 1906 in seinem Buch Das Werden der Welten. Im folgenden
möchte ich Arrhenius' letzte Worte über den Treibhauseffekt ungekürzt
zitierten:
Man
hört oft Klagen darüber, daß die in der Erde angehäuften Kohlenschätze
von der heutigen Menschheit ohne Gedanken an die Zukunft verbraucht
werden; und man erschrickt bei den furchtbaren Verwüstungen an Leben und
Eigentum, die den heftigen vulkanischen Ausbrüchen in unserer Zeit
folgen. Doch kann es vielleicht zum Trost gereichen, daß es hier wie
sooft keinen Schaden gibt, der nicht auch sein Gutes hat. Durch Einwirkung
des erhöhten Kohlensäuregehaltes der Luft hoffen wir, uns allmählich
Zeiten mit gleichmäßigeren und besseren klimatischen Verhältnissen zu
nähern, besonders in den kälteren Teilen der Erde; Zeiten, da die Erde
um das Vielfache erhöhte Ernten zu tragen vermag zum Nutzen des rasch
anwachsenden Menschengeschlechtes.*
Aber
trotz Häufung der Beweise und Umweltschutzbewegung hält immer wieder eine
Laune der Natur das »Heureka!« auf. 1938, als Callendar verkündete, die
globalen Temperaturen stiegen an, hatte die Aufzeichnung der Temperaturen der
Erde für die vergangenen fünfzig Jahre so ausgesehen:
*
Svante Arrhenius, Das Werden der Welten, Leipzig 1921, S. 73 (AdÜ)
86
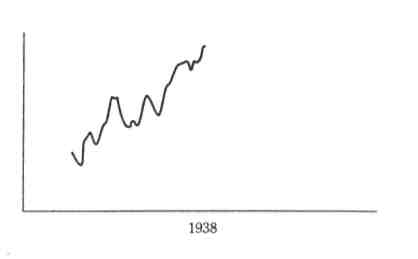
Aber
nachdem die Arbeit Callendars erschienen war, begann die
Durchschnittstemperatur zu fallen, und sie fiel ein Vierteljahrhundert lang.

Fast
alles könnte dieses Absinken verursacht haben. Die Temperatur der Erde steigt
und fällt immer im Verlauf von Jahrzehnten, und die Ursachen sind enorm
vielfältig. Ein Rückgang der Sonneneinstrahlung in jenen Jahren könnte
dafür verantwortlich sein. Die Lichtschwankung könnte durch Veränderungen
in der Sonne selbst hervorgerufen worden sein, denn die Sonne ist ein leicht
variabler Stern. Es besteht aber auch die Möglichkeit, daß der Lichtschwund
durch Staub in der Atmosphäre verursacht worden ist, der wie ein schmutziges
Dachfenster die Sonne trüb erscheinen ließ. Der Staub kann aus Vulkanen in
die Luft geschleudert worden sein, oder aus Schornsteinen und Fabrikschloten,
oder durch die Rodung neuen Ackerlandes. Da die Wissenschaftler damals die
Erde noch nicht so genau beobachtet haben, sind alle diese Erklärungen
möglich, und vielleicht erfahren wir die wahren Ursachen nie.
Für
den bedauernswerten Callendar war es jedoch, als hätte sich unter seinem
Schreibtisch eine Falltür aufgetan. Er fuhr bis zu
seinem Tod damit fort, über die Macht des Treibhauseffekts zu sprechen; aber kaum
jemand hörte ihm zu. »Solange die Welt von Jahr zu Jahr kühler
wurde«, sagt Revelle heute mit sardonischem Lächeln, »war es sehr
schwer, eine großartige Auswirkung des Treibhauseffekts zu erkennen.«
87
Nachdem
Keelings Beobachtungsnetz in den frühen sechziger Jahren den Anstieg des
Kohlendioxidgehalts entdeckt hatte, begannen die Temperaturen der Welt sogar
noch schneller zu fallen. 1975 war von einer
bevorstehenden Eiszeit die Rede. Dieses Gerücht erhielt niemals
allgemeine Zustimmung unter den Klimaexperten der Welt. Dennoch arbeitete die
CIA einen alarmierenden Bericht darüber aus, in dem größere Störungen in
der weltweiten Nahrungsmittelversorgung vorhergesagt wurden. Die
Abkühlung sorgte dafür, daß der Treibhauseffekt nicht »in Mode« kam.
Beweise aller Art stapelten sich, mit Ausnahme des einen, der die größte
Rolle gespielt hätte. »Politisch gesehen«, beklagte sich ein
Experte, »ist Kohlendioxid wie Kreideschrift auf einer weißen Wand —
oder besser gesagt, wie ein bißchen mehr Dunkelheit in der Nacht.«
In
den frühen achtziger Jahren überprüften Forscher an der Universität von
East Anglia in England noch einmal alle Temperaturaufzeichnungen aus der
ganzen Welt, derer sie habhaft werden konnten. Das Team unter Leitung von
Thomas Wigley, Direktor der Abteilung für Klimaforschung, bekam
Thermometermessungen, die von Wetterstationen an Land und auf dem Meer vom
späten 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart vorgenommen worden waren. Wigleys
Team gab Hunderte von Millionen Daten ein.
Bei
der Analyse der Resultate sahen sie, daß sich die Temperatur der Erde
gegenüber 1938 erhöht hatte. Der Globus war wärmer als in den letzten
hundert Jahren. Von 1860 bis zu den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts hatte
sich die Erde etwa um ein halbes Grad Celsius erwärmt.
Unabhängig
davon führte ein Team unter der Leitung von James Hansen am NASA's Goddard
Institute for Space Studies die gleiche Studie durch. (Hansen ist einer der
Venus-Veteranen.) Das Goddard-Team begann mehr oder weniger bei Null, seine
Mitglieder sammelten alle Daten über globale Temperaturen, die sie auftreiben
konnten, und analysierten sie. Sie fanden annähernd den gleichen
Aufwärtstrend für die nördliche wie die südliche Hemisphäre.
Beide
Gruppen stellten fest, daß 1981 das bis zu diesem Zeitpunkt wärmste Jahr des
letzten Jahrhunderts gewesen war — das heißt, seit es verläßliche
Temperaturaufzeichnungen gab. Das Jahr 1983 war wärmer als 1981. 1987 (das
Jahr nach Veröffentlichung der ersten Studie Wigleys) sollte sogar noch
wärmer als 1983 werden. Jedes dieser
Jahre brach den vorherigen Rekord: drei Weltrekorde in sechs Jahren.
88
Und
dieser Trend selbst beschleunigte sich ebenfalls. Die Erwärmung vollzog sich
in den achtziger Jahren schon weit schneller als durchschnittlich im 20.
Jahrhundert. Tatsächlich kletterte die Temperatur in diesem Jahrzehnt um
ebenso viele Grade wie zwischen 1861 und 1950. Niemand hatte einen solchen
Sprung vorausgesagt, um niemand erwartete, daß der Anstieg noch lange
anhalten würde. »Falls er doch anhält«, sagte der Klimaexperte J.
Murray Mitchell »haben wir hier in zehn oder zwanzig, keinesfalls aber
erst in hundert Jahren ein Treibhaus.«
Mitchell
teilte mir diese Neuigkeit 1987 an einem sehr schwülen Septembernachmittag in
seinem Haus außerhalb von Washington D.C, mit. Es herrschte die schlimmste
Hitzewelle des Jahres, und da Jahr war das heißeste, das die Annalen
verzeichneten. Mitchell hatt als anerkannter Ratgeber in Klimafragen einen
Großteil seines Berufslebens in verschiedenen Washingtoner Verwaltungen
zugebracht, so etwa in der Meteorologischen Weltorganisation und dem
Umwelt-Programm der Vereinten Nationen; auch war er hin und wieder für den
Kongreß und den Senat tätig. Überall in seinem Haus, auf den sich eine
Dreißigmeterantenne befand, waren Wetterinstrumente von denen er einige
selbst entworfen hatte. Während wir in seinen Arbeitszimmer saßen, klickten
und klackten diese Instrumente an Wänden, in Regalen und auf Tischen
unablässig vor sich hin um zeichneten Temperaturen, Luftfeuchtigkeit,
Geschwindigkeiten um Richtungen der Winde über dem Dach auf — alles Daten,
die halfen den Zahlenpool der Computer in East Anglia und Manhattan zu
füllen.
Mitchell
war einer der ersten Studenten gewesen, die sich mit den globalen
Temperaturtrend befaßten, und dies war auch das Thema seiner Doktorarbeit in
den späten vierziger Jahren. Schon damals hatte er
nicht daran gezweifelt, daß der wichtigste Trend des 20. Jahrhunderts die
Erwärmung des Planeten war. Doch zu jener Zeit warei noch nicht viele
Menschen am Treibhauseffekt interessiert. An einen Jahrhundert gemessen,
scheint die kühle Periode kurz gedauert zu haben, aber im Berufsleben eines
Mannes war es eine lange Zeit. Mitchell hatte sich mit anderen Dingen befaßt.
An
jenem Nachmittag nahm Mitchell die Hitze mit derselben Gelassenheit hin, mit
der er die Unsicherheiten hinsichtlich der Zukunft de Planeten und auch seiner
eigenen Zukunft hinnahm (er war krank und hatte sich vorzeitig beurlauben
lassen). Er breitete die Arbeiten Wigleys
und Hansens aus und zeigte mir,
wie die Temperatur des Planeten gestiegen,
gefallen und wieder gestiegen war, indem er mit dem Stiel seiner Pfeife die
Kurve entlangfuhr.
89
Ein
weltweiter Anstieg von rund einem halben Grad Celsius ist ungefähr das, was
die Computermodelle für das Jahr 1986 angegeben hatten. In Anbetracht all der
Treibhausgase, die wir Menschen in die Luft geblasen hatten, war es eine etwas
geringere Erwärmung, als die Modelle vorausgesagt hatten. Aber es bewegte
sich noch im Unsicherheitsbereich.
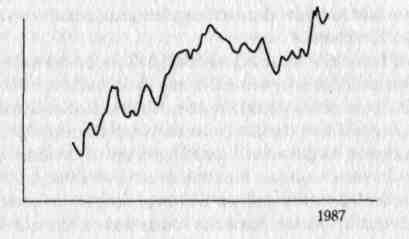
Mitchell
erklärte mir, wie die Teams von Wigley und Hansen ihre Temperaturen
aufbereitet hatten. Er erklärte mir die Mehrdeutigkeiten der Daten und den
Grund, aus dem er annahm, daß der Trend im ganzen glaubhaft war. »Es
sieht demnach so aus, als würde es wirklich geschehen«, sagte er. »Es
wird wärmer und wärmer!«
In
einigen wenigen Köpfen begannen die einzelnen Teile sich zusammenzufügen:
Der Temperaturanstieg, die Zunahme der Treibhausgase, die in den Eiskernen
aufgezeichnete Geschichte, die Geschichte des Mars und der Venus, die
Bestätigungen in den Computermodellen.
Einigen
Klimaexperten wurde langsam klar, daß der Trend fast mit Sicherheit aufwärts
ging und unerfreulich würde.
Das
Interesse der Wissenschaftler am Treibhauseffekt nahm schlagartig zu. 1986
gingen bei der amerikanischen Kohlendioxid-Informationsstelle
zweitausendzweihundert Anfragen ein — über hundertfünfzig Prozent mehr
als im Vorjahr.
Wigleys
und Hansens Berichte brachten eine Welle von Treibhaus-Storys in die Presse. Nach
dem heißen Jahr 1987 sagte Wigley zu einem Reporter der <New York
Times>, wenn die neunziger Jahre so warm wie die achtziger würden, »wäre
es sehr schwierig, den Treibhauseffekt länger zu leugnen.« Er fügte
hinzu: »Aber auch schon jetzt ist er sehr schwer zu leugnen.«
90
Immer
mehr Wissenschaftler erkannten, was Revelle
bereits 1957 gesehen hatte: Dies ist ein großes geophysikalisches
Experiment. Durch künstliche Steigerung des Treibhauseffekts auf der Erde hat
unsere Spezies eine Welle von Veränderungen in den sieben Sphären
verursacht. Spezialisten für die Atmosphäre, Hydrosphäre, Kryosphäre und
Biosphäre suchten jetzt die Horizonte ihrer Forschungsgebiete nach
Veränderungen ab, die der Treibhauseffekt bereits in ihren Sphären
hervorgerufen haben mochte. Einige von ihnen hielten nach beginnenden
Veränderungen in der Stratosphäre Ausschau. Die Hinzufügung von
Treibhausgasen mußte unter anderem die Stratosphäre deutlich kälter gemacht
haben.
Das
ist eines der Paradoxa des Treibhauseffekts. Stellen Sie sich vor, Sie gingen
in einem dünnen Hemd durch einen Schneesturm. Die Schneeflocken, die auf Ihre
Schultern fielen, würden schmelzen. Doch angenommen, Sie zögen mehrere
Kleidungsstücke an. Ihre Haut würde immer wärmer werden, aber die Wolle
Ihres äußersten Pullovers würde so kalt werden, daß der auf ihn fallende
Schnee in zunehmendem Maß liegenbliebe.
Die
Erde wandert durch die Kälte des äußeren Weltraums, und die Atmosphäre ist
ihre einzige Kleidung. Zusätzliche Treibhausgase in der Luft haben denselben
Effekt wie die Kleidungsstücke in dem angeführten Beispiel. Wir, die wir
hier unten sind, würden es bald immer wärmer haben; aber fünfundzwanzig
oder dreißig Kilometer weiter oben, in der Stratosphäre, würde es so kalt
werden, daß sich Eis bilden würde.
Mitte
der achtziger Jahre sammelten und überprüften einige Forscherteams Tausende
von Aufzeichnungen über die Temperaturen der Stratosphäre (die von
Satelliten und Raketen aus gemacht worden waren). Dann überprüfte eine
Gruppe unter der Leitung von Mark Schoeberl vom Goddard Spaceflight Center in
Greenbelt, Maryland, nochmals einige der Aufzeichnungen. Schoeberls Gruppe
stellte fest, daß die obere Stratosphäre zwischen 1979 und 1985 um
eineinhalb bis zwei Grad Celsius kühler geworden war. Auch die untere
Stratosphäre kühlt sich ab.
Das
bewies nicht, daß die Abkühlung der Stratosphäre durch den Treibhauseffekt
verursacht worden war. Es hätte auch ein Zufall sein können. Aber es paßte
zu den Vorhersagen.
1986
gab es auch eine Veränderung in der Kryosphäre.
Große Eisschollen begannen sich von der vereisten Küste der Antarktis zu
lösen, ein Prozeß, den Glaziologen bildhaft als »kalben«
bezeichnen. Urplötzlich fing der weiße Kontinent an, gigantische Kälber zu
gebären. Das Larsen-Eisschelf kalbte einen Eisberg von mindestens achttausend
Quadratkilometern Größe.
91
Das
ist mehr als das Doppelte der Größe des US-Bundesstaates Rhode Island und
mehr Eis, als sonst in einem ganzen Jahr vom weißen Kontinent losbricht. Im
selben Jahr kalbte die Nordkante des Filchner-Eisschelfs mehrere Eisberge,
deren Gesamtfläche mindestens elftausendfünfhundert Quadratkilometer betrug.
Im folgenden Jahr geschah erstmals seit mindestens fünfundsiebzig Jahren
Grundlegendes am Ross-Eisschelf. Ein Eisberg von mehr als sechstausend
Quadratkilometern Größe trieb durch die Bay of Whales. Die
Karte der Antarktis mußte neu gezeichnet werden.
Damals
war das Interesse am Treibhauseffekt schon so stark, daß nach der Geburt
jedes dieser Eisberge die Telefone der Glaziologen nicht mehr zu klingeln
aufhörten. Die Glaziologen sind gewöhnlich die gelassensten und
konservativsten unter den Geowissenschaftlern. »Wenn die Erwärmung durch den
Treibhauseffekt schon angefangen hat, steht das, was wir hier sehen,
wahrscheinlich nicht in Zusammenhang damit«, sagte Stanley Jacobs vom
Geologischen Lamont-Doherty-Observatorium in Palisades, New York, zu Reportern
kleiner Zeitungen, Radio-Talkshowgästen und neugierigen Spezialisten anderer
Wissenschaften. »Es ist ein natürlicher Prozeß, der vermutlich auf jeden
Fall stattgefunden hätte.« Neuerliches Läuten. »Das ist nicht auf
eine Entwicklung der letzten Jahre zurückzuführen.«
Mittlerweile
gab es auch Veränderungen in der Biosphäre. Wie die erstmals in den späten
siebziger Jahren durch Keeling entdeckten Veränderungen in der Atmung der
Welt waren diese Entdeckungen unsichtbar und tauchten nicht in den
Schlagzeilen auf. Aber sie hingen eindeutig mit dem Ansteigen des
Kohlendioxidgehalts zusammen.
1987
zum Beispiel nahm Ian Woodward, ein Botaniker an der Universität von
Cambridge, die alten gepreßten Baumblätter und Pflanzen aus dem Herbarium
der Hochschule genauer unter die Lupe. Woodward bemerkte, daß sich die
meisten alten Blätter — diejenigen, die 1750 unmittelbar vor Beginn der
industriellen Revolution gesammelt worden waren — anatomisch von
zeitgenössischen Blättern derselben Arten unterscheiden. Die alten Blätter
weisen mehr Poren auf.
Der
Botaniker untersuchte Blätter von einem halben Dutzend Pflanzenarten
Englands: einer Platane, einer Linde, zweier Eichenarten und einer
Blaubeerpflanze. Einige dieser Gattungen hatten mehr Poren als andere, aber in
allen Fällen besaßen diese Pflanzen seit Beginn der industriellen Revolution
weniger und weniger Poren.
92
Ein
heutiges Eichenblatt hat im Durchschnitt vierzig Prozent weniger Poren — stomata
— als seine Vorfahren unter der Regierung König Georgs
III.
Ein
Blatt stellt einen fein ausgewogenen Kompromiß dar. Es muß Kohlendioxid
aufnehmen, also muß es sich der Luft öffnen. Aber je mehr Luft durch das
Blatt zirkuliert, desto mehr Wasser verliert es durch Verdunstung. Also
öffnen und schließen sich die um jede Pore gelegenen Zellen in einem
faszinierenden Rhythmus und erreichen ein Optimum an Sonnenlicht,
Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Kohlendioxid durch Strategien, die Botaniker
zu studieren beginnen, als seien sie Bestandteile einer ausgeklügelten
Spieltheorie.
Woodward
hatte einen neuen Zug in dem Spiel, das die Bäume von Generation zu
Generation fortführen, entdeckt. Wenn die Luft mehr Kohlendioxid enthält,
brauchen die Blätter weniger Poren, um ausreichende Mengen davon aufzunehmen;
und mit weniger Poren können die Bäume sparsamer mit ihrem Wasser haushalten
und sind daher besser vor Austrocknung geschützt.
Der
Botaniker züchtete einige dieser Pflanzen in kleinen Gewächshäusern. Sobald
er der Luft Kohlendioxid zufügte, schlössen sich nicht weniger als zwei
Drittel der Poren. Poren sind winzig, mikroskopisch, aber die Bäume auf der
ganzen Welt passen sich offensichtlich in aller Stille mit ihrer Hilfe an die
Veränderung der Luftzusammensetzung an. Während wir uns bei Hitze und
stürmischem Wetter in unseren Häusern aufhalten, sind die heutigen Pflanzen
besser als ihre Vorfahren vorbereitet. Die Bäume vor unseren Fenstern sind
dabei, die Luftveränderung viel schneller zu bemerken und sich ihr anzupassen
als wir.
Für
sich allein genommen, sind das gute Nachrichten, zumindest für die Bäume;
aber unglücklicherweise sind die neuesten Entdeckungen Woodwards nicht so
ermutigend. Die Biologen unterscheiden zwischen zwei Arten von Anpassung.
Phyletische Veränderungen sind Folgen der natürlichen Selektion —
Überleben und Vermehrung der Tüchtigsten. Physiologische Veränderungen
finden durch Anpassung des Individuums an seine Lebensumstände statt.
Die
Veränderung der Pflanzen ist physiologisch. Eichenblätter passen sich an,
während sie knospen, sich entfalten und der heutigen Atmosphäre aussetzen.
Die Gene in Samen, Knospe und Blatt bleiben unverändert. »Das bedeutet«,
sagt Woodward, »daß die Belastung noch nicht groß genug ist, um eine
natürliche Selektion hervorzurufen. Aber wir gelangen an die Grenzen dieser
physiologischen Möglichkeiten.« Blätter können sich nicht noch mehr an
die sich verändernde Atmosphäre anpassen.
93
»Das
wirft eine Reihe interessanter Fragen auf. Wird es demnächst eine den
Veränderungen entsprechende Selektion geben? Was werden die Pflanzen tun,
wenn sie einer solchen Veränderung nicht fähig sind? Was als nächstes
geschehen wird, ist weit schwieriger zu verstehen als das bisher Geschehene«,
erklärt Woodward.
In
der zweiten Hälfte der achtziger Jahre brannten viele Experten darauf, der
Welt mitzuteilen, was ihrer Meinung nach bevorstand. Aber sie durften um ihrer
Glaubwürdigkeit willen nicht zu beunruhigt klingen. Sie befanden sich in
einer seltsamen Situation. Sie waren über die Veränderungen, die sie kommen
sahen, und die Schwierigkeit, die Welt vom Bevorstehen dieser Veränderungen
zu überzeugen, so besorgt, daß sie sich gelegentlich bei dem Wunsch
ertappten, die Veränderungen träten schon ein.
Tatsächlich wußten sie kaum, was sie eigentlich empfanden. An einem
heißen Sommermittag stürzte Thomas Stone mit einem Vorabdruck des <US
Geological Survey> in Richard Houghtons Büro in der Abteilung für
Ökosysteme am Marine Biological Laboratory in Woods Hole,
Massachusetts.
Der
Bericht besagte, daß Geophysiker kürzlich die Temperaturen in den
Bohrlöchern von Ölquellen in Alaska gemessen hatten. Sie hatten
festgestellt, daß sich der Permafrost Alaskas im Verlauf der letzten
Jahrzehnte oder vielleicht des vergangenen Jahrhunderts um zwei bis vier Grad
erwärmt hatte. Dies ließ die Geophysiker vermuten, daß sich die Luft der
Arktis stark erwärmt hatte — ein Umstand, über den es kaum Daten gibt. Die
Arktis gehört zu den Stellen der Erde, die sich am meisten erwärmen
müßten, und das Ausbleiben aller Anzeichen für eine Erwärmung dort hatte
schon die Experten für den Treibhauseffekt beunruhigt und verwirrt.
Die
Ölquellen lagen verstreut zu Füßen der Berge und an den Seen des
Küstenlandes Alaskas, zwischen der Brookskette und dem arktischen Meer. Stone
und Houghton kannten diese Region Alaskas sehr gut, denn der größte Teil des
Stabes ihrer Abteilung kampierte jeden Sommer in der Nähe der Brookskette und
untersuchte die Ökologie der Tundra. Die Tundra birgt riesige Vorräte an
Kohle, da sich in ihrem Boden die Überreste der Vegetation von Jahrmillionen
befinden. Die Ökologen vermuteten, daß die Tundra beginnen könnte, etliche
Milliarden Tonnen zusätzlichen Kohlenstoffs freizugeben, wenn die Erwärmung
Alaska erreichen sollte. Ein weiterer mit dem
Treibhauseffekt verbundener Alptraum: Wird dieser Kohlenstoff in die Luft
zurückgelangen?
Zwei
bis vier Grad Erwärmung bewegen sich innerhalb des vorausgesagten Bereichs.
Stone stürzte also an jenem Vormittag freudestrahlend in Houghtons Büro.
94
Aus
kosmischer Sicht laufen die Vorgänge mit katastrophaler Geschwindigkeit ab.
Aus geologischer Perspektive sieht das kollektive Ausatmen der menschlichen
Industrie wie eine einzelne Eruption aus, ein scharfer Zacken in der Luft. Der
Erdölgeologe M. King Hubbert war der erste, der die moderne Zeit auf diese
Art darstellte, und der Zacken wird manchmal als der
»Hubbert-Blip« bezeichnet.

Aber
vom Standpunkt eines sterblichen Wissenschaftlers oder des Mannes und der Frau
auf der Straße aus betrachtet, die irgendwo vor der ansteigenden Kurve des
Hubbert-Blip stehen, scheint sich alles, was mit dem Treibhauseffekt
zusammenhängt, extrem langsam abzuspielen. Dies könnte der eigentliche Grund
dafür sein, daß wir so lange gebraucht haben, bis wir anfingen, uns Sorgen
darüber zu machen. Sogar jene, die geglaubt haben, daß etwas geschah,
dachten, es würde allmählich geschehen. Die Menschen lebten im Schatten
dieser Vorgänge ebenso behaglich, wie sich die Bewohner der Stadt Hilo am
Fuße des Vulkans Mauna Loa eingerichtet haben.
Wir
reagieren nicht auf Vorgänge. Wir reagieren auf Vorfälle. Es bedarf eines
Vulkanausbruchs oder Erdbebens, oder des seltsamen Gestanks, der von einem
vergifteten See aufsteigt, oder des Auseinanderbrechens einer Eisscholle, um
unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Ich habe einmal von einem Lehrer gelesen,
der diese Tatsache vor seiner Klasse mit Hilfe eines Froschs illustrierte. Als
erstes ließ er das Tier in einen Behälter mit heißem Wasser plumpsen. Es
sprang sofort wieder hinaus. Dann ließ er den Frosch in einen Behälter mit
kaltem Wasser fallen und zündete darunter einen Bunsenbrenner an. Der Frosch
schwamm in dem Behälter umher, bis er zu Tode gekocht war.
Einhundert
Jahre lang ging die Zunahme des Kohlendioxids und die Erwärmung der globalen
Temperaturen zu langsam vonstatten, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen.
Diese Gemächlichkeit beeinflußte sogar Keelings Entdeckung, das einzige
wirkliche »Heureka!« des 20. Jahrhunderts. Unser Bild von der Art, in der
wissenschaftliche Entdeckungen gemacht werden, stammt übrigens aus dem
antiken Syrakus. Archimedes, der griechische Mathematiker, entdeckte das
erste
Gesetz der Hydrostatik in seiner Badewanne. Der Legende
zufolge lief Archimedes nackt durch die Straßen und rief: »Heureka!«
—
Ich
hab's gefunden!
95
Im
viktorianischen England brachte ein Banknotengraveur namens George Smith Jahre
damit zu, auf den Keilschrifttäfelchen im Britischen Museum Bestätigungen
für die biblische Geschichte von Noah und seiner Arche zu suchen. Eines Tages
zeigte man Smith ein frisch gesäubertes Täfelchen. Die Keilschrift war ein
Fragment einer babylonischen Erzählung über eine Weltflut. »Er legte das
Täfelchen auf den Tisch«, berichtet ein Kollege von Smiths, »sprang auf und
lief heftig erregt im Raum umher, und dann begann er zum Erstaunen der
Anwesenden, sich zu entkleiden!«
Archimedes'
Echo.
Ich
habe viele Leute, die in Keelings Nähe gewesen waren, als er mit seinem
Projekt befaßt war, nach seinem Heureka-Augenblick gefragt. Ich sprach mit
dem Schweizer Eisexperten Oeschger in Bern. Oeschger hatte am Scripps
gearbeitet, als Keeling gerade anfing. »Ich habe Keeling 1958 gut gekannt«,
sagte Oeschger. »Wir musizierten zusammen. Er spielt Piano und ich Violine.
Ich glaube, es wurde ihm sehr früh klar, daß er einer wichtigen Sache auf
der Spur war.« Obwohl die beiden ständig in Kontakt geblieben waren und
Keeling ein Jahr in Oeschgers Labor verbrachte, konnte mir Oeschger von keinem
Heureka-Augenblick Keelings berichten.
John
Chin ist Techniker in Mauna-Loa-Observatorium. Er hat zusammen mit den
übrigen Technikern auf dem Vulkan Keelings Gasanalysator bedient. Sie
wechselten das Millimeterpapier aus und sandten die Aufzeichnungen einmal
wöchentlich an Keeling. Manchmal benutzten die Techniker ein einfaches
Lineal, um die Tabellen aufzustellen und einen Anstieg oder Abfall der Kurve
zu bestimmen. »1960 haben wir die Zunahme schon gesehen«, sagt Chin. »...
mag sein, daß Keeling sehr erregt war. Aber wir sind einfach gegangen. Hatten
noch Arbeit. Wir mußten noch öfter messen.«
Ich
fragte Revelle in seinem Büro an der University of California in San Diego
nach dem Heureka-Augenblick.
»Daran
kann ich mich nicht erinnern. Es ist eine interessante Frage«, sagte Revelle.
»Aber eigentlich glaube ich nicht, daß es eine plötzliche, blitzartige
Erkenntnis war. Nur eine Häufung von Hinweisen. Das ist typisch für
Aufzeichnungsprozesse. Sie müssen so lange aufzeichnen, bis Sie über den
Erregungspunkt hinweg sind. Und hier lag der Erregungspunkt ziemlich hoch...
Es war ohnehin kein Problem, über das viele Leute nachdachten...«
96
Am
Scripps, in einem Büro, das auf demselben Flur lag, auf dem er seinen
ersten Gasanalysator zusammengebaut hatte, fragte ich Keeling, ob er sich an
den Moment erinnere, in dem er zum erstenmal erkannt hatte, daß sein globales
Kohlendioxidnetz eine Erhöhung der Konzentration gemeldet hatte. »Das kann
ich Ihnen sagen«, erwiderte Keeling voller Zuversicht, dann kramte er in
seinen Aufzeichnungen herum. Ein langes Schweigen entstand. »Ich weiß nicht,
wieso, aber es ist nicht da.« Endlich förderte er ein Papier zutage. »Tellus,
Juni 1960«, sagte Keeling und las laut vor: »Wo die Daten über ein Jahr
hinausgehen, sind die Mittelwerte für das zweite Jahr höher als die für das
Vorjahr.«
»Aber
wann wurde Ihnen die Bedeutung dessen klar?« fragte ich. »Wie war die
Stimmung in diesem Labor, als Sie es erkannten?«
Keeling
erinnerte sich an keinen besonderen Augenblick der Freude, des Erschreckens
oder Grübelns. »Ich hatte keine Zeit. Ich war vollauf damit
beschäftigt, dieses experimentelle Programm am Laufen zu halten. Das
bedeutete jede Menge Logik, Kommunikation, Reparaturen... Es war eine enorme
Arbeit, dieses Programm am Laufen zu halten. Ende 1963 hätte ich fast
beschlossen, die Messungen aufzugeben.«
Ich
besuchte Saul Price in seinem Büro im US-Wetterdienst in Honolulu.
Im
Gegensatz zu Chin ist Price ein wissenschaftlicher Meteorologe. Und anders als
Keeling und Revelle verbrachte Price zu Beginn des Projekts viele Nächte auf
dem Vulkan. Er sah den Gasanalysator die ersten Punkte dessen aufzeichnen, was
später Keelings Kurve ergab. »Erdbeobachter rufen im allgemeinen nicht
>Heureka<«, sagte Price. »Im allgemeinen läuft es so ab, daß jemand
einen Aufsatz schreibt, sobald er es wagt, und erklärt, sehen Sie, so
und so stehen die Dinge. Dann kann er >Heureka< rufen — aber nicht zu
laut. Denn wie soll man sicher sein, daß sich die verdammte Sache nicht nach
zwei oder drei oder vier Punkten wieder umkehrt? Was ergibt einen Trend? Sie
können sagen, zwei Punkte, mindestens zwei Jahre lang. Erst nach ziemlich
langer Zeit — vielleicht nach zehn Jahren — sind Sie sicher, daß Sie sich
mit etwas Realem und Authentischem befassen. Trotz der enormen Schwankungen
des auf der ganzen Welt, in der Atmosphäre, der Biosphäre und der
Hydrosphäre gewonnenen Materials, zeigt sich der Gesamteffekt noch immer,
Jahr um Jahr um Jahr. Schließlich sagen Sie: >Mein Gott!<«
97
Die
Straße zum Mauna-Loa-Observatorium steigt zwischen zwei Giganten empor, dem
Mauna Loa und dem Mauna Kea, dem langen Berg und dem weißen Berg. Diese
Vulkane sind so jung und ihre Hänge so sanft, daß die Sträflinge des
Kulani-Gefängnisses, die die Saddle
Road erbauten, nicht oft Serpentinen beschreiben mußten. Manche Leute wollen
wissen, daß sie sich mit ihren Bulldozern durch das Geröll direkt zum Gipfel
emporgearbeitet hätten, und als ihnen das Geld ausgegangen sei, hätten sie
das Mauna-Loa-Observatorium gebaut. Weil der Berg so sanft ansteigt, muß man
nicht einmal den Gang wechseln, um höher zu fahren, als mancher Gipfel in den
Alpen ist.
Der
Steigungsgrad dieser Straße erinnert an den der globalen Erwärmung — Sie
merken kaum, daß es aufwärts geht, bis Sie fast am Ziel sind. Plötzlich
kommt es Ihnen so vor, als wären Sie nicht mehr auf Hawaii. Sie sind
dreitausendvierhundert Meter über dem Meeresspiegel. Die Sonne brennt
erbarmungslos herab. Die Luft ist dünn und kalt, der Himmel dunkel und
unendlich blau, und der Ausblick zeigt endloses Ödland aus schwarzer,
erstarrter Lava, das sich nach allen Seiten erstreckt, so weit das Auge
reicht. (Weit unten können Sie die Regenwälder von Hilo und den Palmenstrand
von Kona sehen.)
Einige
Besucher des Mauna-Loa-Observatoriums brauchen Sauerstoff, viele empfinden
Übelkeit. In solchen Momenten wird einem bewußt, wie dünn die Atmosphäre
tatsächlich ist. Eine Fahrt von einer Stunde im Jeep trägt Sie halb durch
sie hindurch. Mit einer Rakete können Sie sie in wenigen Minuten hinter sich
lassen. Auf seinem ersten Flug in den Weltraum blickte ein deutscher Astronaut
aus dem Fenster und sah zum erstenmal in seinem Leben die gekrümmte Linie des
planetaren Horizonts. »Er war durch einen dünnen Saum dunkelblauen Lichts
gekennzeichnet — unsere Atmosphäre«, schrieb Ulf Merbold nach dem Flug.
»Das war offensichtlich nicht der Luftozean, von dem man mir so oft in meinem
Leben erzählt hatte. Ich war erschüttert, daß er so dünn war.«
Die
Straße zum Mauna-Loa-Observatorium endet am Hauptgebäude des Instituts,
einem kleinen, glatten zylindrischen Klotz mit einem Dach aus
Aluminiumwellblech. Um ihn herum sprießen weiße Plastikformen aus dem
Basalt, Instrumente zur Messung des Ozons und zur Beobachtung der Sonne.
Außerdem gibt es Nephelometer, Hygrometer und Maximum-Minimum-Thermometer.
Instrumente zur Messung von Staubpartikeln, Wasserdampf und extremen
Temperaturen. Die meisten der Forscher, die den Planeten mit diesen
Roboterinstrumenten beobachten, leben viele tausend Kilometer entfernt und
viele hundert Meter unterhalb dieses Orts. Die zum Personal des Observatoriums
gehörenden Forscher und Techniker warten diesen Roboterpark tagaus, tagein.
98
John
Chin (der inzwischen ein Vierteljahrhundert auf dem Vulkan verbracht hat)
führte mich bei meinem Besuch auf einem Steg aus rohen Holzplanken über das
schwarze Geröll. Ich fragte ihn, ob er sich
wegen des in Keelings Kurve sichtbaren Trends Sorgen mache. Er erwiderte, daß
er nachts gut schlafen könne. »Manchmal schaue ich es mir an und sage mir:
>So ist das.. .<« Es machte ihm sichtlich Spaß, mir die Aufgaben der
neuen Monitoren um das Observatorium herum zu erklären — jeder von bester
Qualität. In jedem Jahr kommt ein neues, gefährliches Gas hinzu, das
beobachtet werden muß: Methan, Fluorchlorkohlenwasserstoff, Schwefeldioxyd
und Kohlendioxid. Eine abschließende Examensfrage in der New York University
lautete einst: »Führen Sie sechs unbekannte, die Ozonschicht schädigende
Substanzen auf, die man noch finden wird.« Wenn diese sechs Substanzen
entdeckt werden, wird man Sensoren für sie entwickeln, und Chin wird helfen,
sie im schwarzen Geröll des Mauna Loa aufzustellen.
Auf
einer flachen Plattform aus ungehobelten Holzplanken in der Nähe des
Hauptgebäudes stehen Partikelmonitoren, die dem Atmosphärenchemiker William
Zoller gehören. Dank der Erde, die dabei aufgewirbelt wird, weiß Zoller in
jedem Jahr, wann die Chinesen mit dem Pflügen beginnen. In Japan wird sie als
»Gelber Staub« bezeichnet. Zoller nennt sie »Gobistaub«.
Inmitten
dieser Wunder an Wahrnehmungsintensität stehen ein Nebengebäude und ein
grüner Tank. Der Tank enthält knapp viertausend Liter zusätzliches Wasser
für die Techniker, die das Observatorium warten. »Wir trinken es nicht —
wir wissen nicht, was auf dem Tankboden ist«, sagte Chin. »Wir benutzen es
zum Händewachen.«
Und
über alles ragt ein Turm. Er wurde von der National Oceanic and Atmospheric
Administration errichtet und ist bei weitem das höchste Bauwerk auf dem Mauna
Loa: eine offene vertikale Rahmenkonstruktion, um die sich ein Gewirr von
Aluminiumrohren und Aluminiumtreppen rankt. Die reinste Luft der Welt wird
durch ein Aluminiumrohr an der Spitze des Turms eingesogen, mehr als
dreihundertsechzig Meter oberhalb des Observatoriums, und den unten im
Hauptgebäude untergebrachten Kohlendioxiddetektoren zugeführt; unter ihnen
befindet sich auch das mittelalterlich anmutende Aufzeichnungsgerät, das
Keeling während des IGY baute und nie jemandem zu ersetzen erlaubt hat.
»Er
ist ein sehr sorgfältiger Mann«, sagte Chin. »Ganz besonders in seiner
Forschung. Es muß so und nicht anders sein. Nichts darf verändert werden —
nicht einmal eine Einsaugleitung — ohne eine Menge Zwischenvergleiche.«
99
Kürzlich
waren ein Dutzend Telefonanrufe bezüglich des neuen Turms hereingekommen.
Keeling wollte, daß Chin jede neue Einsaugleitung mit massenhaft frischer
Luft durchblies, bevor er sie an seine Gasanalysatoren
anschloß. »Ich blase sie Tag und Nacht durch — bis ich zum Telefon greife
und sage: >Ist es o. k., wenn ich jetzt die Rohre auswechsle?< Ich
glaube, man nennt ihn übervorsichtig. Er wurde so geboren.«
Keeling
hatte Chin gerade erlaubt, eine neue Aluminiumleitung des Turms an seine
Kohlendioxiddetektoren anzuschließen. Jetzt wollte er
genau wissen, wie lange eine Luftprobe von ihrem Eintreten in die Klappen bis
ins Hauptgebäude und zur Aufzeichnung ihrer Meßwerte auf das Papier des
Computerdruckers brauchte.
Chin
schlug ein Experiment vor.
Die
Sonne begann bereits zu sinken, aber sie stach mir immer noch in den Nacken,
als ich die Stufen zum Turm hinaufstieg. (Dem UV-Strahlenmesser zufolge ist
das ultraviolette Licht auf dem Gipfel des Vulkans weit stärker als an seinem
Fuß — oben wird es durch entschieden weniger Atmosphäre gefiltert.) Ich
war zu schnell hinaufgestiegen, und schon in ungefähr dreißig Metern Höhe
ging mir die Luft aus. Auf dem Nachbarvulkan, dem Mauna Kea, fahren die
Astronomen oft für ein paar Nächte zum Observatorium hoch und machen im
Teleskopraum schlapp. »Ich verliere hier oben zehn Prozent meiner mentalen
Schaltkreise«, hatte mir ein Techniker gesagt, als wir die Saddle Road
hinaufgefahren waren. »Sie werden sich wundern. Sie werden sich an kaum
etwas von ihrem Besuche hier erinnern. Und Sie werden
nicht fähig sein, Ihre Notizen zu lesen.«
Ich
setzte mich für einen Augenblick auf die Treppe und kritzelte in mein
Notizbuch, bis ich wieder zu Atem gekommen war. Jene Seite ist eine zufällige
Impression in freien Versen:
Mühsam
der Schritt —
der Atem geht laut —
es pocht in meinen Ohren
als war ich ein Taucher —
tiefes langsames Atmen —
Die
erste Einlaßklappe war in knapp zehn Metern Höhe außerhalb des Geländers.
Um sie zu erreichen, mußte ich die Füße unter das Aluminiumgitter stellen
und mich hinauslehnen. Ich blies in die Klappe, als gälte es, ein Mikrophon
zu überprüfen. Da der menschliche Atem im Durchschnitt Tausende von Teilen
pro Million Kohlendioxid enthält, würde selbst ein mehr als eine Handbreit
entfernter Atemzug unten im Hauptgebäude eine starke Spur in der Kurve
hinterlassen. Nun stieg ich zu der Klappe in achtzehn Metern Höhe empor und
blies hinein. Dann wiederholte ich den Versuch bei der Klappe in vierundzwanzig
Metern Höhe.
100
Oben
auf dem Turm war die Luft so rein und gleichsam gläsern, daß das
Observatorium zu meinen Füßen wie eine Spielzeugszenerie aussah — das
Gelände einer Modelleisenbahn mit wenigen Gebäuden. Die Straße lief ganz
deutlich sichtbar den Hang des Vulkans hinab. Das Auge eines Adlers hätte
tausend Signalpfosten entlang der durch Halden erstarrter Lava führenden
Saddle Road ausmachen können. Auf der gegenüberliegenden Talseite waren die
weißen Kuppeln der astronomischen Dome auf dem Mauna Kea ins rosafarbene
Licht des Alpenglühens getaucht. Von einer dieser weißen Kuppeln des
Observatoriums aus hat ein Astronom kürzlich die am weitesten entfernte
Galaxis im bekannten Universum gesehen.
»He!«
schrie John Chin. »Sie müssen es noch mal machen.« — »O.k.!
Wenn ich den Arm senke, hab' ich's getan!« — »O.k.!«
Chin stand im Schatten des Aluminiumschuppens und behielt abwechselnd mich und
seine Stoppuhr im Auge. Ich atmete in das Einzugsrohr
aus und senkte den linken Arm. Chin eilte ins Hauptgebäude zurück.
Es
war ein seltsames Gefühl, allein hier oben zu stehen. Rings um mich
war fast nichts als Lithosphäre, schwarze, neugeborene Lithospähre, so weit
das Auge reichte. Über mir das blaue Himmelszelt, und am Horizont stand
weniger als die Hälfte der Sphäre des Feuers. Es war eine der abstraktesten
Landschaften, die ich je gesehen hatte. Sie kam mir vor wie der Mars. Mehrere
Sphären fehlten auf der Szene, und ich war in diesem Augenblick der einzige
Vertreter meiner Spezies und der Biosphäre. In der Art eines schematischen
Diagramms unserer Situation auf dem Planeten flogen in beständigem Strom
Kohlendioxidmoleküle, die es nicht kümmerte, ob sie der Lithosphäre, der
Atmosphäre, der Biosphäre oder der Menschensphäre entstammten, durch das
Aluminiumrohr hinab; ob ich sie nun absichtlich freigab oder nicht. Ich
kritzelte ein paar schnelle Notizen — »Ich bin Teil des Experiments«
—, die ich zwar entziffern kann, aber nicht veröffentlichen werde.
Im
Hauptgebäude drückte Chin auf seine Stoppuhr. Ein Atemzug hatte eine Minute
und fünfzig Sekunden gebraucht, um rund neunzig
Meter einer neuen Aluminiumröhre hinabzureisen und Keelings Gerät reagieren
zu lassen. »Nicht schlecht — das ist gut!« rief Chin aus. Dann
schrie er: »Dr. Keeling wird wütend werden! Dr. Keeling wird sagen, macht
nicht zuviel Unsinn!«
Künftige
Generationen werden sich fragen, wie wir so lange auf einem Vulkan leben
konnten, ohne etwas zu unternehmen. Tatsache ist: Wir wußten nicht, daß wir
auf einem Vulkan lebten. Die Wissenschaftler haben sich viel Zeit gelassen,
uns zu warnen, und wir ließen uns viel Zeit, ihre Warnungen zu hören.
Als
ich auf jenen Turm stieg, hatte ich schon seit Jahren über
geowissenschaftliche Themen geschrieben. Ich war seit einem Jahr dabei,
Material für dieses Buch zu sammeln. Ich hatte eine Woche in Keelings Labors
verbracht und viele Wochen in vielen anderen Labors.
Es
mag seltsam klingen, aber das Thema der globalen Veränderung war noch immer
sehr vage für mich gewesen, bis ich auf diesen Turm stieg. In diesem
Augenblick erst fügte sich in meinem Kopf alles zusammen: daß der
Kohlendioxidgehalt zunimmt, und daß jeder einzelne von uns dafür
verantwortlich ist. Erst da kam mir zu Bewußtsein, daß der Treibhauseffekt
eine Realität darstellen könnte.
Einige
Wochen später bekam ich einen Brief von Chin. Er enthielt einen
Computerausdruck. Die Mauna-Loa-Aufzeichnung; hier ein Teil daraus:
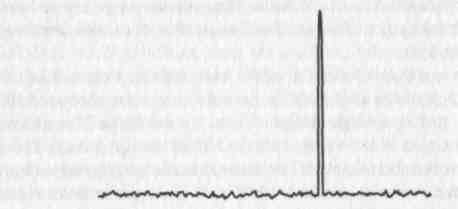
»Aloha!«
schrieb Chin. »Ihr Atem — ungefähr 378 Teile pro Million CO2«
Nach
diesem Experiment fiel bei mir der Groschen. Bei den meisten Menschen
fiel er irgendwann im Sommer 1988.
101-102
#
^^^^
www.detopia.de
The
Next One Hundred Years / Die Klimakatastrophe