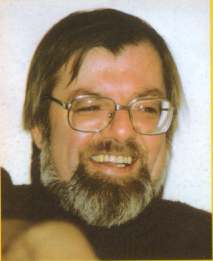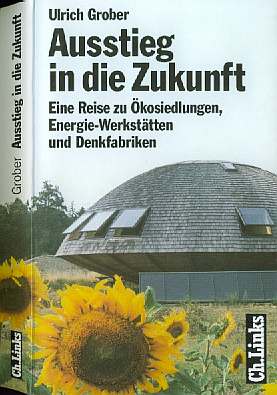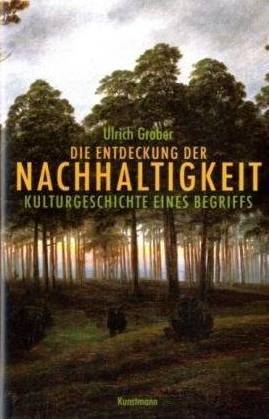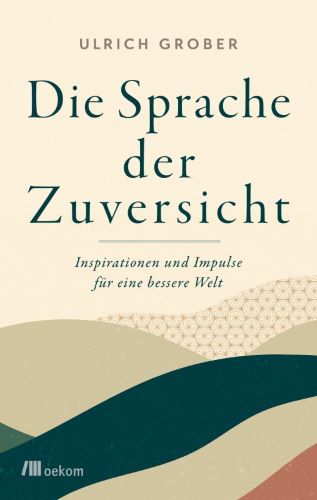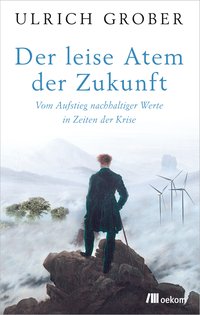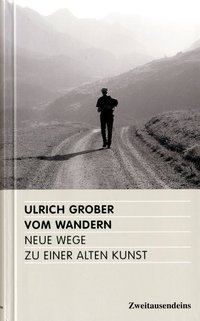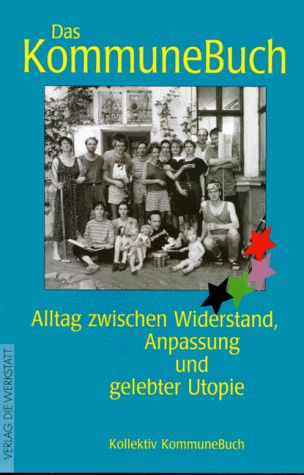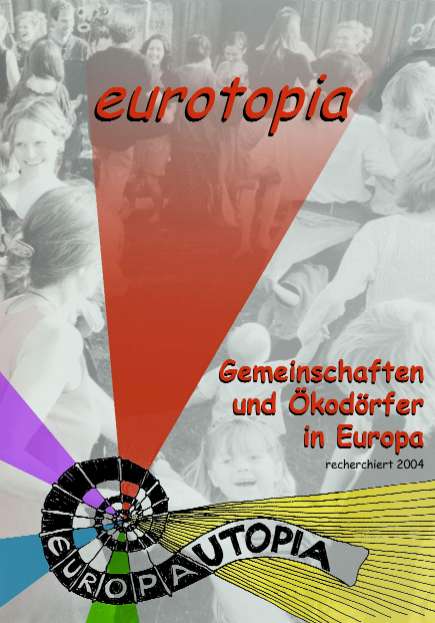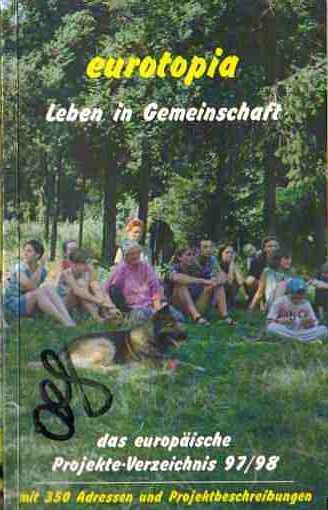|
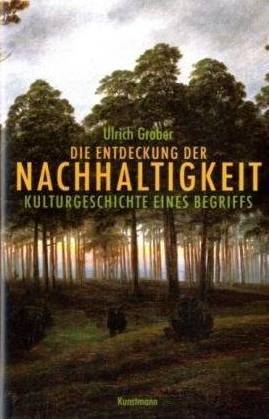
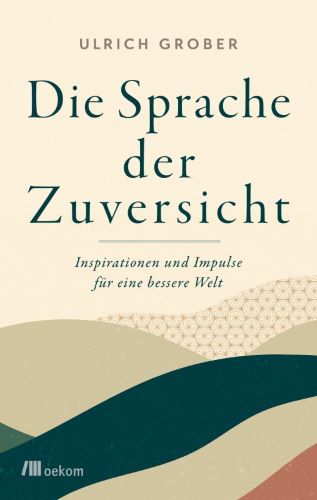
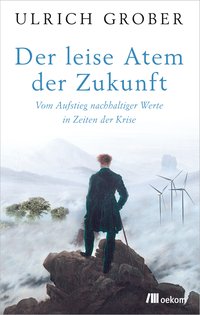
|
Audio 2010 Idee der
Nachhaltigkeit
Audio 2010 Nachhaltigkeit
Grober
Audio 2016 zu Atem der Zukunft
zu 1998:
Die
Projekte, die in diesem Band vorgestellt werden, zeigen
neue Wege einer
alternativen Modernisierung auf. Sie arbeiten auf unterschiedlichen
Gebieten: Ressourceneinsparung, Nutzung der Solarenergie, Schaffung
dezentraler Strukturen, ökologischer Landbau, nachhaltige Dorf- und
Stadtentwicklung, Formen der alternativen Lebens- und
Arbeitsorganisation.
Dabei
wurden verblüffend logische, kreative und einfach-geniale Lösungen
gefunden. Das zeigt sich beim Ökospeicher Wulkow ebenso wie im
Ökozentrum Werratal, in den Herrmannsdorfer Landwerkstätten oder dem
Energie- und Umweltzentrum am Deister.
Neben
den vielfältigen praktischen Versuchen eines sinnvollen ökologischen
Umbaus stehen die Aussagen von Theoretikern wie Margrit Kennedy,
Hans-Peter Dürr oder Dorothee Sölle, die wissenschaftlich-kritisch und
philosophisch nach Auswegen aus der Krise suchen. Im Anhang werden
zahlreiche Projekte und Forschungsinstitute mit Kontaktadressen
vorgestellt.
-
Der
Autor beschreibt verblüffend logische, einfache und geniale Lösungen
für einen ökologischen Umbau. ---Erziehung und Wissenschaft, 7.8.98
-
Das
Buch strahlt vorsichtigen Optimismus aus,
denn der Leser erhält erstaunlich viele Informationen über die
alternativen Modelle und ihren geistigen Background. Liebevoll schildert
der Autor seine Eindrücke. ---Märkische Allgemeine, 1.8.98
-
Der
Autor stellt Fragen und läßt die Menschen über ihre Sachen reden. Er
begleitet sie in ihrem praktischen Alltag und schreibt positiv
kommentierend. Eine Lektüre, die lohnt. ---Contraste, 10/1998
-
Insgesamt
bietet das Buch eine faszinierende Momentaufnahme des bunten Spektrums
zwischen utopischer »Herrschaftsfreiheit« und pragmatischen
ökologischen Transformationsmodellen. ---Politische Ökologie, 1998/99
-
Das
Verdienst des Buches liegt vor allem in der konzentrierten Versammlung und
ausführlichen Darstellung dieser (ökologischen) Projekte sowie der
Einreihung in die historischen Linien alternativer Entwürfe, flankiert
von Interviews mit alternativen Theoretikerinnen von Margrit Kennedy bis
Dorothee Sölle. Naturschutz heute, 4/98
-
Grobers
Fahrt durch Deutschland führt zu den verstreuten, äußerlich mitunter
kaum wahrnehmbaren, im Innern aber um so quirrligeren Werkstätten des 21.
Jahrhunderts: den Ökodörfern, alternativen Betrieben, Initiativen für
regenerative Energien und aus neuem Gemeinschaftsgeist geborenen
Siedlungen. So verschieden ihre Wurzeln, Leitgedanken und Organisationen
auch sein mögen, gemeinsam ist den Ansätzen der sozialen, ökologischen
und ökonomischen Gegenkultur im Land, daß sie in buntem Kontrast zum
grauen Einheitsblock der Bonner Politik und ihrer bleiernen Müdigkeit
steht. Frankfurter Rundschau, 21.7.98
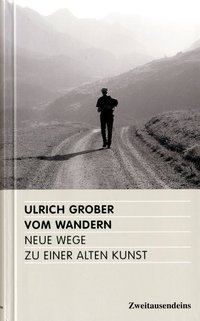 |