#
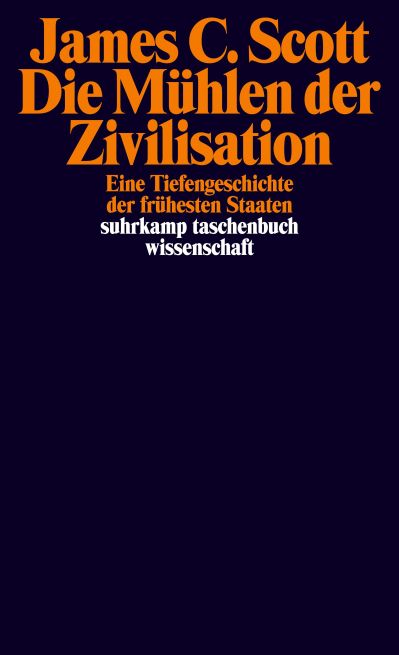
3.6- Ethik am Ende der Welt
236-250
Die aus San Ignacio und Santa Elena bestehende Zwillingsstadt in Belize liegt 80 Kilometer von der Küste entfernt auf einer Höhe von 80 Metern über dem Meer, aber der besorgte Klimaforscher Guy McPherson ist nicht dorthin gezogen - auf einen Hof im Dschungel, der sich rund um die Städte erstreckt -, um vor dem Wasser zu fliehen. Vorher würden ihn andere Katastrophen dahinraffen, sagt er; er hat die Hoffnung aufgegeben, den Klimawandel zu überleben, und meint, dass wir anderen das auch tun sollten. Die Menschen würden in zehn Jahren ausgestorben sein, erklärt er mir via Skype, und als ich seine Partnerin Pauline frage, ob sie das auch so sehe, lacht sie. »Eher in zehn Monaten, würde ich sagen.« Das ist jetzt zwei Jahre her.
McPherson war früher Naturschutzbiologe an der University of Arizona, wo er, wie er mehrmals erwähnt, mit 29 Jahren eine Anstellung auf Lebenszeit erhielt, und wo er, wie er auch mehrmals erwähnt, seit 1996 unter Beobachtung durch den »Deep State«, wie er es nennt, stand.
2009 sei er von einem anderen Wissenschaftler von seiner Stelle verdrängt worden. Damals war er schon dabei, nach New Mexico überzusiedeln - der Ort war ein Kompromiss zwischen ihm und seiner damaligen Frau -, und 2016 zog er dann in den mittelamerikanischen Urwald, um dort mit Pauline zusammen in einer polyamourösen Beziehung auf der Stardust Sanctuary Farm zu leben.
In den letzten zehn Jahren hat er hauptsächlich über YouTube eine, wie Bill McKibben es in seiner zurückhaltenden Art nennt, »Anhängerschaft« gefunden. Heute reist McPherson ab und zu durch die Welt und hält Vorträge über das »zeitnahe Aussterben des Menschen« (»near-term human extinction«), eine Formulierung, die er selbst geprägt hat, wie er voller Stolz erklärt, und mit NTHE abkürzt; einen zunehmenden Teil seiner Zeit verwendet er jedoch darauf, Workshops zu leiten, in denen es darum geht, was wir mit dem Wissen über den bevorstehenden Weltuntergang anfangen sollen.
Diese Workshops laufen unter dem Titel »Nur die Liebe bleibt« und vermitteln eine Art posttheologischen Millenarismus, neu aufbereitete Lehren der altbekannten New-Age-Bewegung. Grob vereinfacht geht es darum, dass das Wissen um den bevorstehenden Tod der gesamten Spezies in uns in etwa die gleichen Empfindungen wecken sollte wie es der Dalai Lama in Bezug auf das Wissen um den bevorstehenden Tod unserer selbst vermittelt - das heißt Mitgefühl, Staunen und vor allem Liebe.
Wer drei Werte auswählen müsste, auf denen er eine ganze Ethik aufbaut, könnte es schlechter treffen, und wenn man die Augen zusammenkneift, kann man daraus fast eine Gesellschaftslehre ableiten.
Aber denjenigen, die die Erde am Rand einer Krise und eines Leidens biblischen Ausmaßes sehen, ist es auch erlaubt, sich im Namen einer vagen hedonistischen Gleichmutslehre aus dem politischen Geschehen - oder auch dem Klima, soweit das irgendwie möglich ist - zurückzuziehen. Anders formuliert: McPherson wirkt bis hin zum Schnauzbart wie der Inbegriff eines Aussteigers - der Art, die schnell etwas verdächtig scheint. Aber warum?
237
Wir haben derartige Voraussagen über den Untergang der Zivilisation oder das Ende der Welt für so lange Zeit - über Jahrzehnte, wenn nicht sogar über Jahrhunderte hinweg - für eine Art Beweis für geistige Umnachtung gehalten und die Bewegungen, die sich im Umfeld solcher Personen gebildet haben, als »Kulte« abgetan, dass wir nun nicht in der Lage sind, solche Warnungen ernst zu nehmen - vor allem, wenn diejenigen, die sie aussprechen, selbst jede Hoffnung verloren haben.
Nichts verabscheut unsere moderne Welt so sehr wie »Aufgeber«, aber dieses Vorurteil schmilzt im weiteren Verlauf der Erwärmung wahrscheinlich sehr schnell dahin. Wenn sich die Klimakrise so weiter entwickelt wie erwartet, werden unsere Berührungsängste mit Weltuntergangspropheten sich bald in Luft auflösen, während sich neue Kulte bilden und ihr Gedankengut in Bereiche der etablierten Gesellschaft überschwappt. Denn obwohl die Welt nicht enden wird und unsere Zivilisation mit großer Sicherheit widerstandsfähiger ist, als McPherson glaubt, wird die unverkennbare Umweltzerstörung unweigerlich eine Menge weitere Propheten wie ihn hervorbringen, deren Verkündigungen der unmittelbar bevorstehenden Umweltapokalypse vielen vernünftig veranlagten Menschen schnell ziemlich einleuchtend erscheinen werden.
Das liegt zum Teil daran, dass sie schon heute gar nicht so irrational sind. Wer nach einer Zusammenfassung der schlechten Nachrichten zum Thema Klima sucht, fährt gar nicht schlecht mit der Übersicht, die McPherson auf seiner Homepage »Nature Bats Last« führt (momentan mit dem Hinweis »Jüngste - und wahrscheinlich auch letzte - Aktualisierung am 2. August 2016« versehen). Sie umfasst ausgedruckt 68 mit Links gespickte Seiten, die an einigen Stellen irreführende Darstellungen seriöser Untersuchungen und Verweise auf hysterische, nicht zuzuordnende Blogbeiträge enthält, die aber trotzdem wie wissenschaftliche Erkenntnisse präsentiert werden.
Manche Dinge, wie etwa die Rückkopplungseffekte, sind schlicht falsch verstanden worden, (sie können sich auf besorgniserregende Weise summieren, aber nicht »multiplikativ« wirken, wie McPherson es darstellt) und es finden sich Angriffe auf gemäßigte Klimagruppen, die als politisch korrupt bezeichnet werden, und ein bunte Auswahl von Verweisen auf Erkenntnisse, die bereits widerlegt sind (McPherson macht sich zum Beispiel große Sorgen darüber, dass die »Todesrülpser« aus Methan alle gleichzeitig austreten könnten, ein Szenario, von dem sich die Fachleute bereits vor fünf Jahren abgewendet haben).
238
Doch selbst diese gezielt aufgebauschte Liste enthält genügend wissenschaftlich fundiertes Material, um den Leser in Angst und Schrecken zu versetzen: eine gute Zusammenfassung des Albedo-Effekts, eine praktische Zusammenstellung genauer Beobachtungen des arktischen Eisschilds und andere vielsagende Vorboten auf die Klimakatastrophe.
Die Darstellungsweise ist durchgehend paranoid - an einigen Stellen ersetzt die beeindruckende Fülle an Daten das logische Grundgerüst, das diese Masse in eine sinnvolle Form bringen sollte, an anderen Stellen verdeckt sie es. Texte in diesem Stil finden sich haufenweise im Internet, sie florieren im goldenen Zeitalter der Verschwörungstheorie, jener unersättlichen Bestie, die gerade erst begonnen hat, sich am Klimawandel gütlich zu tun.
Bisher ist uns diese Denkweise eher vom Klimaleugner-Ende des politischen Spektrums vertraut, aber sie breitet sich auch in der Gemeinschaft der Umweltschützer aus, etwa bei John B. McLemore, dem charismatischen, insgeheim homosexuellen, von Selbsthass zerfressenen Südstaatler, der an den Weltuntergang durch die Klimakatastrophe glaubte und dessen von widersprüchlichen Klimapanikvisionen gesäumter Weg in den Selbstmord vom Podcast »S-Town« dokumentiert wurde.648
»Ich nenne es manchmal giftiges Wissen«, sagt Richard Heinberg vom Post Carbon Institute, auf dessen Websites McLemore gelegentlich Kommentare hinterließ. »Sobald man einmal über die Überbevölkerung, die Ressourcenknappheit, den Klimawandel und die Dynamiken des gesellschaftlichen Zusammenbruchs Bescheid weiß, wird man dieses Wissen nicht wieder los, und jeder folgende Gedanke ist entsprechend gefärbt.«649
#
McPherson kann selbst nicht ganz genau sagen, wie all diese Probleme zum Aussterben der Menschheit führen werden - er tippt darauf, dass etwas wie eine Lebensmittelkrise oder ein Finanzkollaps zunächst die Zivilisation und dann das menschliche Leben in die Knie zwingen wird.
239
Es braucht natürlich eine Menge schwarzseherische Fantasie, um sich auszumalen, dass das in einem Jahrzehnt geschehen könnte. Aber zieht man die grundlegenden Entwicklungen in Betracht, stellt man sich schon die Frage, warum der Rest von uns die Dinge nicht etwas schwärzer sieht.
Das kommt sicherlich noch, und zwar bald. Schon heute kann man die Setzlinge einer florierenden Klimaesoterik bei Leuten wie McLemore und McPherson erkennen - besser gesagt, bei Männern wie ihnen, denn es sind fast nur Männer -, ebenso wie bei einer Reihe von Schriftstellern und Vordenkern, die den kommenden Katastrophen so eifrig entgegensehen, dass man fast den Eindruck hat, sie feuerten die Kräfte der Apokalypse an.
In manchen Fällen tun sie das auch ganz wörtlich. Einige, wie McLemore, kann man sich wie eine Art Travis Bickle der Klimakrise vorstellen, sie hoffen auf einen Regenguss, der den Abschaum der Welt hinwegspült. Aber es gibt auch naiv-optimistische Genießer der Erderwärmung, etwa den Ökologen Chris D. Thomas, der behauptet, im Vakuum nach dem sechsten Massenaussterben würde die Natur »gedeihen« - neue Arten hervorbringen, neue ökologische Nischen erschaffen.650
Manche Technologen und ihre Fans gehen noch weiter und erklären, wir sollten uns von unserer Fixierung auf die Gegenwart - selbst im abgemilderten geologischen Sinne des Wortes »Gegenwart« - lösen und uns stattdessen einen quasi-taoistischen Klimaoptimismus zu eigen machen. Diese Vorstellung kommt oft in einer futuristischen Färbung daher - die schwedische Journalistin Torill Kornfeldt fragt in The Re-Origin of Species, ihrem Buch über die Bemühungen, Lebewesen wie Dinosaurier und Wollhaarmammuts »vom Aussterben zurückzuholen«: »Warum sollte die Natur, wie sie heute ist, mehr wert sein als die Natur von vor 10.000 Jahren oder die Arten, die es in 10.000 Jahren geben wird?«
240
#
Die meisten, die die heutigen Entwicklungen als Beginn einer Klimakrise verstehen und davon ausgehen, dass der Welt eine umfassende Verwandlung bevorsteht, schauen jedoch eher düster gestimmt in die Zukunft.
Ihre Vision setzt sich oft aus den ewig wiederkehrenden Endzeitbildern aus bestehenden apokalyptischen Texten zusammen, etwa der Offenbarung des Johannes, der im Westen unvermeidlichen Quellensammlung für die Ängste vor dem Ende der Welt. Diese Darstellungen, die William Butler Yeats in seinem Gedicht »Die Wiederkunft« im Grunde für ein säkulares Publikum aufbereitet hat, haben die westliche Traumlandschaft so nachhaltig geprägt - sie bilden eine Art gnostische Tapete unseres bürgerlichen Innenlebens -, dass wir oft vergessen, dass sie ursprünglich als reale Prophezeiungen entstanden, Visionen dessen, was die Welt innerhalb von nur einer Generation erwartete.651
Der wahrscheinlich bekannteste dieser neuen Klimagnostiker ist der britische Schriftsteller Paul Kingsnorth, Mitbegründer, Gesicht und Hofdichter des Dark Mountain Project, einer losen Gemeinschaft rebellischer Umweltschützer, die sich in Verzicht üben und den Namen ihrer Gruppe dem amerikanischen Schriftsteller Robinson Jeffers entliehen haben, genauer seinem aus dem Jahr 1935 stammenden Gedicht »Rearmament« (»Aufrüstung«), das so endet:
I would burn my right band in a slowfire
To change thefuture ... Ishoulddofoolishly. The beauty of modern
Man is not in the persons but in the
Disastrous rhythm, the heavy and mobile masses, the dance ofthe
Dream-led masses down the dark mountain.Ich ließe diese meine rechte Hand langsam verkohlen,
Könnt ich dadurch die Zukunft abwenden ... und täte doch nicht
gut daran. Die Herrlichkeit des neuzeitlichen Menschen
Liegt nicht im Einzelnen, sondern
Im Rhythmus, dem unheilvollen schweren Schrittmaß
Der traumbefangenen Massen in ihrem Tanz zu Tal den dunklen
Hang hinab.
241
Jeffers war eine Zeit lang eine literarische Berühmtheit in den USA - die Los Angeles Times berichtete über seine Affären, und es war allgemein bekannt, dass er sein aus Granitfelsen errichtetes Haus an der kalifornischen Küste, das »Tor House« mit dem »Hawk Tower«, eigenhändig gebaut hatte. Heute kennt man Jeffers hauptsächlich als Propheten der Abkehr von der Zivilisation und wegen seiner Philosophie, die er selbst schonungslos als »Inhumanismus« bezeichnete: kurz zusammengefasst, der Glaube daran, dass sich die Menschen viel zu sehr mit ihrem Menschsein und ihrem Platz in der Welt beschäftigen statt mit der natürlichen Erhabenheit des nicht menschlichen Kosmos, in dem sie sich zufällig befinden. In der Moderne, glaubte Jeffers, habe sich das Problem bedeutend verschlimmert.
Der Naturforscher und Philosoph Edward Abbey verehrte Jeffers' Werk und Charles Bukowski nannte ihn seinen Lieblingsdichter.652 Auch die berühmten amerikanischen Landschaftsfotografen Ansei Adams und Edward Weston waren von ihm beeinflusst, und der Philosoph Charles Taylor bezeichnete Jeffers in Ein säkulares Zeitalter neben Nietzsche und Cormac McCarthy als eine bedeutende Figur dessen, was er »immanenten Antihumanismus« nannte.
In seinem umstrittensten Werk »The Double Axe« legt Jeffers diese Weltsicht einer einzelnen Figur, dem »Inhumanisten«, in den Mund, die »eine Verlagerung der Gewichtung und Bedeutung vom Menschen zum Nichtmenschen, die Ablehnung des menschlichen Solipsismus und die Anerkennung der transhumanen Größe« beschreibt. Das wäre ein echter Perspektivwechsel, schrieb er, der »einen vernünftigen Abstand zur Verhaltensregel erhebt, anstelle von Liebe, Hass und Neid«.
Dieser Abstand stellt das Kernprinzip - oder vielleicht besser den »Hauptimpuls« - des Dark Mountain Projects dar. In den kommenden Jahrzehnten, wenn das bunte Spektakel des Lebens auf Erden durch die Erderwärmung - selbst durch die Medien vermittelt - für einige unerträglich anzuschauen sein wird, wird das vermutlich noch viele weitere Umweltgruppen dazu treiben, ihr Glück im Rückzug zu suchen.
»Diejenigen, die einen extremen gesellschaftlichen Zusammenbruch direkt miterleben, liefern selten tiefgreifende Enthüllungen
242
über die Wahrheiten der menschlichen Existenz«, beginnt das Manifest der Gruppe. »Was sie allerdings zum Ausdruck bringen, wenn man sie fragt, ist ihre Überraschung darüber, wie leicht es ist zu sterben. Die Routine des Alltagslebens, in der so vieles von einem Tag zum nächsten gleich bleibt, verbirgt, wie fragil dieses Gefüge ist.«653
In diesem Manifest, das von Kingsnorth und Dougald Hine geschrieben und 2009 veröffentlicht wurde, präsentiert die Gruppe Joseph Conrad als ihr intellektuelles Vorbild, vor allem aufgrund der Art und Weise, wie er die eigennützigen Illusionen der europäischen Gesellschaften auf dem Höhepunkt von Industrialisierung und Kolonialzeit seziert habe. Der Text zitiert Bertrand Russells Einschätzung von Conrad, der über den Verfasser der Erzählungen Herz der Finsternis und Lord Jim schrieb, er »betrachtete das zivilisierte und moralisch erträgliche Leben wie einen gefährlichen Gang über eine dünne Kruste kaum erkalteter Lava, die jeden Augenblick einbrechen und den Unvorsichtigen in die feurigen Tiefen sinken lassen konnte«. Das wäre immer ein lebhaftes Bild gewesen, vor allem jedoch in Zeiten des herannahenden Umweltkollaps. »Wir glauben, dass die Wurzeln dieser Krisen in den Geschichten liegen, die wir uns selbst erzählen«, schreiben Kingsnorth und Hine - namentlich: »der Mythos des Fortschritts, der Mythos der zentralen Stellung des Menschen und der Mythos unserer Abspaltung von der >Natur<«. All diese Mythen, fahren sie fort, »sind deshalb noch gefährlicher, weil wir vergessen haben, dass es sich um Mythen handelt«.
Im Grunde ist es fast schwer, sich überhaupt irgendetwas vorzustellen, das nicht allein schon vom Eindruck eines herannahenden Wandels beeinträchtigt wird, angefangen bei der Entscheidung von Paaren, ob sie Kinder wollen, bis hinauf zur Anreizstruktur der Politik. Und man muss gar nicht bis zum Aussterben der Menschheit oder dem Zusammenbruch der Zivilisation gehen, um echten Nihilismus und Weltuntergangsstimmung gedeihen zu sehen. Man muss sich nur ein Stück weit vom Altvertrauten entfernen, um auf eine kritische Masse charismatischer Propheten zu stoßen, die einen Kollaps kommen sehen.
243
Es ist ein beruhigender Gedanke, dass die kritische Masse in diesem Fall recht groß ist und dass unsere Gesellschaft nicht durch Nihilismus in die Knie gezwungen werden wird, solange dieser Nihilismus nicht zur gängigen Weltanschauung des Durchschnittsbürgers geworden ist. Aber der Weltuntergangsglaube wirkt auch an den Rändern, er nagt an unseren Strukturen wie Termiten oder Holzbienen.
#
2012 veröffentlichte Kingsnorth in der Zeitschrift Orion ein neues Manifest - oder ein Pseudomanifest - unter dem Titel »Dark Ecology« (»Dunkle Ökologie«).654 In der Zwischenzeit war er noch hoffnungsloser geworden. Dieser Text hebt an mit zwei Zitaten von Leonard Cohen und D. H. Lawrence - »Nehmt den einzigen Baum, der noch steht, und schiebt in euch ins Loch eurer Kultur« und »In die Wüste muss er sich zurückziehen und kämpfen« - und nimmt mit dem zweiten Absatz an Fahrt auf, der so beginnt: »Ich habe vor Kurzem die gesammelten Werke von Theodore Kaczynski gelesen. Ich befürchte, das könnte mein Leben verändern.«
Insgesamt stellt der Essay, der eine überwältigende Reaktion bei den Lesern von Orion auslöste, eine Art Verteidigung von Kaczynski dem Hüttenbewohner und Flugblattschreiber gegenüber Kaczynski dem Bombenleger dar - den Kingsnorth nicht als Nihilisten oder auch nur als Pessimisten beschreibt, sondern als einen präzisen Beobachter, dessen Problem ein übermäßiger Optimismus gewesen sei. Er sei zu sehr der Idee verfallen gewesen, dass die Gesellschaft verändert werden könne. Kingsnorth hingegen zählt eher zu den echten Stoikern. »Also frage ich mich: Was wäre, zu diesem Zeitpunkt der Geschichte, keine Zeitverschwendung?«
Er zählt fünf Antworten auf. Die Nummern zwei bis vier sind Abwandlungen neuer transzendentalistischer Motive: »die Bewahrung nicht menschlichen Lebens«, »sich die Hände schmutzig machen« und »das Beharren darauf, dass die Natur einen Wert über ihren Nutzen hinaus hat«. Die Nummern eins und fünf sind radikaler und bilden ein Paar: »Rückzug« und »Unterschlupfe bauen«. Letzteres ist der positivere Aufruf in dem Sinne, dass er konstruktiv ist oder zumindest das, was in Zeiten des Zusammenbruchs als konstruktiv gilt: »Können wir denken oder handeln wie die Klosterbibliothekare im Mittelalter, die alte Bücher verwahrten, während draußen Reiche entstanden und zerfielen?«
244
»Rückzug« ist die dunklere Hälfte der gleichen Aufforderung:
Wenn du das tust, wirst du von vielen Leuten als »Schwarzseher« bezeichnet werden, als »Untergangsprophet«, oder du bekommst zu hören, du seist »ausgebrannt«. Man wird dir erzählen, du seist verpflichtet, dich für die Klimagerechtigkeit oder den Weltfrieden oder das Ende der schlimmen Dinge überall einzusetzen, und dass »kämpfen« immer besser sei als »aufgeben«. Ignorier diese Leute und habe teil an einer uralten praktischen und spirituellen Tradition: dem Rückzug aus dem Gefecht. Ziehe dich nicht als Zyniker zurück, sondern mit einem forschenden Geist. Ziehe dich zurück, um dich zurücklehnen und spüren, erahnen, ermitteln zu können, was das Richtige für dich ist und wofür die Natur dich braucht. Ziehe dich zurück, weil es eine zutiefst moralische Position ist, sich zu weigern, die Maschine weiter voranzutreiben, die Schrauben weiter anzuziehen. Ziehe dich zurück, weil handeln nicht immer wirksamer ist als nicht handeln. Ziehe dich zurück, um deine Weltanschauung zu prüfen: die Kosmologie, das Paradigma, die Auffassungen, die Reiserichtung. Jede wahre Veränderung beginnt mit einem Rückzug.
Das ist - mindestens - ein Ethos. Und er fügt sich in eine lange Tradition ein. Was sich zunächst einmal wie eine radikale Reaktion auf eine neue Krisensituation liest, entspricht in Wahrheit einer Neuausrichtung eines alten asketischen Rituals, das schon beim jungen Buddha bis hin zu den Säulenheiligen und darüber hinaus verbreitet war. Doch im Gegensatz zur überlieferten Variante, in der der asketische Impuls den Suchenden in einer Art von weltlichem Schmerz fort von den Vergnügungen der Welt und hin zum spirituellen Sinn trägt, ist Kingsnorths Rückzug - wie der McPhersons - der aus einer Welt, die unter spirituellen Qualen leidet, hin zu kleinen, irdischen Trostspendern.
245
In dieser Hinsicht handelt es sich um eine groß angelegte Version des allgemein verbreiteten Reflexes, den fast alle von uns bei der Konfrontation mit Leid verspüren - man wendet sich einfach davon ab. Und zu welchem Zweck? Es kann doch nicht sein, dass ich die Pein anderer und die Dringlichkeit des Handelns allein durch den »Mythos« der Zivilisation verspüre - oder?
#
Das Dark Mountain Project ist eine Randerscheinung. Guy McPherson ist eine Randerscheinung, ebenso wie John B. McLemore. Aber eine Bedrohung durch den Klimawandel besteht darin, dass die Ausprägungen des ökologischen Nihilismus, die diese Männer verfolgen, Eingang in die Mehrheitsmeinung finden könnten - und wenn Ihnen die Vorhersagen dieser Vertreter vertraut vorkommen, ist das ein Zeichen dafür, dass ein Teil ihrer Ängste und ihrer Verzweiflung schon heute auf die Zukunftserwartungen vieler anderer abfärben. Im Internet hat die Klimakrise zur Ausbreitung des sogenannten »Ökofaschismus« geführt - einer Bewegung, die tun will, »was immer nötig ist«, und dabei auch die Überlegenheit der weißen Rasse propagiert und den Klimabedürfnissen einiger weniger Priorität einräumt. Im linken Spektrum nimmt die Bewunderung für den Klimaautoritarismus von Xi Jinping zu.
In den Vereinigten Staaten findet sich dieser Alleingangsimpuls des Umweltseparatismus vor allem bei Rechtsextremisten - bei Leuten wie Cliven Bundy und seiner Familie und all den selbstherrlichen Siedlern, die die Gesellschaft in den Jahrhunderten seit der Landverteilung und den damit verbundenen Auseinandersetzungen so unkritisch mythologisiert hat. Vielleicht ist es eine Reaktion darauf, dass die liberale Umweltschutzbewegung sich vornehmlich einem pragmatischen Ansatz verschrieben hat und eher zu mehr gemeinschaftlichem Engagement neigt als zu weniger.655 Möglicherweise spiegelt das aber auch nur die speziellen Anforderungen der Sache wider: Wenn man jemanden ausschließt, besteht immer die Gefahr, dass er genau das tut, was man befürchtet hat, und der Erde Schäden zufügt, die alle betreffen.
246
Aber dieser Pragmatismus treibt seine eigenen Blüten - etwa dass viele derer, die sich als praktische Technokraten der umweltbewussten gemäßigten Linken verstehen, glauben, dass sich der Klimawandel nur durch eine Mobilmachung abwenden lässt, deren Ausmaß der in den USA im Zweiten Weltkrieg entspricht.656 Sie haben recht - das ist eine absolut nüchterne Einschätzung der Größenordnung dieses Problems, der selbst eine nicht unbedingt für Hysterie bekannte Institution wie der Weltklimarat 2018 beipflichtete. Aber gleichzeitig ist das ein Unterfangen, dessen Ehrgeiz so sehr im Widerspruch zur gegenwärtigen politischen Stimmung in fast allen Teilen der Welt steht, dass es schwer ist, sich keine Sorgen darüber zu machen, wie es sich eigentlich auswirkt, wenn diese Mobilmachung ausbleibt - auf die Erde, ja, aber auch auf das politische Engagement derer, die sich am stärksten für den Umweltschutz einsetzen. Denn es ist wirklich so: Diejenigen, die zu einer massenhaften Mobilmachung aufrufen, heute und keinen Tag später, können als Umwelttechnokraten betrachtet werden. Links von ihnen stehen diejenigen, die nur eine politische Revolution für die Lösung halten.
Und selbst dort herrscht bald dichtes Gedränge, aufgrund von Texten, die zur Kategorie »Klima-Panikmache« zählen, der so mancher sicherlich auch dieses Buch zuordnen würde. Das ist in Ordnung, denn ich empfinde Panik.
Damit bin ich nicht allein. Und wie diese weitverbreitete Panik unser ethisches Handeln den Mitmenschen gegenüber und die Politik, die aus diesem Handeln erwächst, prägen wird, zählt zu den entscheidenden Fragen, vor die das Klima die Erdbewohner stellt. Vor diesem Hintergrund ist es zu verstehen, warum die Aktivisten in Kalifornien so sauer auf ihren Gouverneur Jerry Brown waren, obwohl er, kurz bevor er aus dem Amt schied, ein enorm ehrgeiziges Klimaschutzprogramm durchsetzte - doch in ihren Augen bemühte er sich nicht nachdrücklich genug um einen Abschied von den fossilen Brennstoffen.
Ähnliches gilt auch für andere Staatenlenker, von Justin Trudeau, der sehr gern über Klimaschutzmaßnahmen spricht, aber gleichzeitig mehrere neue kanadische Ölpipelines genehmigt hat, bis hin zu Angela Merkel, in deren Regierungszeit die Menge der Energie aus erneuerbaren Quellen rasant angestiegen ist, die aber gleichzeitig die Atomkraft so rasch heruntergefahren hat, dass die Versorgungslücke nun zum Teil von den bestehenden Kohlekraftwerken gestopft wird.
247
Dem Durchschnittsbürger dieser Länder mag die Kritik extrem vorkommen, aber sie basiert auf sehr nüchternen Berechnungen: Die Welt hat noch maximal drei Jahrzehnte Zeit, um sich vollständig vom Kohlenstoff zu emanzipieren, bevor wirklich verheerende Klimakatastrophen losbrechen. Einer Krise dieses Ausmaßes kann man nicht mit halbherzigen Lösungen beikommen.
In der Zwischenzeit nimmt die Umweltpanik zu, und mit ihr die Verzweiflung. Als beispiellose Wetterereignisse und unablässige Forschungen der Umweltpanik-Fraktion in den letzten Jahren immer mehr Stimmen zuführten, kam unter Klimajournalisten und -autoren ein harter Wettstreit um die richtige Terminologie auf, mit dem Ziel, neue, deutliche Formulierungen zu finden - etwa Richard Heinbergs »toxisches Wissen« und Kris Bartkus' »Malthusianische Tragik« -, um die demoralisierende - oder demoralisierte - Reaktion der restlichen Welt in einen wissenschaftlichen Rahmen zu fassen. Für die Gleichgültigkeit der Umwelt gegenüber, die vom modernen Konsumenten erwartet wird, hat die Philosophin und Aktivistin Wendy Lynne Lee den Begriff »Öko-Nihilismus« geprägt.657 Stuart Parkers »Klimanihilismus« geht leichter über die Lippen.658 Bruno Latour, ein notorischer Aufrührer, nennt die Gefahr einer wütenden, durch eine Politik der Gleichgültigkeit befeuerten Umwelt ein »Klimaregime«.659 Außerdem gibt es die Begriffe »Klimafatalismus« und »Ökozid« sowie den von Sam Kriss und Ellie Mae O'Hagan in einer psychoanalytischen Argumentation gegen den unaufhörlichen öffentlichen Optimismus der Umweltschützer verwendeten Ausdruck »menschlicher Futilitarismus«:
248/249
Das Problem ist, wie sich herausstellt, nicht die übergroße Anzahl an Menschen, sondern ein Mangel an Menschlichkeit. Der Klimawandel und das Anthropozän stellen den Triumph einer untoten Spezies dar, ein gedankenloses Schlurfen in Richtung Aussterben, aber das ist nur eine schiefe Imitation dessen, was wir wirklich sind. Das macht die politische Depression so wichtig: Zombies sind nicht traurig, und sie fühlen sich sicher nicht hilflos, sie existieren einfach nur. Die politische Depression ist im Grunde die Empfindung eines Lebewesens, das davon abgehalten wird, es selbst zu sein; trotz aller Niedergeschlagenheit und Schwäche ist es ein Protestschrei. Ja, politisch Depressive haben das Gefühl, sie wüssten nicht, wie man ein Mensch ist, doch tief unter der Verzweiflung und den Selbstzweifeln findet sich eine wichtige Erkenntnis. Wenn sich Menschlichkeit durch die Fähigkeit definiert, innerhalb der eigenen Umgebung bedeutungsvoll zu handeln, sind wir nicht wirklich - oder noch nicht - menschlich.660
Der Romanautor Richard Powers weist auf eine andere Art von Verzweiflung hin, die »Einsamkeit der Spezies«, die für ihn nicht das ist, was die Umweltzerstörung in uns auslöst, sondern das, was uns dazu antreibt, ungehindert fortzufahren, nachdem wir gesehen haben, welche Spuren wir in der Welt hinterlassen: »das Gefühl, wir seien ganz allein hier und es gäbe keine sinnvollere Tat, als uns selbst zufriedenzustellen«. Dann schlägt er - ganz so, als wolle er einen gemäßigten Ableger des Dark Mountain Project begründen - einen Rückzug vom Anthropozentrismus vor, der nicht ganz einem Rückzug aus der modernen Gesellschaft entspricht: »Wir müssen unsere Blindheit in Bezug auf die Sonderstellung des Menschen ablegen. Das ist die wahre Herausforderung. Solange die Gesundheit des Waldes nicht unsere Gesundheit ist, werden wir niemals den Appetit als Hauptmotivator in der Welt überwinden.« Die spannende Herausforderung bestände darin, sagt er, den Menschen ein »Pflanzenbewusstsein« zu verschaffen.661
Diese Begriffe bieten in ihrem gesamten Bestreben einen ganzheitlichen Ansatz einer neuen Philosophie und einer neuen Ethik, hervorgerufen durch eine neue Welt. Darauf zielt auch eine Reihe kürzlich erschienener Bücher ab, deren Titel so schwermütig klingen, dass ihre Rücken unter der Last zu brechen drohen.
Das vielleicht nüchternste Buch ist Learning to Die in the Anthropocene (»Im Anthropozän sterben lernen«) von Roy Scranton, in dem der Autor, der als Soldat im Irak stationiert war, schreibt: »Die größte Herausforderung, die sich uns stellt, ist philosophischer Art: Wir müssen verstehen, dass diese Zivilisation bereits tot ist.« Sein folgendes Werk, ein Essayband, trägt den Titel We're Doomed. Now What? (»Wir sind geliefert. Was jetzt?«)
All die genannten Texte deuten auf eine Wende zum Apokalyptischen hin, sei es literarisch, kulturell, politisch oder ethisch. Doch es ist auch eine andere Entwicklung denkbar, ja sogar wahrscheinlich, und dass sie so plausibel erscheint, macht sie vielleicht umso tragischer: Es könnte sein, dass unsere Reflexe uns angesichts der menschlichen Tragödien in die andere Richtung tragen, in Richtung Gewöhnung.
Das ist die Entwicklung, deren lautes Aufjaulen vom unscheinbar klingenden Ausdruck »Klima-Apathie« erstickt wird, der sich vielleicht eher rein beschreibend anfühlt: dass wir durch Beschwörungen des Eigenen, durch die Logik der vorhandenen Mittel, durch eine absurde Umdeutung des Begriffs »verdient«, durch das stetige Verengen der Kreise, innerhalb derer wir Empathie empfinden, oder einfach dadurch, dass wir uns einfach blind stellen, wenn es gerade passt, Wege finden werden, eine neue Gleichgültigkeit an den Tag zu legen.
Richtet man vom Standpunkt der Gegenwart aus, in der sich die Erde um einen Grad erwärmt hat, den Blick in die Zukunft, wirkt die um zwei Grad wärmere Welt wie ein Albtraum - und die um drei, vier oder fünf Grad wärmere noch grotesker.
Doch eine Möglichkeit, um diesen Pfad beschreiten zu können, ohne kollektiv zu verzweifeln, besteht abstruserweise darin, die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels genauso schnell zur Normalität zu erklären, wie wir ihn vorantreiben, so wie wir es beim menschlichen Leid schon jahrhundertelang getan haben.
So kommen wir immer mit dem zurecht, was sich gerade direkt vor unserer Nase befindet, können alles verlachen, was jenseits dessen liegt, und einfach unbekümmert ausblenden, dass wir die Zustände in der Welt, die wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt erleben, einst für moralisch absolut inakzeptabel erklärt hatten.
249-250
#
www.detopia.de
^^^^
Klimakaleidoskop / Ethik am Ende der Welt / 236-250