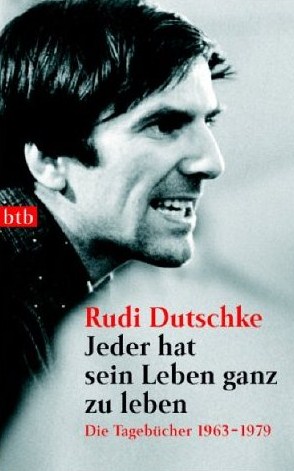|



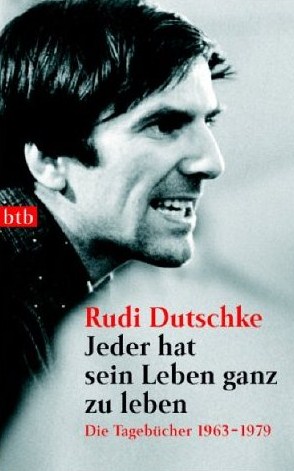

|
Youtube
"Zu Protokoll" 1967
Amazon
Dutschke
Wikipedia
Gaus (1929-2004, 75)
Rudi Dutschkes
Tagebücher sind vor allem eines:
Ein Dokument des Scheiterns
Von Fritz Raddatz
Ein
Dokument: berührend, aufregend, Applaus und Kritik gleichermaßen
provozierend. Anteilnahme allemal. Rudi Dutschke hat mit seinen
Tagebüchern die Skizze zu einem Selbstporträt geliefert, mal
Spiegelbild, mal Karikatur; Lachfalten sind nicht zu entdecken im
gläubigen, auch fanatischen Gesicht.
Gläubig?
Tatsächlich zeigen die Notate, Reflexionen, Selbsterkundungen einen zu
Beginn der sechziger Jahre tief gläubigen Christen, der an Ostern 1963
hingebungsvoll schreibt: „Jesus ist auferstanden, Freude und Dankbarkeit
sind die Begleiter dieses Tages; die Revolution, die entscheidende
Revolution der Weltgeschichte ist geschehen, die Revolution der Welt durch
die allesüberwindende Liebe. […] Das Wissen bzw. der Glaube vom
Ursprung lässt das Ziel offenbar werden […] Befreiung des Menschen
durch das Innewerden der Gottheit; Befreiung durch die Autorität;
Freiheit in der Gebundenheit an die durch Jesus offenbarte Liebe.“
Eintragungen
dieser Inbrunst finden sich zuhauf, ob Dutschke für die Gesundheit der
Eltern betet, um den Erhalt des eigenen Glaubens oder – sehr früh schon
– Sozialismus und Glaube für untrennbar erklärt: „der Welt größter
Revolutionär – Jesus Christus“. Noch 1956 betet er für die
ungarischen Aufständischen, noch 1970 – also nach dem Attentat –
denkt er in der Weihnachtsnacht an „den historisch größten Mythus“.
Es
brauchte einen sorgfältigen Essay, um die christlichen Elemente im
emotionalen wie intellektuellen Haushalt des bald prominent werdenden
Studentenrebellen darzustellen. Ich behaupte – basierend auf
recht guter Kenntnis der Person Rudi Dutschke wie aufgrund der Lektüre
vieler seiner Arbeiten –, dass das Glimmen dieser unirdischen Hoffnung
ihn zeitlebens mitbestimmte, auch, als er längst flackerndes Feuer zu
legen suchte an die Wurzeln einer von ihm verachteten Gesellschaft.
Ein
Instant-Marxismus, unverdaut zusammengelesen
War
es Verachtung? War es Hass? Liest man lediglich diese Tagebücher, erhält
man klare Auskunft nicht. Sie geben eher Zeugnis von einer Art
Selbstanstachelung, ganze Passagen lesen sich so, als habe sich da einer
selbst Fieber injiziert; das giftige Medikament in der Ampulle heißt mal
Faschismus, mal Imperialismus, mal Marxismus – Letzterer wird zum
Allheilmittel auserkoren. Werden die beiden ersten Kategorien bis zum
Keifton „die Säue“, „die Schweine“ horrifiziert, wird die
Bundesrepublik allen Ernstes als „Zentrum des Faschismus“ denunziert,
„die frappierende Zunahme der deutlichen Faschisierung in der BRD“
festgestellt – so heißt der neue Glaube nun Marxismus.
Nur
ist es ein Instant-Marxismus, in rasend durchlesenen Nächten
zusammengequirlt, hektisch, zusammenhanglos, unverdaut. Dutschke las oft
achtzehn Stunden hintereinander, verlangte übrigens recht herrisch
dasselbe von seinen Kampfgefährten – um selbst schließlich zu
konstatieren: „Die Arbeit überwog das Leben.“ Wozu andere – etwa
der von ihm verehrte Ernst Bloch – ein langes Leben brauchten (auch, um
Distanzen einzubauen), das wollte er in einem schier atemberaubenden
Galopp erobern: Marx und Lenin und Kautsky und Rosa Luxemburg und Korsch
und Mehring; Das Kapital mit Gretchen Dutschke eben mal durchgearbeitet;
alles neben den sich bald häufenden öffentlichen Auftritten, neben dem
Studium, neben zahllosen gehetzten Reisen, Artikeln, Broschüren, Querelen
im SDS, „neben“ einer Ehe und dem Erziehen von zwei Kindern. Dass das
nicht gut ging, dafür gibt es ein Indiz: die Sprache. Dutschkes Sprache,
auch vor der Hirnverletzung durch den Mordanschlag, ist schieres Chaos,
atemloser Wirbel toter, weil nicht wirklich durchdachter Begriffe:
„Wir
wollen mit den Studenten einen kritischen Dialog über die Notwendigkeit
der Durchbrechung der etablierten Spielregeln der unvernünftigen
Herrschaft in den nächsten Wochen beginnen. […] Waren uns darüber
einig, dass die ,Proletarisierung‘ der ,studentischen Rebellen‘ eine
revolutionäre Notwendigkeit ist, schließlich wird unser Programm die
Abschaffung der Arbeitsteilung und der kapitalistischen Arbeit in den
Mittelpunkt der praktischen Theorie stellen. […] Ohne direkte Aktionen
gegen die herrschende Klasse, ohne sinnliche Erfahrungen der
Arbeiterklasse im eindeutigen Klassenkampf gegen die bestehenden
gesellschaftlichen Verhältnisse der Herrschaft des Kapitals wird es keine
‚Rekonstruktion‘ der Arbeiterklasse geben.“
Weder
gibt er sich – oder uns – Rechenschaft, was die „sinnliche Erfahrung
der Arbeiterklasse“, noch, was die „Proletarisierung der studentischen
Rebellen“ sein mag. Interessant ist – Pars pro Toto – der Vergleich
mit den Thesen seines Idols Herbert Marcuse, der eben Jahrzehnte und nicht
Monate auf das Durchröntgen der kapitalistischen
Gesellschaft verwandt hatte; weswegen seine Einsichten nicht nur
klar und prägnant sind, sondern durchaus noch heute gültig:
„Toleranz
ist ein Selbstzweck. Daß die Gewalt beseitigt und die Unterdrückung so
weit verringert wird, als erforderlich ist, um Mensch und Tier vor
Grausamkeit und Aggression zu schützen, sind die Vorbedingungen einer
humanen Gesellschaft. Eine solche Gesellschaft existiert noch nicht.“
Erhabener
Anspruch und miserable Praxis
Es
hat durchaus einen Zug des Tragischen, wie dieser ruhelose, durch die Zeit
rasende Mann – „Habe keine Uhr seit Monaten“ notiert er einmal –
auch durch das eigene Leben hastet. Er kann zwar bei anderen „eine
gewisse Starre des Denkens und Formulierens“ beobachten, Lachen
vermissen – aber dass er sich hinter selbst gebastelte Gitter verbannt
hat, scheint Rudi Dutschke nicht zu spüren. Sonst könnte er nicht von
einer „sehr guten, mehr oder weniger schönen sexual-ökonomischen Nacht“
mit seiner Frau sprechen, die er zwar betrügt wie jeder
Kreissparkassenangestellte, um dann festzustellen, „der sexuelle Motor
scheint zwischen uns beiden nicht zu arbeiten“ – mit der er aber kaum
darüber spricht.
„Erstmalig
seit einer Ewigkeit ein intensives zweistündiges Gespräch über uns
selbst und unser Verhältnis gehabt“, verrät das Tagebuch im Februar
1971. Was dann an abstruser, alphabetisch geordneter Auflistung der „Gesprächspunkte“
kommt, ist nachzulesen auf Seite 156 des Buches. Die alte Frage immer
wieder: die Künder des „neuen Menschen“ leben keineswegs neu,
vielmehr in den alten Mustern fort. Nun erinnern wir uns an den törichten
Protz-Spruch „Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum
Establishment“ (den seltsamerweise die Kommune-Damen nicht umdrehten in
„mit demselben“).
Doch
diese Beschreibung eines Abenteuers – Dutschke nennt sich „besonders
initiiert“ – ist dann doch von peinigender Banalität: „Als Manfred
mich für die Diskussion über politisch-sexuelle Probleme abholte, ging
ich direkt vor der Abfahrt zu ihr und sagte: ,Jutta, du regst mich auf.‘
Ging raus, rannte noch einmal zurück und sagte ihr: ,Ich komme bald
wieder.‘ Leider war es 4:00 Uhr am frühen Morgen, so begann unser
direktes Verhältnis erst am nächsten Tag. Wir liebten, soweit das
möglich war. Sie hatte ihrem Freund in Cambridge gesagt, dass sie etwas
später kommen wird. Leider musste ich sie ,enttäuschen‘, in Hamburg
hatte ich über Solschenizyn zu sprechen, die Liebe zur Revolution und
Politik bedeutet dann mehr als zu einer lieben Genossin.“
Derlei
lässt sich wahrlich mühelos rückübersetzen ins böse kapitalistische
Leben, da stünde allenfalls „Leider musste ich in Düsseldorf über die
Profitrate sprechen“, und im letzten Satz müssten nur die Begriffe
ausgetauscht werden – „als die Liebe zu meiner Frau und den Kindern“
–: fertig ist das bewährte Drehbuch.
So
energisch ich mich wehre gegen das abschätzige Urteil über „die 68er“
– ohne deren Mut, Anstoß und Aufbegehr so manche Verkrustung uns
erhalten geblieben wäre –, so vehement stoßen mir doch immer wieder
die Widersprüche zwischen erhabenem Anspruch und miserablem Einlösen
auf. Rudi Dutschkes Tagebuch ist auch insofern ein
Dokument: des notwendigen Scheiterns nämlich.
Dabei
sein Leben zum Tode hin, nach dem Attentat, ein wieder anderes Zeugnis
gibt. Von einem so tapferen, so zähen Kampf des Schwerstverletzten, den
seine Witwe im Nachwort schildert: „Die Zerstörung seines Gehirns war
weit größer, als man zunächst annahm. Zwei Kugeln wurden durch sein
Gehirn geballert und haben viele Narben von totem Gewebe hinterlassen.“
Es
ist nahezu grässlich zu lesen, wie er sich einerseits aufbäumt,
Sprechen, Lesen neu erlernen muss und – zwischen Pillen, epileptischen
Anfällen und ohnmachtsähnlicher Müdigkeit – andererseits immer und
immer wieder der schwarze Zweifel herbeischleicht: „Ganz gesund werde
ich wohl nie mehr.“ Eintragungen über so viel Angst, Schmerz, Verzagen,
dass man heulen möchte. Die Trauer um diesen Menschen ist das Bleibende.
Diesem
Gebot des noblen Umgangs mit dem Nachlassbuch Rudi Dutschkes hat der
Verlag leider keineswegs entsprochen. Die Sorglosigkeit der Edition
ist haarsträubend. Das galt ja bereits für den kleinen Erinnerungsband
des Sohnes Marek, den man so nachlässig betreute, dass auf Seite 13 von
„der Kugel“ in den Kopf gesprochen wird, auf Seite 27 von „Bachmanns
Kugeln aus Kopf und Körper operiert“ und schließlich im Verlagstext
„die Kugeln, die ihm Bachmann in den Kopf geschossen hatte“, steht.
Schon das eine empörende Schlampigkeit.
Falls
es damals noch einen Lektor im Hause Kiepenheuer & Witsch gegeben
haben sollte – jetzt hat man ihn ganz offensichtlich nicht mehr
beschäftigt. Die Anmerkungen muss ein Kind formuliert haben, das nie
davon erfahren hat, dass Thomas Brasch verstorben ist oder dass McCarthy
immerhin US-Senator war, dafür aber Jaspers „Philosoph, Psychiater und
politischer Schriftsteller“ nennt, Andrzej Wajda „berühmt“ sein
lässt, Alexander Blok dafür nur „bedeutend“, und der Schriftsteller
Peter Schneider darf überhaupt nur „Publizist“ sein. Ralf Dahrendorf
ist „Politologe, Mitglied der F.D.P.“, dafür wenigstens geboren,
während John Arden – „ist ein englischer Dramatiker“ – keine
Lebensdaten gegönnt sind.
Mal
ist jemand „bedeutendst“, mal wird einem Schriftsteller ein Tagebuch
zugeschrieben, das es nicht gibt, und mal „besaß“ Giangiacomo
Feltrinelli – darin offenbar gelegentlich am Kamin schmökernd – eine
„umfassende Bibliothek zur internationalen Arbeiterbewegung“, statt
korrekt anzugeben, dass der italienische Verleger das neben Moskau und
Amsterdam drittgrößte Forschungsinstitut zu dem Thema stiftete.
Kurzum: eine Frechheit gegenüber dem Publikum und eine Schnödigkeit
gegen Rudi Dutschke. Der Verlag sollte diese rundum katastrophale
Nicht-Edition schleunigst vom Markt nehmen und einem verantwortungsvollen
Herausgeber eine Neuausgabe überantworten.
Die Tagebücher 1963–1979;
hrsg. von Gretchen Dutschke; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
2003; 432 S.
DIE ZEIT 13/2003
Adresse: zeit.de/2003/13/P-Dutschke
|