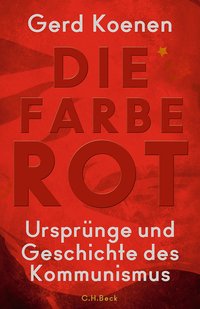 |
Komm(unismus)buchThemenseite
Forschungs- und Erklärbücher
zum Marxismus,
Sozialismus, |
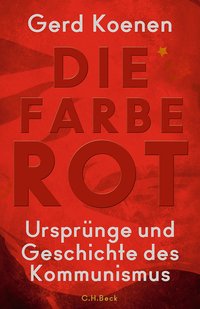 |
Komm(unismus)buchThemenseite
Forschungs- und Erklärbücher
zum Marxismus,
Sozialismus, |
gute zusammenfassung qwant das+rote+imperium+dokumentation
zdf.de schwert-und-schild-russlands-geheimdienste-fsb-und-putins-russland 3/3 bis 3.9.24 ZDF-2019
|
1800 - 1899 1825 Dekabristen-Aufstand in Petersburg (Wikipedia) Rebellion mit demokratischen Zielen in Petersburg im Dezember 1847 Grundsätze des Kommunismus - (Erster) Kongress des Bundes der Kommunisten (Friedrich Engels) 1848 Manifest der kommunistischen Partei - "Das kommunistische Manifest" / Karl Marx und Friedrich Engels
1854 "Solcherart ist die russische Propaganda:
Unendlich variierend, je
nach den Völkern und den Ländern. 1870 "Ich befürchte für das nächste Jahrhundert einen Dschingis Khan mit einem Telegraphen." / Alexander Herzen 1870 Staatlichkeit und Anarchie / Michael Bakunin 1883 Widerlegung des "Rechts auf Arbeit" von 1848 / Paul Lafargue 1883 Sozialismus und politischer Kampf / Georgi Plechanow 1891 Sozialdemokratische Zukunftsbilder - frei nach Bebel / Eugen Richter 1899 Erzählung vom Antichrist - "Das Mongolenjoch" / Wladimir Solowjew |
2018 dlf Der Mut der Verzweifelung - sowjetische Dissidenten - PDF
|
1905 Über den monarchistischen Staat (Lew Tichomirow) 1907 Der rote Planet - Utopischer Roman / Alexander Bogdanow
|
|
1911 Gustav Landauer Der Marxismus "Willst du die Massen gewinnen, so schmeichle ihnen."
1917
Plechanow: "Die russische
Geschichte hat noch nicht das Mehl gemahlen, 1918 Karl Kautsky Die Diktatur des Proletariats 1918 Rosa Luxemburg Zur russischen Revolution 1918 Der Zusammenbruch des Marxismus (Paul Carl Ernst) 1919 Zehn Tage, die die Welt erschütterten / John Reed, ein Tagebuch der Oktoberevolution |
|
1920 Winston Churchill: "Erwürgt das sozialistische Baby in seiner Wiege." (nach Pete Seeger, auch bei Wikipedia.) 1923 Wir - Zukunftsroman mit Nachwort von Jürgen Rühle / Jewgenij Samjatin 1923 Der rote Terror in Russland 1918-1923 / S. Melgunow 1924 Die Reiterarmee / Isaak Babel 1925 Die Soziologie der Revolution / Pitirim Sorokin 1927 Das neue Mittelalter - Betrachtungen über das Schicksal Russlands und Europas / Nikolai Berdjajew
|
|
1930 Welt vor dem Abgrund - Politik, Wirtschaft und Kultur im kommunistischen Staate (Iwan Iljin u.a.) 1930 Wahrheit und Lüge des Kommunismus / Nikolai Berdjajew 1931 Studenten, Liebe, Tscheka und Tod / Alja Rachmanowa 1932 wikipe Pawel Morosow und sein Bruder getötet, "Heldenpionier Nr. 001" 1933 Massenpsychologie des Faschismus / Wilhelm Reich 1934 Der Arbeiterkult des Marxismus / Camillo Berneri 1934 erschossen in Leningrad: wikipe Sergei M. Kirow 1935 Die Fabrik des neuen Menschen / Alja Rachmanowa 1936 Der junge Lenin (Leo Trotzki) 1937 Stalins Verbrechen (Leo Trotzki) 1937 Mein Katalonien / George Orwell 1938 Zur Analyse der Tyrannis (Manes Sperber) 1938 Simone Weil 1938 Dshan, Takyr, Baugrube, Moskwa (Platonow) |
|
1940 Sonnenfinsternis - Roman (Arthur Koestler) 1940 Der Meister und Margareta (Michail Bulgakow) ferttiggestellt 1940; first edition: 1966 auf russisch 1944 Workers in Stalin's Russia (Marie Berneri) 1945 Farm der Tiere. Eine Fabel. Mit dem Essay "Über die Pressefreiheit" (George Orwell) 1947 Ist das ein Mensch? Ein Jahr in Auschwitz (Primo Levi) 1947 Trotzdem JA zum Leben sagen - Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager / Viktor Frankl 1948 1984 - Zukunftsroman (George Orwell) 1948 Landwirtschaft in Russland (Fairfield Osborn) 1948 Bemerkungen über die Bedeutung der Freiheit (Theodor Plevier) 1949 Wie eine Träne im Ozean - Autobiografischer Roman (Manes Sperber) 1949 Stalin - Eine politische Biografie / Isaac Deutscher |
|
1951 Welt ohne Erbarmen - Erlebnisse in russischen Arbeitslagern (Gustaw Herling) 1955 Die Revolution entläßt ihre Kinder (Wolfgang Leonhard) 1956 Über den Personenkult und seine Folgen - "Geheimrede" (Nikita Chrustschow) 1956 Doktor Schiwago / Boris Pasternak wikipedia 1957 Von Marx zur Sowjetideologie (Iring Fetscher) |
|
1960 Elias Canetti Masse und Macht 1961 Flucht aus der Sowjetunion (Nurejew, Ballett) 1962 Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch (Alexander Solschenizyn) 1964 Joseph Brodsky (Richterfrage: "Wer hat denn anerkannt, dass Sie Dichter sind? Wer hat Sie zum Dichter ernannt?") 1966 Geschichten aus Kolyma (Warlam Schalamow) 1967 Marschroute eines Lebens - Gratwanderung (Jewgenia Ginsburg) 1969 Die Reise nach Petuschki (Wenedikt Jerofejew) |
|
1973 Der Archipel Gulag - Versuch einer künstlerischen Bewältigung (A. Solschenizyn) 1973 Vergib mir, Natascha (Sergej Kourdakov) 1974 Kindheit im Zaren-Russland (Lloyd deMause) 1975 Waleri Sablin - Schiffsaufstand - Roter Oktober Tragischer Held der Sowjetunion 1976 Politische Gefangene in der Sowjetunion. Dokumente (Jean Amery u.a.) 1977 Die Alternative (Rudolf Bahro) Charta 77 (Vaclav Havel) 1978 "Überläufer" Arkadi Schewtschenko "Mein Bruch mit Moskau" (1984) |
|
1980 Morgen. Die Industriegesellschaft am Scheideweg. Kritik und reale Utopie. (Robert Havemann) 1980 Aitmatow Der Tag zieht den Jahrhundertweg = Ein Tag, länger als ein Leben 1981 Freie russische Literatur 1955-1980 - Der Samisdat in der Sowjetunion (Juri Malzew) 1983 Stanislaw Petrow - Atomkriegsverhinderer 1984 Sie und Wir - Kontroverse um Menschenrechte (Wladimir Maximow) 1985 Mein Bruch mit Moskau (Arkadi Schewtschenko) 1986 "Historikerstreit" - Nolte, Fest, Holocaust, Singularität - wikipedia Historikerstreit 1989 Stalin.Triumph und Tragödie. Ein politisches Porträt. (D Wolkogonow) 1989 Das Beispiel Russland - Kapitel aus Vormundschaftlicher Staat (Rolf Henrich)
|
|
2001 Steinerne Nächte - Leiden und Sterben in Russland (Catherine Merridale) 2003 Der Gulag. Eine Historie (Anne Applebaum) 2003 Der rote Terror - Die Geschichte des Stalinismus (Jörg Barberowski) 2004 Stalin - Am Hofe des roten Zaren (2004) (Simon Montefiore) 2004 Stalins Tochter - Das Leben der Swetlana Allilujewa (Martha Schad) 2005 Mao. Das Leben eines Mannes. Das Schicksal eines Volkes (Chang, Halliday) 2006 Totgelacht - Der politische Witz im Kommunismus / Dokufilm 2006 Iwans Krieg - Die Rote Armee 1939-1945 (Catherine Merridale) 2007 Die Flüsterer - Leben in Stalins Russland / Orlando Figes 2007 Der "verfluchte Orden" : Schalamov, Solschenizyn und die Kriminellen / Michail Ryklin 2009 Weltgeschichte des Kommunismus - Von der Französischen Revolution bis heute (David Priestland)
|
2022 Der-Faschismus-und-wir-Alles-bewaeltigt-und-nichts-begriffen Bernhardt
2022 Was-die-Querdenker-eint Schuster
|
wikipe Oleg_Danilowitsch_Kalugin *1934 in Leningrad https://de.wikipedia.org/wiki/Arkadi_Maslow *1891 in Mittelukraine bis 1941 https://de.wikipedia.org/wiki/Ruth_Fischer *1895 in Leipzig bis 1961 in Paris https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Jung *1888 in Oberschlesien bis 1963 in Stuttgart
|
|
Die Mühle aus: Wladimir Bukowski, "Abrechnung", Seite 133 In der Praxis wurde mit dieser Maßnahme jedoch großer Mißbrauch getrieben, und es wurde gegen unschuldige sowjetische Bürger anstatt gegen wirkliche Feinde des Sowjetstaats vorgegangen. Der ehemalige Leiter der Chabarowsker Verwaltung des NKWD Gogolidse und der ehemalige Leiter der Zweiten Verwaltung des NKWD Fedotow benutzten die <Mühle> für staatsfeindliche Ziele, um Belastungsmaterial gegen sowjetische Bürger zu fabrizieren. Die <Überprüfung> in der berüchtigten <Mühle> begann damit, daß man der Person, die der Spionage oder anderer antisowjetischer Tätigkeit verdächtigt wurde, vorschlug, Aufgaben im Gebiet hinter der Grenze für den NKWD auszuführen. Nachdem der <Verdächtige> seine Zustimmung gegeben hatte, wurde seine Einschleusung in die Mandschurei von der fiktiven sowjetischen Grenzwache aus und seine Festnahme durch angebliche japanische Grenzbehörden inszeniert. Dann wurde der <Festgenommene> in das Gebäude der <japanischen Militärmission> gebracht, wo er einem Verhör durch die NKWD-Mitarbeiter unterzogen wurde, die die Rolle von offiziellen Mitarbeitern der japanischen Aufklärungsorgane und russischen weißgardistischen Emigranten spielten. Das Verhör sollte erreichen, daß der <Verdächtige> gegenüber den <japanischen Behörden> Verbindungen zur sowjetischen Aufklärung gestand. Zu diesem Zweck fanden die Verhöre unter äußerst harten Bedingungen statt, die den moralischen Zusammenbruch des Menschen beabsichtigten, wobei verschiedene Drohungen sowie physische Gewalt angewendet wurden. Viele Personen, die künstlich in eine für sie ungewöhnliche und schwere Lage versetzt worden waren, berichteten den als Japaner auftretenden Mitarbeitern des NKWD, in der Annahme, daß sie sich wirklich in Feindeshand befänden und jederzeit physisch vernichtet werden könnten, über ihre Verbindungen mit den Organen des NKWD und über die Aufgaben, die sie in der Mandschurei ausführen sollten. Einige dieser Bürger lieferten angesichts der Lebensgefahr, in der sie sich wähnten, und unter der Einwirkung physischer Gewalt Informationen über die Sowjetunion. Nach dem Ende der Verhöre, die mitunter einige Tage oder sogar Wochen dauerten, wurde der <Festgenommene> von den japanischen <Aufklärungsorganen> abgeworben und auf sowjetisches Gebiet geschickt, um Aufklärungsaufgaben auszuführen. Das Schlußkapitel dieses Provokationsspiels bestand darin, daß der <Überprüfte> von den Organen des NKWD verhaftet und danach als Vaterlandsverräter von den Sonderkollegien zu langem Freiheitsentzug oder zur Erschießung verurteilt wurde. |
"Solcherart ist die russische Propaganda, unendlich variierend, je nach den Völkern und den Ländern.
Gestern sagte sie uns: <Ich bin das Christentum!> Morgen wird sie uns sagen: <Ich bin der Sozialismus!>"
detopia-2024
moderne Dokumentarfilme - etwa:
zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/geheime-welten-reise-in-die-tiefe-100.html über den Bunkerbau im Zarenreich, Sowjetunion und Russland
zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/lost-places-geheime-welten-100.html (muss ich mal hier unterbringen)
älter: Aufstieg und Fall des Kommunismus - 1 - Karl Marx und die Idee https://www.youtube.com/watch?v=fjtHD2xNhok
Kommunismusbuch