
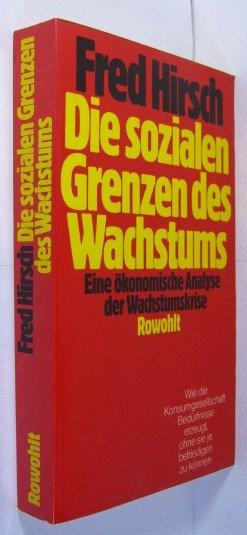


3. Wächst das Rettende noch? Von Eppler-1981 ( ähnlich: Bahro-1987 )
"Vielleicht
haben wir in diesem Jahrhundert - weit mehr, als uns bewußt war - von dem
Regen gelebt, der aus den Wolken von lebendigen Utopien kam.
Und
vielleicht hängt die Lähmung unserer Gesellschaft auch damit zusammen,
daß es massenwirksame Utopien nicht mehr gibt."
(Seite 107)
99-121
Gelähmte Gesellschaft?
Wo Gefahr sei, wachse das Rettende auch, war die Hoffnung, an die Friedrich Hölderlin sich klammerte. Wächst in unserer Zeit noch Rettendes, das der Gefahr entspräche? Es gibt Augenblicke, in denen man daran zweifeln, verzweifeln mag. Wohin man blickt, festgefügte, bürokratisierte, erstarrte Machtapparate, die sich zunehmend dem Zweck entfremden, um dessentwillen sie geschaffen wurden; Apparate, für die Zukunft zuerst und vor allem ihre eigene Zukunft ist, die Zukunft der bürokratisierten Institution.
Bewegt sich etwas an der Basis, so empfinden die Verwalter von Macht dies meist nicht als Chance, sondern als Störung und Bedrohung und wissen sich dagegen zu wehren. Dies gilt heute, wenn auch nicht überall in derselben Weise, für Interessenverbände und Großkonzerne, für Verwaltungen und Parlamentsfraktionen, für Parteien und Gewerkschaften, für Rundfunkanstalten und Zeitungsredaktionen, im Kern auch für beide großen Kirchen.
Aber damit allein ist nicht die eigentümliche Lähmung zu erklären, die unsere Gesellschaft ergriffen hat. Das Maß an fatalistischem Gleichmut, mit dem die Mehrheit der Menschen sich mit beängstigenden Tatbeständen abfindet, kann nicht einfach erstarrten Institutionen angelastet werden.
Wie kommt es, daß fast alles ohne erkennbares Aufbäumen hingenommen wird: die Mitteilung der FAO (Landwirtschaftsorganisation der UNO), daß jährlich etwa 55 Millionen Menschen, darunter 17 Millionen Kinder unter fünf Jahren, an Unterernährung sterben; die Überlegungen Weizsäckers, was nach der Katastrophe geschehen müsse; die Diskussion darüber, ob man wegen der chemischen Rückstände in der Muttermilch jungen Müttern noch raten könne, ihre Säuglinge zu stillen; das Morden in El Salvador oder Afghanistan; die zunehmende Hilflosigkeit der politischen Führungsgruppen; ein Wahlkampf, der — allen Zukunftsaufgaben zum Trotz — über das Aufrechnen und Beschimpfen nicht hinauskommt?
Vielleicht rührt so viel geduldige Resignation daher, daß die Menschen von der einen Seite auf Sachzwänge verwiesen, von der anderen mit apokalyptischen Bildern vom Weltuntergang geschreckt werden.
Von den einen hören sie, daß man, wolle man «realistisch» bleiben, so weitermachen müsse wie bisher, von den anderen, daß wir eben dadurch in eine Serie von Katastrophen schlittern müßten. Was die Bürger nicht - oder doch zu undeutlich - vor sich sehen, sind Wege, die aus den Sachzwängen heraus und an den Katastrophen vorbei führen können.
Völlig niederschmetternd muß es wirken, wenn sich führende Politiker abwechselnd, je nach taktischen Erfordernissen, in apokalyptischen Visionen einer niederbrechenden Weltwirtschaft ergehen und dann wieder versichern, sie würden auf hergebrachte Weise und mit erprobten Mitteln die entstehenden Krisen schon meistern. Freimut Duve hat dieses Zusammenspiel von Sachzwang-Ideologie und Apokalypse einmal so beschrieben:
«Wir haben reale Weltbedrohung - die Rohstoffe gehen wirklich rasch zur Neige, wenn die Verschwendungsstruktur unserer Wirtschaft nicht umgeschaltet wird, wir haben wirkliche, endzeitliche Vergiftungsgefahren der Organismen durch die chemische Industrie, aber - und hier kommt die zweite Bedrohung für Politik -, Apokalypse ist ein schlechter Politik-Ersatz. Weltuntergangsstimmung ist Stimmung, und Stimmung ist nicht Politik. Bei vielen Bürgern geht das Verständnis für Politik — also für den Kompromiß, für das Austarieren, für die radikale Ausschöpfung des Möglichen zugunsten des Notwendigen — verloren. Die apokalyptischen Ängste sind bestens geeignet, den großen Entpolitisierern Vorschub zu leisten, die gerne den Bürger ausschalten möchten aus seiner Mitwirkung. (...) Die Wiedergewinnung von Politik muß also von zwei Seiten in Angriff genommen werden: Kampf gegen den Sachzwangstaat und Kampf gegen den Geist der Apokalypse. (...) Niemand ist leichter in den Sachzwinger zu sperren, als der von Weltuntergangsängsten total entpolitisierte Bürger.»(1, Freimut Duve, Vortrag vor der Gustav-Heinemann-Initiative im Mai 1980, in: Wer macht die Zukunft?, Stuttgart 1980, S. 16)
Die gelähmte Gesellschaft kommt nicht von ungefähr. Vielleicht hat jeder auf seine Weise dazu beigetragen. Nur wenn wir die Ideologie von den Sachzwängen überwinden und die Freiheit politischen Handelns wiedergewinnen, werden Gefahren wieder, was sie sind: nicht schicksalhafte Abläufe, sondern Bedrohungen, mit denen wir um so besser fertig werden, je nüchterner wir sie erkennen und je illusionsloser wir ihnen entgegentreten.
100
Die Konservativen
Am trostlosesten sieht es da aus, wo man den Willen zum Bewahren erwarten sollte. In einer Zeit, in der es wahrlich einiges zu bewahren und wiederherzustellen gibt, von den natürlichen Lebensgrundlagen bis zum Charakter unserer Städte, von der psychischen Gesundheit unserer Kinder bis zur Würde menschlichen Sterbens: Worauf konzentrieren sich in einer solchen Zeit die Kräfte, die sich konservativ nennen?
Nirgendwo findet man heute naiven Glauben an technischen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum so säuberlich konserviert wie bei Konservativen. Den Blick starr auf eigene Interessen und die eigene Macht gerichtet, werden neue Fragestellungen, auch wenn sie letztlich aus dem Willen zum Bewahren kommen, einfach nicht zur Kenntnis genommen.
Was es zu erhalten gilt, sind Machtstrukturen, die Ordnungen in Wirtschaft, Gesellschaft, Staat, Kirchen, wobei man sogar die Dynamik des Grundgesetzes in eine freiheitlich-demokratische Grundordnung einzufangen versucht. Wachstum ist gut, weil ohne dieses Wachstum Machtstrukturen in Gefahr gerieten; Kernenergie ist gut, weil sie für das Wachstum nötig ist; Kabelfernsehen ist nötig, weil es Wachstum schafft, und es gibt kaum ein unsinniges Autobahnprojekt, das die Konservativen nicht mit scharfen Krallen verteidigt hätten.
1975 habe ich vorgeschlagen, zwischen Wertkonservativen und Strukturkonservativen zu unterscheiden. (2, Erhard Eppler, Ende oder Wende, S. 34)
Heute, nachdem diese Begriffe in die öffentliche Diskussion eingegangen sind, ist es vielleicht angebracht, etwas über ihre Entstehung zu sagen:
101
Es war der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, der gegen ein ihm vorgelegtes Grundsatzpapier eingewandt hatte, hier sei der Begriff «konservativ» zu einseitig und zu negativ verwendet. Beim Nachdenken über diese — wie mir schien, völlig berechtigte Kritik Willy Brandts — wurde mir klar, daß heute mit «konservativ» völlig verschiedene, ja sich gegenseitig ausschließende Haltungen bezeichnet werden.
Man konnte doch wohl den Winzern und Hausfrauen im Wyhler Umland nicht mit demselben Begriff gerecht werden wie dem Ministerpräsidenten, der sie als Mitläufer der Kommunisten beschimpfte. Man konnte nicht gut junge Leute, die sich in alternativer Landwirtschaft versuchten, genauso als konservativ bezeichnen wie den Präsidenten des Bauernverbandes, der sie für mehr oder minder harmlose Narren hielt. Man konnte nicht gut von einer konservativen Verkehrsbürokratie sprechen und dann auch die Bergbauern konservativ nennen, die dieser Bürokratie erbittert und mit keineswegs konventionellen Mitteln Widerstand leisteten.
Wenn es konservativ war, mit Hamlet daran zu glauben, daß es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit sich träumen läßt, war dann der Top-Manager auch konservativ, für den nur zählte, was sich zählen und berechnen ließ, dem seine altliberalen Vorstellungen von Freiheit der Wirtschaft dazu dienten, seine Machtpositionen abzusichern, zu konservieren?
Gegen jeden neuen Begriff läßt sich einiges einwenden, auch gegen die Unterscheidung von wert- und strukturkonservativ. Natürlich läßt sich nicht immer eine säuberliche Trennungslinie zwischen Strukturen und Werten ziehen. In vielen, nicht in allen Fällen wäre es angebracht, eher von Machtkonservativen als von Strukturkonservativen zu sprechen. Aber solche Begriffe sind soviel wert, wie sie Wirklichkeit erschließen, klarere Unterscheidungen zulassen, Sachverhalte klären helfen.3
Es gibt heute eine nicht ganz kleine Zahl von Menschen, die sich selbst als wertkonservativ verstehen, als Menschen, die, um Werte zu bewahren, Reformen durchsetzen wollen oder gar revolutionär zu handeln bereit sind. Die meisten Bürgerinitiativen — und sie können heute mehr Menschen mobilisieren als alle Parteien zusammengenommen — verstehen sich als wertkonservativ, dies gilt auch für viele Gruppen, die sich um einen neuen Lebensstil bemühen oder - innerhalb und außerhalb der Kirchen - Friedensarbeit leisten.
3) Klarere Unterscheidung unterschiedlicher Sachverhalte ist durch diese Begriffe auch dann möglich, wenn man die Kritik am Wertbegriff einbezieht, die von Sepp Schelz (unter Berufung auf Carl Schmitt) und Eberhard Jüngel geübt wurde.
Siehe Carl Schmitt, Eberhard Jüngel, Sepp Schelz, Die Tyrannei der Werte, Hamburg 1979
102
Daß an der Unterscheidung zwischen Wert- und Strukturkonservativen etwas sein muß, wird deutlich, wenn man die inneren Verkrümmungen und Verbiegungen beobachtet, die entstehen, wo man gleichzeitig wert- und strukturkonservativ sein möchte.
Iring Fetscher ist diesem wenig erfreulichen und noch weniger erfolgreichen Bemühen in einem brillanten Aufsatz nachgegangen.(4. Iring Fetscher, Widersprüche im Neokonservatismus, in: Merkur 2/1980, S. 107)
Fetscher, der sich dabei auf eine Arbeit des Amerikaners Michael Walzer stützt, rechnet den Neokonservativen vor, daß überall, wo sie über Verfall von Werten klagen, nichts anderes vorliegt als die durchschlagende Wirkung der Strukturen, denen sie sich verpflichtet fühlen. wikipedia Michael_Walzer *1935
Worüber klagen diese neuen Rechtsintellektuellen, die sich meist Liberale nannten - es in allen Fragen der Wirtschaft weiterhin sind - sich heute aber als Neokonservative verstehen?
«Über den Verlust der Autorität in Schule, Hochschule, Armee, Kirche, Betrieb usw., über das Verschwinden traditioneller Formen im alltäglichen Umgang: Hochachtung und gegenseitiges Vertrauen seien dahin, soziale Bande hätten sich aufgelöst, weder die Mitglieder von Familien noch die Bürger von Gemeinden oder Nachbarschaften oder die Angehörigen eines Betriebes begegneten einander anders denn als egoistische Individuen voller Feindseligkeit und Mißtrauen. Traditionelle Werte wie Mäßigung, Respekt, Anstand, Arbeitsamkeit, Selbstdisziplin seien vernichtet. Das Ergebnis sei eine Welt der Dekadenz, der Wurzellosigkeit und der Vulgarität, in der egoistischer Ehrgeiz und persönliche Lustbedürfnisse rücksichtslos durchgesetzt werden. Alle verlangen sie <Glück und unverzügliche Befriedigung>; es ist eine <Welt von häßlichen Hedonisten>.»(5. ebenda, S. 107)
103
Niemand wird behaupten können, daß diese Klagen ganz ohne Bezug zur Wirklichkeit seien. Die Frage ist nur: Wie ist dies gekommen? Nur weil die Menschen — aus unerfindlichen Gründen — heute schlechter wären als früher?
Fetschers (und Walzers) Antwort: Die Menschen sind so, wie ein Gesellschafts- und Wirtschaftssystem sie macht, das vom Konkurrenzkampf lebt, von der Jagd nach dem wirtschaftlichen Erfolg, vom unaufhörlichen Anstacheln des persönlichen Egoismus durch immer raffiniertere Werbung:
«Die Verallgemeinerung des Konkurrenzkampfes - in Gestalt des Strebens nach Maximalkonsum - ist eine Folge der Verwandlung des asketischen Frühkapitalismus in den modernen Industriekapitalismus mit seinem Massenangebot an Waren und seiner an alle gerichteten Werbung zu ständig erweitertem Konsum.»6
Statt die Ursachen für den von ihnen beklagten Wertverfall — es wird auch darüber zu sprechen sein, wo es sich eher um Wertwandel als Wertverfall handelt — an der von ihnen propagierten und gestützten Wirtschaftsform festzumachen, suchen sie allerhand Sündenböcke, den Wohlfahrtsstaat, die soziale Sicherung, oder sie suchen Schuldige unter denen, die ihre Zweifel an einem System haben und äußern, das solche Wirkungen hervorbringt.
Daniel Bell(7) hatte schon daraufhingewiesen, daß unsere kapitalistischen Gesellschaften gleichzeitig zwei sich widerstreitende moralische Normensysteme verlangen, ein streng puritanisches für die Produktion, wo Fleiß, Pünktlichkeit, Disziplin, Sparsamkeit, Ausdauer einen hohen Marktwert haben, zum anderen ein hedonistisches für den Konsum, der nur funktioniert, wenn die Menschen sich nicht beherrschen, sondern ihren Bedürfnissen — und was sie dafür halten sollen — so rasch und gründlich wie möglich freien Lauf lassen.
Bell: «Einerseits möchten die Wirtschaftsunternehmen, daß der Mensch hart arbeitet, eine Karriere anstrebt, Aufschub von Befriedigungen hinnimmt ... Im Gegensatz dazu propagieren sie in der Werbung... Lust und Vergnügen, sofortigen Spaß, Erholung, Sichgehenlassen. Man hat am Tage korrekt und am Abend ein Herumtreiber zu sein.»8
Würden wir uns im Arbeitsleben so undiszipliniert benehmen, wie wir uns als Konsumenten verhalten sollen, so wäre dies das Ende des industriellen Kapitalismus, weil die Produktivität rapide absinken müßte. Würden wir uns als Konsumenten so puritanisch verhalten, wie man es von uns im Arbeitsleben erwartet, wäre das Ergebnis genauso katastrophal, weil die produzierten Waren nicht absetzbar wären.
6) ebenda, S. 109 7) Daniel Bell, Die Zukunft der westlichen Welt, Frankfurt 1976 8) ebenda, S. 90
104
Bei Menschen, die nicht schizophren werden wollen, kann so etwas nicht allzulange gutgehen. Und deshalb stellt schon Fred Hirsch9 fest, der moderne Kapitalismus zehre von moralischen Haltungen, die er selbst ständig aushöhle. Der Wunsch des einzelnen , seine Bedürfnisse rasch zu befriedigen — Motor der kapitalistischen Wachstumsgesellschaft —, werde einerseits dauernd frustriert—wenn alle auf Zehenspitzen stehen, sieht keinerbesser —, zum anderen zehre der brutale Konkurrenzkampf das ethischreligiöse Erbe auf, ohne das ein gedeihliches Zusammenleben nicht gelinge. Das gehe so lange noch gut, wie sich nicht alle nach den Spielregeln der Konkurrenzgesellschaft verhielten.
Jetzt, wo die Mehrheit sich so verhält, wie die Gesetze der Konsum- und Konkurrenzgesellschaft es verlangen, beginnt das Jammern derer, die jede grundsätzliche Kritik an dieser Gesellschaft für gefährlich, wenn nicht kriminell halten. Fetscher: «Der Widerspruch in der Haltung von Neokonservativen besteht darin, daß sie die Folgen einer Entwicklung beklagen, die sie gleichwohl für das Nonplusultra der Geschichte halten.»10 So erleben wir es heute, daß dieselben Konservativen, die täglich ihrer Sorge um die Familie bewegenden Ausdruck verleihen, vom Arbeitnehmer mehr Mobilität verlangen, Schichtarbeit für die natürlichste Sache einer modernen Industriegesellschaft halten oder die Einführung des Kabelfernsehens betreiben, obwohl dies alles den Zusammenhalt von Familien zusätzlich belastet.
Dieselben Konservativen, die sich über die laxe Begehrlichkeit junger Menschen ereifern, sehen die heiligsten Güter der Marktwirtschaft bedroht, wenn die Werbung eingeschränkt werden soll, die - auf die Kinder gezielt - stündlich Begehrlichkeit wecken will. Man tabuisiert die Strukturen und predigt wortreich gegen die Wirkungen an, die diese Strukturen haben müssen.
9) Fred Hirsch, a.a.O., S.143 10) Iring Fetscher, a.a.O., S.110
105
Fetscher rechnet den Neokonservativen vor, was sie tun müßten, wenn sie die von ihnen beschworenen Werte ernst nähmen: «Sie müßten sich — zusammen mit selbstkritischen Linken — für Veränderungen unserer Gesellschaft engagieren, damit in ihr gegenseitiges Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Solidarität, Anstand, Respekt, Freundlichkeit wieder allgemein möglich werden.»11
Die Konservativen wären dann Verbündete eines Erich Fromm, der aus einem wertkonservativen Ansatz heraus deutlich macht, wie Menschen und Gesellschaften krank werden, wenn der Modus des Habens den des Seins erdrückt, der aber dann konsequent genug ist, auch die Frage nach den bestimmenden Kräften in der Gesellschaft zu stellen, die dies bewirken: «Die Entwicklung dieses Wirtschaftssystems wurde nicht mehr bestimmt durch die Frage: Was ist gut für den Menschen, sondern durch die Frage: Was ist gut für das System?»12
Und sie müßten mit Fromm Konsequenzen ziehen, zum Beispiel diese: «Das Ziel wirtschaftlichen Wachstums müßte aufgegeben beziehungsweise durch selektives Wachstum ersetzt werden ...»(13)
Aber eben dies werden die Neokonservativen nie tun, denn sie sind im Kern nicht Wertkonservative, sondern inkonsequente Strukturkonservative mit einer sentimentalen Ader.
Noch einmal Fetscher, der sich derselben Begriffe bedient: «Die Neokonservativen erweisen sich als halbherzige und widerspruchsvolle Anwälte eben jener konservativen Werte, die von genau den Strukturen zerstört oder zumindest bedroht werden, deren Verteidiger die Neokonservativen zugleich sind.»(14)
Weil man nicht zugleich wertkonservativ und strukturkonservativ sein kann, ohne schließlich zur Heuchelei gezwungen zu werden, weil in der Praxis niemand ohne innere Verkrümmungen einer Entscheidung zwischen beiden ausweichen kann und jede Entscheidung für den Wertkonservatismus über die Mitte hinaus nach links führt, wird rechts von der Mitte nichts Rettendes wachsen können.
11) Iring Fetscher, a.a.O., S. 117 12) Erich Fromm, Haben oder Sein, Stuttgart 1976, S. 17
13) ebenda, S. 172 14) Iring Fetscher, a. a. O., S. 117
106
Die Revolutionäre
Utopien seien wie Wolken, sagte zu Beginn unseres Jahrhunderts jener Friedrich Naumann, dessen politisches Ziel, die «Mehrheit links vom Zentrum», erst zwei Generationen später erreicht werden sollte.
«Ganz falsch ist es zu sagen, daß Wolken nichts sind. Sie sind nur nicht, was sie in ihrer stolzen Pracht zu sein scheinen. Der Regen, der von ihnen kommt, beweist, was und wieviel sie sind. Sie sind keine ganz neue Welt, sondern nur eine Befruchtung der alten ... Ohne sie wird das Land zur Wüste, vertrocknet, schattenlos und tot.»(15) Friedrich Naumann, Freiheitskämpfe, Berlin 1911, S. 247 wikipedia Friedrich_Naumann 1860-1919
Vielleicht haben wir in diesem Jahrhundert, weit mehr, als uns bewußt war, von dem Regen gelebt, der aus den Wolken von lebendigen Utopien kam. Und vielleicht hängt die Lähmung unserer Gesellschaft auch damit zusammen, daß es massenwirksame Utopien nicht mehr gibt.
Die Wolke der liberalen Utopie hat sich aufgelöst. Der Glaube an die für alle heilsamen Wirkungen individuellen Glücksstrebens, an den einzelnen als Schmied seines Glücks, das dann auch der anderen Glück werde, diese Utopie, seit einem Jahrhundert sozialistischer Kritik ausgesetzt, dürfte durch Fred Hirsch ihren letzten Stoß erhalten haben. wikipedia Fred_Hirsch 1931-1978
Die technokratische Utopie - wenn diese phantasieloseste Form des Denkens je den Rang einer Utopie hatte -, der Glaube an den unaufhörlichen und unaufhaltsamen Fortschritt durch technokratische Fortschreibung, hat seine Massenwirksamkeit schon verloren. Daß die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnis in technische Innovation, technischer Innovation in wirtschaftliches Wachstum, uns in eine Welt des Überflusses und des menschlichen Glücks führe, glauben nur noch wenige.
An die Wolke dieser Utopie erinnert nur noch künstlich produzierter Nebel zur Verschleierung von Machtpositionen. Rudolf Bahro hat wohl recht, wenn er hier von einer «der lebensfeindlichsten Illusionen der Gegenwart»(16) spricht. (16) Rudolf Bahro, Die Alternative, Frankfurt 1977, Seite 311
107
In einem kleinen europäischen Land, in Dänemark, ist durch ein 1978 erschienenes Buch so etwas wie eine grüne Utopie wirksam geworden. Dort hat der Versuch von drei Autoren, eine ökologisch orientierte sozialistische Basisdemokratie mit geringen Restfunktionen des Nationalstaates bis in Einzelheiten auszumalen, die Gesellschaft bewegt. Eine deutsche Übersetzung(17) des Buches ist fast unbeachtet geblieben. Für die deutsche Ökologiebewegung zählen Experiment, Praxis und Bewegung offenbar mehr als klar umrissene Bilder einer erstrebenswerten Zukunft.
Massenwirksam ist heute in Europa auch die bedeutendste Utopie unseres Jahrhunderts nicht mehr, die sozialistische. Und dies sicher nicht nur, weil, Ernst Bloch zufolge, «der Sozialdemokrat als völlig utopieloser Typ ein Sklave der objektiven Tendenzen»18 geworden wäre.
Es läßt sich kaum bestreiten, daß bei einem Teil der Sozialdemokraten ein öder, zur Ideologie überhöhter Pragmatismus dafür herhalten muß, daß man sich jenen selbstgefertigten Sachzwängen fügt, von denen in diesem Buch die Rede ist. Es soll auch nicht darüber hinweggeredet werden, daß Erschlaffungserscheinungen in dieser Partei damit zu tun haben, daß die Spannung zwischen Utopie und Wirklichkeit, aus der progressive Politik lebt, in sich zusammengebrochen ist. Aber wer die Geschichte der letzten sechs Jahrzehnte nicht verdrängt, wird wohl hinzufügen müssen: Daß «der Sozialdemokrat als völlig utopieloser Typ» allzuoft den bequemen Weg der Anpassung sucht, ist nicht zu trennen von den verheerenden Folgen eines zynischen Umgangs mit der sozialistischen Utopie, wie er seit Jahrzehnten im sowjetischen Machtbereich üblich geworden ist.
Wenn auch aus dieser Utopie heute nur noch wenige Regentropfen auf durstiges Land fallen, dann ist dies vor allem der Wirkung des Systems zu verdanken, das Rudolf Bahro — unverdientermaßen — als «real existierenden Sozialismus» bezeichnet.
17) N. Meyer, H. Petersen, V. Sörensen, Aufruhr der Mitte, Hamburg 1979 18) Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt o. J., 3 Bde., S. 677
108
Von dem, was — aus welchen Gründen auch immer — aus der großen Oktoberrevolution geworden ist, geht heute nur noch Entmutigung aus, und zwar in beiden Teilen Europas. Was könnte die Utopie von der klassenlosen, herrschaftsfreien, brüderlichen Gesellschaft der Freien und Gleichen gründlicher diskreditieren als ein starres System bürokratischer Herrschaft, das sich auch zwei Generationen nach der Revolution die elementaren bürgerlichen Freiheiten noch nicht leisten kann?
Daß der Stalinismus den sozialistischen Glauben pervertiert hat, wird seit 1956 auch in der Sowjetunion nicht bestritten. Aber was hat diesen Stalinismus abgelöst? Die glanzvolle Idee des schlauen Pragmatikers Nikita Chruschtschow, den Westen, ja die USA, im Lebensstandard, im wirtschaftlichen Wachstum einzuholen und zu überholen.
Sogar wenn dieser Versuch, wirtschaftlich rascher zu expandieren als der Kapitalismus, nicht so jämmerlich gescheitert wäre, hätte schon diese Zielsetzung signalisiert, daß der Anspruch aufgegeben war, nach eigenen Maßstäben mit eigenen Mitteln aus eigener Kraft etwas Neues, qualitativ anderes zu schaffen. Wenn den bürokratischen Verwaltern einer großen Revolution nichts Aufregenderes mehr einfällt, als im materiellen Konsum die einzuholen, die sich die Revolution gespart hatten, dann ist dies die Aufgabe der sozialistischen Utopie. Und wenn man dann die gesteckten Ziele nicht annähernd erreicht, wenn ein riesiges Land wie die Sowjetunion auch im siebten Jahrzehnt nach der Revolution sich noch nicht einmal aus eigener Kraft ernähren kann, dann wird eine große Idee mitleidigem Lächeln ausgeliefert.
Nein, nichts Neues, Eigenes, was diese Revolution hervorbrachte, hat sich durchsetzen können: nicht in der Architektur (außer einem Zuckerbäckerstil, dessen sich auch Sowjetbürger heute schämen), nicht in der bildenden Kunst (außer einem Realismus, den es unter ganz anderen politischen Vorzeichen anderswo auch gab), nicht einmal im Lebensstil, der sich bei einem kommunistischen Funktionär nicht anders, nur kümmerlicher ausnimmt als bei einem Kleinbürger im Westen, erst recht nicht in der Technik.
Nein, die Oktoberrevolution hat schließlich nur bestätigt, was Rudolf Bahro so formuliert hat: «In der Geschichte haben die Unterklassen bislang letzten Endes genau das als Standard haben wollen, was die Oberklassen schon besaßen.»(19)
19) Rudolf Bahro, Elemente einer neuen Politik, Berlin 1980, S. 73
109
Die Verwalter der Revolution haben letztlich nur einen Abklatsch des kapitalistischen Industrialismus zuwege gebracht, weniger dynamisch, weniger farbig, weniger effizient, aber sicher nicht weniger hart. Auch der Einwand, historische Prozesse brauchten nun einmal mehr Zeit, als ihre Träger vermuteten, zumal wenn eine Revolution sich unablässig gegen äußere Feinde ihrer Haut zu erwehren habe, auch dieser Einwand sticht — zumindest für die Erben der russischen Revolution —nicht mehr. Denn das deprimierendste Kennzeichen des sowjetischen Systems ist seine Unbeweglichkeit, seine Sterilität, seine Unfähigkeit, Neues wachsen zu lassen.
Was diskutiert werden darf, was tabu ist, entscheiden die Mitglieder des Politbüros, deren Durchschnittsalter sich mit dem eines Kardinalskollegiums messen kann. Eine Ökologiebewegung, wie die westlichen Gesellschaften sie ernst zu nehmen lernen, kann sich nicht entfalten. Die Basis, von der im Westen kräftige Impulse kommen, wird so konsequent gegängelt, so jedes spontanen Gedankens entwöhnt, daß auch von dort keine Veränderung ausgehen kann, es sei denn eine, die das System radikal in Frage stellt oder, wie in Polen, in Frage stellen würde, wenn die Führungsmacht des Blocks nicht jederzeit politische, wirtschaftliche und ideologische Schwäche durch militärisches Auftrumpfen kompensieren könnte.
War von Stalin noch Faszination ausgegangen — so befremdlich dies heute erscheinen mag —, positive wie negative, Vergötterung und Haß, so strahlt das sowjetische System heute eher Mißmut und Langeweile aus. Die vielen Antikommunisten, die sich vor der revolutionären Dynamik der kommunistischen Ideologie fürchten, sehen wohl ebenso an der Wirklichkeit vorbei wie die wenigen Kommunisten, die mit grotesken geistigen Verrenkungen sozialistische Utopie und «real existierenden Sozialismus» verbinden wollen. Was die kommenden Jahrzehnte belastet, ist nicht die Dynamik, sondern der Verwesungsprozeß einer Ideologie, die nur noch zur Legitimation bürokratischer Herrschaft gebraucht und mißbraucht wird. Wer in die Führungsschichten des Ostens hineinhorcht, wird den Verdacht nicht los, die einzigen, die noch ungebrochen an die Kraft der Sowjetideologie glauben, seien die Kalten Krieger im Westen.
Und trotzdem ist, wie durch ein Wunder, die sozialistische Utopie noch nicht tot. Wie tief muß eine Idee in dem verwurzelt sein, was Menschen zu allen Zeiten als ihre besten menschlichen Möglichkeiten mehr erahnt als erkannt haben, wenn sie solche Erfahrungen überlebt. Die sozialistische Idee kann überleben, aber nur, wenn sie den Veränderungen des Bewußtseins folgt, die seit der Zäsur der frühen siebziger Jahre im Gange sind.
110
Bewußtseinswandel
Wenn heute Rettendes wächst, dann nicht an der Spitze der Institutionen, sondern da, wo Menschen versuchen, menschlicher miteinander zu leben, an der sogenannten Basis.
Der Wandel des Bewußtseins vollzieht sich rascher, als wir meinen, weil wir selbst an diesem Wandel teilhaben, selbst im Strom dieses Wandels schwimmen. Solange wir nicht ans Ufer sehen, bemerken wir nicht, wie weit der Strom auch uns schon getrieben hat. Geben wir uns Rechenschaft, was wir selbst vor zehn oder gar fünfzehn Jahren getan, gedacht und gesagt haben, so wird uns klar, welchen Weg wir hinter uns haben!
Wer, wie der Autor, noch 1968 die Rettung der Entwicklungsländer im Schnellen Brüter sah, wer noch Ende der sechziger Jahre Entwicklung in der Dritten Welt gleichgesetzt hat mit Aufholen, also mit Nachvollzug unserer Entwicklung, wer sich erinnert, mit welch naivem Stolz überall die Ankündigung des Verkehrsministers Georg Leber aufgenommen wurde, künftig dürfe kein Ort der Republik mehr als fünfzehn Kilometer von einer Autobahn entfernt sein, wer all dies nicht verdrängt, kann ermessen, welcher Wandel sich inzwischen vollzogen haben muß.
Wurde Ende der sechziger Jahre die Frage nach der friedlichen Nutzung der Atomkraft von einer erdrückenden Mehrheit mit einem simplen: «Ja, warum denn nicht?» abgetan, so erklären heute auch die Befürworter der Kernenergie: «Wenn wir's uns auswählen könnten, wir würden ja gerne darauf verzichten, leider geht es nicht.»
111
Weckten großtechnische Anlagen noch in den sechziger Jahren Gefühle des Stolzes auf menschliche Leistungsfähigkeit, so erregen dieselben Anlagen heute eher Mißtrauen, Angst, Gefühle der Ohnmacht und der Hilflosigkeit.
Sahen Hunderte von Millionen fasziniert die Landung des ersten Menschen auf dem Mond, so interessiert die Raumfahrt heute nur noch insofern, als sie uns die Einzigartigkeit unseres Planeten vor Augen führt, den wir so erbarmungslos plündern, obwohl wir doch auch im Weltall nichts finden werden, wenn wir ihn ruiniert haben.
Antworteten auf die — sicher nicht ausreichend differenzierte — Frage, ob sie an den Fortschritt glauben, noch 1972 drei Fünftel der Bundesbürger mit Ja, ein Fünftel mit Nein, hat heute das Nein eine klare Mehrheit. Die Zahl derer, denen mehr Freizeit wichtiger ist als höheres Einkommen, wächst stetig und hat die Fünfzigprozentmarke überschritten.
Thomas Meyer ist, gestützt auf Untersuchungen von Ronald Inglehart,20 Richard Löwenthal21 und die bereits erwähnten Arbeiten von Daniel Bell und Fred Hirsch, diesen Wandlungen in einem gründlichen Aufsatz nachgegangen. Sein Ausgangspunkt:
«Rascher und umfassender als jemals seit dem Bestehen der industriellen Gesellschaft sind gerade in Schlüsselgruppen — in der jungen Generation, in der neuen Mittelschicht und darüber hinaus — Veränderungen der handlungsleitenden Wertorientierungen zu beobachten, die auf eine Veränderung der individuellen Lebensformen, der Organisation des gesellschaftlichen Lebens, aber auch eine Krise der persönlichen Leistungsmotivation hindeuten.»(22)
Dabei handelt es sich offenbar nicht um rasch wechselnde Stimmungen oder gar Moden, sondern um einen elementaren geschichtlichen Vorgang: Meyer zufolge «dürfte es sich bei beiden Tendenzen des Wertwandels um langfristig stabile Trends handeln. Ihre Intensität und die Zahl der Menschen, die von ihnen erfaßt werden, dürfte aus denselben Gründen noch beträchtlich zunehmen.»23
20) Ronald Inglehart, The Silent Revolution in Europe, The American Political Science Review, Dec. 1971, S. 991-1017
21) Richard Löwenthal, Gesellschaftswandel und Kulturkrise, Frankfurt 1979
22) Thomas Meyer: Wertwandel, Industrielle Gesellschaft und D. Soz., in: Demokratischer Sozialismus, Geistige Grundlagen und Wege in die Zukunft, 1980, s.154
23) ebenda, S. 163
112
Meyer unterscheidet — als Antwort auf die neokonservativen Klagen über den Wertverfall — eine destruktive und eine konstruktive Tendenz des Wertwandels:
«Die eine (destruktive) Tendenz des Wertwandels verläuft in der Richtung einer sich offenbar beschleunigenden Aufzehrung der Substanz jener Wertegruppe, die für das Entstehen der westlichen Industriegesellschaften von ausschlaggebender Bedeutung war. Zu ihr gehören: die Wertschätzung aufopferungsvoller Arbeit auch in an sich unbefriedigender Berufstätigkeit; die Bereitschaft zu Höchstanstrengungen für gesellschaftlich anerkannte Leistungen sowie zur pflichtbewußten Ein- und Unterordnung auch in gesellschaftlichen Verhältnissen, die eigene Mitentscheidung weitgehend ausschließen.
Die andere (konstruktive) Tendenz des Wertwandels verläuft in der Richtung einer wachsenden Bedeutung jener Werte für eine zunehmende Zahl von Menschen, die auf umfassende individuelle Selbstverwirklichung, auf Hinwendung zu neuen Formen der Gemeinschaftserfahrung und Bindung, Verlangen nach rationaler Rechtfertigung aller gesellschaftlichen Verhältnisse unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten sowie auf Chancen zur sozialen Sinnerfahrung im Arbeitsleben und allen anderen Lebensbereichen gerichtet sind.»24
Es ist üblich geworden, im Blick auf diesen Wandel von Krise zu sprechen. Und dafür gibt es mehr als einen Grund. Vor allem weckt der beschriebene Bewußtseinswandel bei vielen Menschen eine Mischung aus Angst, Verwirrung und Aggressivität. Sie verstehen die Welt nicht mehr und sehnen sich zurück zu einer klaren, hierarchischen Ordnung. Trotzdem gibt Alain Touraine mit Recht zu bedenken, ob es nicht besser wäre, von einer Mutation, einer — plötzlichen — qualitativen Veränderung zu reden:
«Von Krise sprechen heißt, sich auf den Standpunkt der Macht zu stellen. Spricht man dagegen von Mutation, so bedeutet dies, daß man die Herausbildung eines neuen kulturellen Feldes, neuer Beziehungen und neuer gesellschaftlicher Konflikte ins Auge faßt und damit die Aufmerksamkeit auf die neu in Erscheinung tretenden Volksbewegungen und die neuen Formen der Macht lenkt.»25)
24) ebenda,S.161 25) Alain Touraine, Krise oder Mutation, in: ders. u.a., Jenseits der Krise, Frankfurt 1976, S. 48
113
Für die These Touraines spricht, daß der Bewußtseinswandel mit unterschiedlicher Geschwindigkeit vor sich geht, in der Regel um so rascher, je weiter man von den Zentren ökonomischer und politischer Macht entfernt ist, um so langsamer, je näher an den Zentren solcher Macht die Menschen sich bewegen.
Da gibt es Kirchengemeinden, keineswegs nur protestantische, die gemeinsam mit Pfarrer oder Priester eigene Versuche christlichen Lebens unternehmen, an denen Bischofsworte, mit fröhlicher Nachsicht zur Kenntnis genommen, wenig ändern können. Da entstehen innerhalb großer Gewerkschaften Arbeitsgruppen, die sich wenig um den Segen oder das Stirnrunzeln des Bevollmächtigten kümmern, da arbeiten sozialdemokratische Ortsvereine an einer menschennahen Kommunalpolitik, geben unter beträchtlichen Opfern an Geld und Zeit ihre kleine Zeitung heraus und zucken, auf «die da oben» angesprochen, mitleidig die Achseln.
Dramatisch wirkt sich der Wandel des Bewußtseins bei jungen Menschen aus. Bei ihnen gibt es keine alten Bewußtseinsschichten, die erst verwandelt oder überlagert werden müssen. Klaus Röhring hat, unter Berufung auf Fulbert Steffensky und Eugen Kogon, das Neue im Bewußtsein junger Menschen so zusammengefaßt:
«1. Die <fröhliche Souveränität> - zumindest eines Teils der Jugendlichen - gegenüber den Gesetzmäßigkeiten der industriewirtschaftlichen Zivilisation, deren zentrale Kategorie das Anwachsen des Bruttosozialprodukts ist.
2. Die bei vielen Jugendlichen gestiegene Fähigkeit, nach den eigenen Bedürfnissen zu leben. Die Fähigkeit auch, sich nicht diktieren zu lassen, was wichtig zu sein hat.
3. Die neue Sensibilität gegenüber der Natur.
4. Die basisdemokratische Fähigkeit, von Institutionen (Polizei, Kirche, Behörden, Staat) Legitimation zu verlangen; das selbstverständliche Mißtrauen gegen Macht...
5. Die neue <Internationalität> oder die neue Art, sich synkretistische Lebensphilosophien zusammenzustellen.»(26)(26) Klaus Röhring, Jugend '80, in: L'80, Heft 14, S. 70 qwant synkretistisch
114
Für Bewußtseinswandel von solcher Tiefe gibt es — zumindest ohne zeitlichen Abstand — keine Erklärungen im Sinne einfacher Kausalität. Nur eines läßt sich heute schon sagen: Nicht der eine oder andere Intellektuelle kann solchen Wandel bewirken, er kann ihm bestenfalls Ausdruck verleihen, ihn damit formen und ihm Ziel und Richtung geben. Geschichtlich wirksame Umschichtungen im Bewußtsein von Menschen geschehen durch elementare Erfahrungen im Alltag, in der Arbeit, in den Beziehungen von Mensch zu Mensch oder Mensch und Natur — nicht durch Lektüre.
Wer Bewußtseinswandel an sich und anderen erfährt, wird sich auf simple Erklärungen und Begründungen besser nicht einlassen, er wird allenfalls konstatieren, beschreiben und vielleicht eine Deutung versuchen.
Frauenbewegung
Einen Versuch der Deutung verdanken wir Horst Eberhard Richter. Folgt man seiner These, so ist der europäische Mensch in der Neuzeit ausgezogen, durch Wissen und Naturbeherrschung die Allmacht selbst zu erringen, die er im Mittelalter dem Schöpfergott zugeschrieben, in dessen Allmacht er sich geborgen gefühlt hatte.
Aus diesem «Gotteskomplex» entsteht eine einseitig männliche Kultur, die geprägt ist von herrischem, leidlosem Machen und gedemütigtem, machtlosem Leiden. Was wir für Fortschritt hielten , wird zur «Flucht nach vorn», bei der wir «durch ausschließliche Konzentration auf das reine Machen der Frage nach dem Sinn ausweichen, dem das Machen zu dienen hätte».27
Das Europa der Neuzeit, das jetzt in seine Krise gerät, war einseitig geprägt durch den Willen, den Intellekt, den Herrschaftswillen des — deformierten — Mannes. Alles, was dem Willen zur Autonomie, zur Aktivität, zur Herrschaft, zur Macht, zur rationalen Erschließung und Ausbeutung der Natur widersprach, alles, was den Menschen an seine Abhängigkeit erinnerte, mußte unterdrückt werden: «Alle Gefühle, die passiv erfahren wurden, wurden zu unerwünschten Leidenschaften, zu passions de l'âme, zu Feinden des Machtwillens. Auch die Liebe in der Form der Selbsthingabe wurde zu etwas Minderwertigem, weil sie die um jeden Preis zu stabilisierende Selbstsicherheit schwächte.»28
27) Horst Eberhard Richter, Der Gotteskomplex, Reinbek 1979, S. 271
115
Wie im Mittelalter der Herrschergott über das Menschengeschöpf, so sollte jetzt das rationale Ich nicht nur über die äußere, sondern auch über die innere Natur «einschließlich der passiven Seelenzustände» herrschen.
Dies hatte Folgen für das Verhältnis der Geschlechter. Es kam zu einem «gesellschaftlichen Aufspaltungsprozeß». Wie der Intellekt mit dem Gefühl umging, so der Mann mit der Frau. Vom Menschen der Neuzeit ließe sich sagen: «Was'er werden wollte, teilte er dem Mann zu. Was er nicht mehr sein oder als unerwünschten Teil unterdrücken wollte, delegierte er an die Frau.»29
Die Rollen werden verteilt: «Der Mann sorgt für die Errechnung und Bemächtigung der Natur. Er okkupiert <raison> (Vernunft) und <volonte> (Willen). Die Frau begleitet ihn in emotionaler Ergebenheit. Ihr verbleibt das <cceur> (Herz), aber gewissermaßen im Sinne einer potentiell jederzeit abrufbaren Dienstleistung.»30
Heute wird klar: Statt der höheren menschlichen Zivilisation, die mit dieser einseitig männlichen Anstrengung mehr oder minder gewaltsam erreicht werden sollte, führen die «Eskapaden des männlichen Größenwahns» in die Katastrophe, während «die dreihundert Jahre hindurch herabgestuften und unterdrückten Werte sich heute gerade als diejenigen erweisen, die für eine Rettung und Gesundung der Gesellschaft maßgeblich werden müßten».31
Die Frauen aber, die gerade als Unterdrückte, Leidende, die Rollenspaltung weniger versehrt überstanden haben als die Männer, können heute ihre Aufgabe der «psychischen Erweiterung», der «Rehabilitation der Emotionalität» noch nicht übernehmen, weil sich ihre «nur wenig gelockerte soziale Unterdrückung» tief in die gesellschaftlichen Strukturen eingeprägt hat.
28) ebenda, S. 98 29) ebenda, S. 99 30) ebenda, S.100 31) ebenda, S. 99
116
Eine Frauenbewegung, die nichts Besseres anzustreben wüßte als die Nachahmung angeblich männlicher Rollen, die auf den Mann schon deformierend genug gewirkt haben, wäre ebenso fatal wie ein resignierter Rückfall in die herkömmliche Rollenspaltung. Neues Bewußtsein zeigt sich da, wo Frauen selbstverständlich und unverkrampft gleiche Rechte verlangen, wo sie sich selbstbewußt in die Gesellschaft einbringen, aber auch da, wo Männer sich der Deformationen bewußt werden, die sich aus ihrer traditionellen Rolle ergeben.
«Manche militant feministischen Bücher und Zeitschriften sowie zahlreiche kleine kämpferische Frauengruppen könnten zu der Fehleinschätzung verführen, als sei ein aggressives Rivalisieren der Frauen mit den Männern und damit verbunden eher eine Vertiefung der Kluft zwischen beiden das Thema der Zeit. Tatsächlich ist aber die gegenläufige Strömung das durchschlagendere Phänomen. Unsere Erhebungen bestätigen unbezweifelbar einen gemeinsamen Trend, der auf mehr Weichheit, Gefühlsbetonung, Bejahung von tiefen Kontaktwünschen und emotionaler Offenheit hinzielt.»32
Befreiung der Frau von patriarchalischer Herrschaft wird es nicht geben können in einer industriellen Zivilisation, in der es überall um Herrschaft geht, Herrschaft über die Natur ebenso wie Herrschaft über Klassen, über die Völker der Dritten Welt. Iring Fetscher33 verweist auf Rosemary Radford-Ruether, die schon 1975 diese Verknüpfung erkannte: «Die Frauen müssen erkennen, daß es in einer Gesellschaft, deren Grundmodell der Beziehungen das der Beherrschung ist, weder für sie eine Befreiung noch eine Lösung der ökologischen Krise geben kann.»34
Für diesen Teil der Frauenbewegung «geht es nicht mehr darum, den Frauen in der im übrigen unveränderten Industriezivilisation einen angemessenen <Platz an der Sonne> zu verschaffen, sondern — womöglich gemeinsam mit einsichtigen Männern — diese Industriezivilisation so zu verändern, daß sie keine Unterdrückung weiblicher Humanität mehr verlangt».35
32) ebenda, S. 195
33) Iring Fetscher, Überlebensbedingungen der Menschheit, München 1980 I.Fetscher bei detopia
34) Rosemary Radford-Ruether, New Woman, New Earth, Sexist Ideologies and Human Liberation, New York 1975, S. 204ff
35) Iring Fetscher, a. a. O., S. 18
117
Vielleicht übertreibt Roger Garaudy, wenn er meint: «Die radikalste Veränderung muß von den Frauen kommen.»(36. Roger Garaudy, Appel aux vivants, a.a.O., S. 393)
Es geht nicht darum, einer wachsenden Frauenbewegung Lasten auf die Schultern zu laden, die sie erdrücken und entmutigen, aber doch darum, eine lebendige Frauenbewegung, die sich auch selbst von Verengungen und Verkrampfungen befreit, als ein Zeichen der Hoffnung zu verstehen und zu unterstützen. Weil hier Heilendes und Heilsames wächst, wird es nötig sein, jeder Familienideologie zu widerstehen, die letztlich die Frau wieder dahin verweisen möchte, wo sie jahrhundertelang — zu ihrem und des Mannes Nachteil — ihren Platz hatte, jeder Familienideologie, in der die Rolle des Mannes unangetastet bleibt. Nichts darf zurückgenommen werden, was Frauen im letzten Jahrzehnt an Eigenständigkeit, Selbstbewußtsein, an Geltung in Gesellschaft und Beruf zugewachsen ist.
Die Frage nach der Familie von morgen ist die nach einer Gemeinschaft, in der beide, Frau und Mann, aus einer kränkenden, krankmachenden Aufgabenteilung heraus aufeinander zutreten. Dazu müssen berufliche Funktionen anders aufgeteilt, Arbeit zeitlich flexibler angeboten werden, damit Frau und Mann ihre Aufgaben sinnvoller teilen können.
Frieden mit der Natur
Teil des Bewußtseinswandels unserer Zeit ist ein neues Verhältnis zur Natur oder doch wenigstens das Bemühen darum. Natur als Materiallager, als Steinbruch, als Ausbeutungsobjekt — diese Vorstellung bestimmt zwar meist noch die Praxis, aber es gibt kaum noch jemanden, der sie öffentlich vertreten oder verteidigen wollte. Dem liegt nicht nur die rationale Einsicht zugrunde, daß wir dabei sind, uns in einem erbarmungslosen Vernichtungskrieg mit der Natur die eigenen Lebensgrundlagen unter den Füßen wegzuziehen; inzwischen ist vielen auch klargeworden: Was wir tun, ist insofern auch unmenschlich, als Menschen wohl auch miteinander nicht menschlich umgehen können, wenn sie andere Lebewesen, Pflanze und Tier, nur als beliebig manipulierbare Bestandteile einer Wegwerfwirtschaft behandeln. Ausbeutung der Natur und Ausbeutung des Menschen sind enger miteinander verknüpft, als uns bisher klar war.
118
Dabei tun wir gut daran, die Vergangenheit nicht zu verklären. Es ist höchst zweifelhaft, ob unsere Vorfahren ein besonders ersprießliches Verhältnis zur Natur hatten.
Daß die Alpen von faszinierender Schönheit sind, haben die Europäer vor gut zweihundert Jahren entdeckt. Vorher wurden die Hochgebirge eher als unwirtlich, ökonomisch wertlos, vor allem als abweisend, menschenfeindlich, bedrohlich empfunden. Daß man sich die - überdies gefährliche - Mühe machen könne, auf ihre Gipfel zu klettern, erschien undenkbar, ja lächerlich.
Auch die romantische Begeisterung für den «deutschen Wald» ist sehr jungen Datums. Wälder wurden, man lese nur unsere Märchen oder auch noch Grimmeishausen nach, eher als etwas Düsteres, Unwegsames, Gefahrvolles, ja Feindliches empfunden, wo man sich verirren, erfrieren, wilden Tieren begegnen konnte.
Unsere Vorfahren hatten sich zu behaupten gegen die Gewalten der Natur, Sturm, Wasser, Dürre, Gewitter, vor allem gegen die Kälte, die über viele Monate ganze Großfamilien in einen einzigen beheizten Raum pferchte.
Sicher hat die Aufforderung zum dominium terrae, zur Herrschaft über die Natur, in der Genesis37 den Europäern ein gutes Gewissen bei ihrem robusten Umgang mit der Natur gegeben,(38) sicher hat die schroffe Unterscheidung Descartes'(39) zwischen der res cogitans, also dem Menschen als denkendem Ding, und den res extensae, den Dingen, die nur eine Ausdehnung haben, dazu beigetragen, daß auch Pflanze und Tier wie leblose Sachen behandelt wurden und jeden Eigenwert einbüßten. Es bleibt die elementare Tatsache, daß Natur dem bäuerlichen Menschen lange Zeit mehr als Aufgabe und Bedrohung denn als Idylle entgegentrat. Wie der Adel Natur verstand, mag man an der Art ablesen, wie bis ins 18. Jahrhundert Parks im französischen Stil angelegt wurden. Natur war da meist Staffage, Kulisse für große Auftritte, etwas zu Nutzendes, Zurechtzustutzendes, das erst dann geschätzt wurde, wenn der Mensch sein Wollen und Ordnen. also sich selbst in ihr wiedererkannte.
37) 1. Mose 1,26-28
38) Darauf hat schon 1967 L. White in seinem Aufsatz The Historical Roots of Our Ecological Crisis hingewiesen, später Carl Amery, Das Ende der Vorsehung, Reinbek 1972
39) Siehe die theologisch bedeutsame Untersuchung von Gerhard Liedtke, Im Bauch des Fisches, Stuttgart 1979, S. 51
119/120
Aber dies alles hatte keine schlimmen Folgen. Es fehlte dem Menschen ganz einfach die Macht, Natur in solchem Umfang zu zerstören, daß er sich damit selbst hätte gefährden können. Er hatte keine Motorsägen, mit denen er viele Hektar Wald in kürzester Zeit hätte kahlschlagen, keine Maschinen, mit denen er riesige Flächen mit Beton hätte überziehen können, keine Gifte, die ganze Flüsse oder Seen hätten sterben lassen oder ganze Städte in gespenstisches Niemandsland hätten verwandeln können. Das Verhältnis zur natürlichen Umwelt, vor zweihundert Jahren noch eine kulturgeschichtliche Kuriosität ohne Wirkung auf die Natur selbst, ist jetzt zur Frage nach dem Überleben der Menschen selbst geworden. Weil unsere Macht in einer beispiellosen Weise gewachsen ist, wuchs mit ihr auch unsere Verantwortung in einem Maße, das möglicherweise unsere Fähigkeit zum Bewußtseinswandel übersteigt.
#
Nur wenn der Wandel der Wertvorstellungen sich schließlich in gesellschaftliche Strukturen einprägen, Naturzerstörung verhindern und auf politische und wirtschaftliche Entscheidungen einwirken kann, lassen sich unsere Lebensgrundlagen bewahren. Frühe Gegenbewegungen gegen die Degradierung der Natur, erst im «Sturm und Drang», dann in der Romantik, haben nur eine schmale Schicht von Bürgern — und teilweise auch Aristokraten — erreicht. Die Naturmystik eines Novalis wäre wohl auch einem Kleinbauern nicht zu vermitteln gewesen, den keine Hagelversicherung vor den Launen des Wetters schützte. Auch die Naturfrömmigkeit der Jugendbewegung war eher Rückzug, Emigrationsversuch aus einer Welt rapide voranschreitender Technik als das Bemühen, den Weg von Wirtschaft und Technik neu zu bestimmen.
Was sich heute an neuem Bewußtsein bildet, meint nicht, wie die Romantik, Einswerden mit der Natur, sondern Partnerschaft mit der Natur (Günter Altner) oder, vielleicht noch eindrücklicher, Frieden mit der Natur.40
40) Unter dem Titel <Frieden mit der Natur> erschien im Herder-Verlag Freiburg 1979 eine Aufsatzsammlung, herausgegeben von Klaus Meyer-Abich wikipedia Klaus_Michael_Meyer-Abich
Klaus Meyer-Abich hat dies so formuliert:
«Die Industriegesellschaften leben davon, daß den Dingen und Lebewesen der Natur, die auch unsere Natur ist, Gewalt angetan wird. Der Frieden mit der Natur kann nur gefunden werden, wenn sie nicht mehr nur als Objekt und Ressource, sondern auch im Sinn einer Verantwortung <wahr genommen> wird.»41
Die von Dieter Birnbacher beschworene Gefahr, daß «ein harmonisches Verhältnis zwischen Mensch und Natur» verwechselt werden könnte mit einem «romantisch-verklärenden oder einem mystisch-irrationalen Verhältnis zur Natur»42, ist wohl kaum gegeben. Am einfachsten und präzisesten haben die katholischen Bischöfe in einer — viel zuwenig beachteten — Erklärung vom September 1980 gesagt, was Frieden mit der Natur bedeutet:
«Sie (die Schöpfung) ist da, damit wir sie brauchen. Aber sie ist mehr noch da, um einfach da zu sein. Beides schließt einander nicht aus. Wo wir aber die Dinge nicht mehr sie selber sein lassen, sondern wo sie nur noch Werkzeug, Rohstoff, Material, Energiequelle sind, da nehmen wir uns selbst die Welt.»(43)
Den Bischöfen ist dabei offenbar klar, daß sie sich mit ihrem Wort ganz in der Nähe von Erich Fromm bewegen, wenn sie sagen: «Für den Menschen gilt der Vorrang des Seins vor dem Haben.»44 Ob sie sich allerdings, so wie Fromm es war, der revolutionären Wirkung solcher Worte bewußt sind, mag man bezweifeln. Sicher ist es gut, wenn in den Kirchen, auch der evangelischen, jetzt darüber nachgedacht wird, ob sie nicht selbst dazu beigetragen haben, «um eines weltlosen Heils willen die heillose Welt sich selber zu überlassen»45.
Aber auf eine schlüssige Theologie der Schöpfung, die sich auch ins Konkrete wagt — Was darf der Mensch mit und aus Tieren machen? — müssen wir wohl noch einige Zeit warten. Allein die schwindelerregenden Risiken der Gen-Technologie verlangen eine Theologie, die auch klarstellt, ob der Mensch sich zum lenkenden Subjekt der Evolution machen darf, die ihn selbst hervorgebracht hat.
120-121
#
41) ebenda, S. 9
42) ebenda, S. 111
43) Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zu Fragen der Umwelt und der Energieversorgung vom 23.9.1980, S. 7
44) ebenda, S. 7
45) Hermann Dembowski, Natur im Gottesfrieden, in: Frieden mit der Natur, S. 131
Sag' mir, wo die Utopien sind! (detopia)

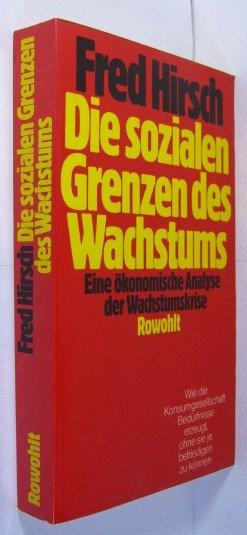


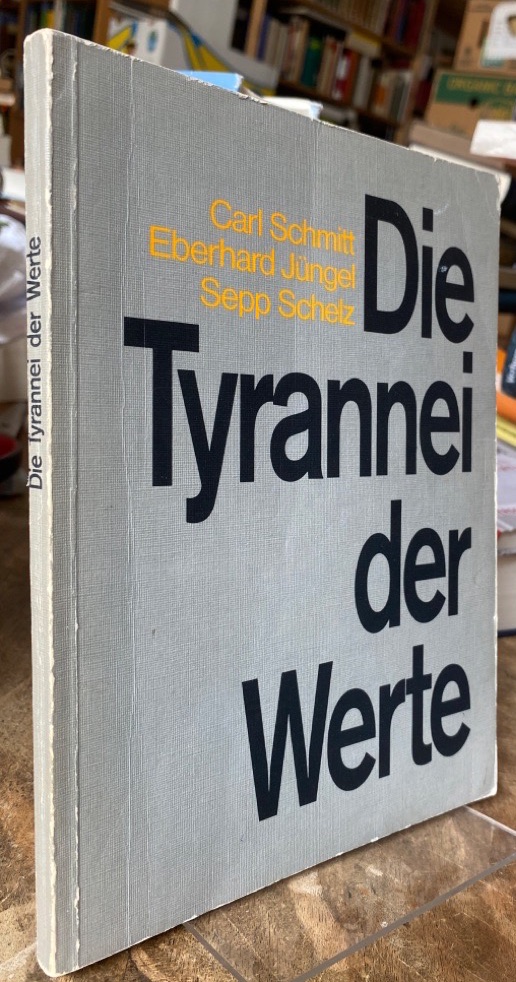
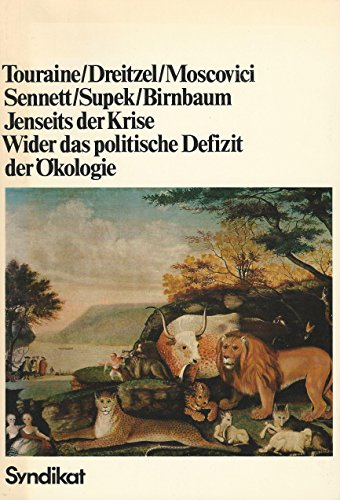
Von Dr. Erhard Eppler 1981