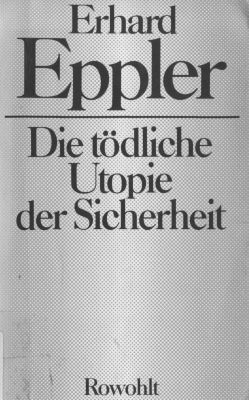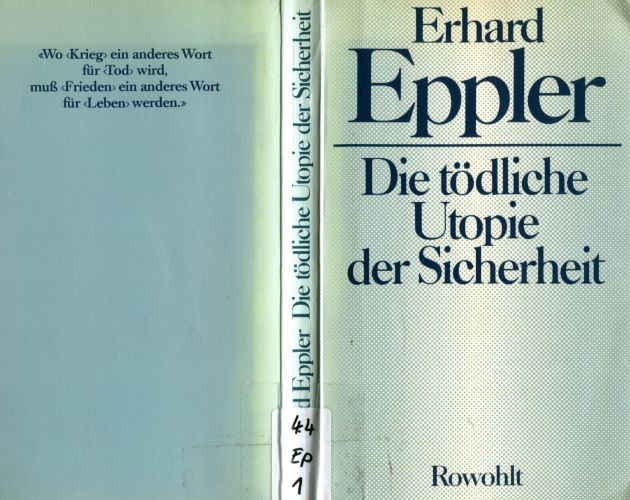Dr. Eppler und detopia standen 2017 im Kontakt
|
Klappe 1 Utopia - dies ist das Land, das es nirgendwo gibt, das aber viele suchen. Und indem sie sich darauf zubewegen, vollzieht sich Geschichte. Utopien bringen Menschen in Bewegung. Die zweite Hälfte unseres Jahrhunderts hat bislang nur trost-lose technokratische Utopien hervorgebracht: die Utopie immerwährenden Wachstums, die Utopie einer errüstbaren Sicherheit. Auch totale Sicherheit gibt es «nirgendwo» - außer im Tode, insofern handelt es sich um eine Utopie. Aber um eine nekrophile, todessüchtige Utopie. Alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür: Wer so sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Eppler untersucht eine Sicherheitskonzeption, deren Logik sich im Bodenlosen, weit weg von den Realitäten menschlichen Lebens, verliert. Wer, wie Ronald Reagans Planungsstäbe, die totale Abschreckung durch Drohung mit dem führbaren und gewinnbaren Atomkrieg will, erreicht im besten aller denkbaren Fälle nur das totale Wettrüsten. In einem solchen Denken hat der Frieden keine Chance. Klappe 2 Der Versuch, das Fenster der Verwundbarkeit zu schließen und damit der Verletzbarkeit, der Hinfälligkeit und der Unsicherheit menschlichen Daseins zu endcommen, muß tödlich enden. Denn diese Verletzbarkeit und Unsicherheit ist auch ein Reflex menschlicher Freiheit. Eppler versucht Wege zu weisen, die herausführen können aus dieser Sackgasse einer tödlichen Utopie, die gegen die militärische Logik der Abschreckung politische Handlungsspielräume wiedererobern. Wo der Selbstmord der Gattung möglich scheint, ist Frieden selbst zur lebensnotwendigen Utopie geworden. Wenn Krieg heute nicht mehr die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, nicht mehr ein begrenztes militärisches Kräftemessen, sondern Auslöschung bedeutet, ist «Frieden» auch nicht mehr das Ende oder das Ausbleiben des Kampfes. Wo «Krieg» ein anderes Wort für «Tod» wird, muß «Frieden» ein anderes Wort für «Leben» werden. «Auch der Weg nach dem Utopia der überlebensfähigen Menschheit wird an Abgründen vorbei und über schmale und wacklige Stege führen. Auch die über-lebensfahige Erde wird kein Ort vollkommener Sicherheit sein, sondern ein Planet, auf dem geboren und gestorben wird. Auch dort werden Menschen mitten im Leben vom Tod umfangen sein. Wer aus dieser Realität ausbrechen will, zerstört auch noch den Rest relativer Sicherheit, der uns als Menschen zukommt.» |
Inhalt I Von den bewegenden zu den schäbigen Utopien (9) II Das Utopia der Unverwundbaren (21)III Vom Gleichgewicht des Schreckens zum Erschrecken vor dem Gleichgewicht (31)IV Die Rettung des Krieges (43)V Muß man den gewinnbaren Atomkrieg gewinnen? (57)VI Der Kanzler denkt, der Präsident lenkt (71) VII Sprache ohne Wirklichkeit (95)VIII Die Wirklichkeit hinter den Feindbildern (111)IX Von Gewißheit und Sicherheit der Christen (127)X Die lebensnotwendige Utopie (147)XI Auf dem Weg zur überlebensfähigen Welt (159)XII Politik des Friedens (173)XIII Die vorweggenommene Utopie (205-220) |